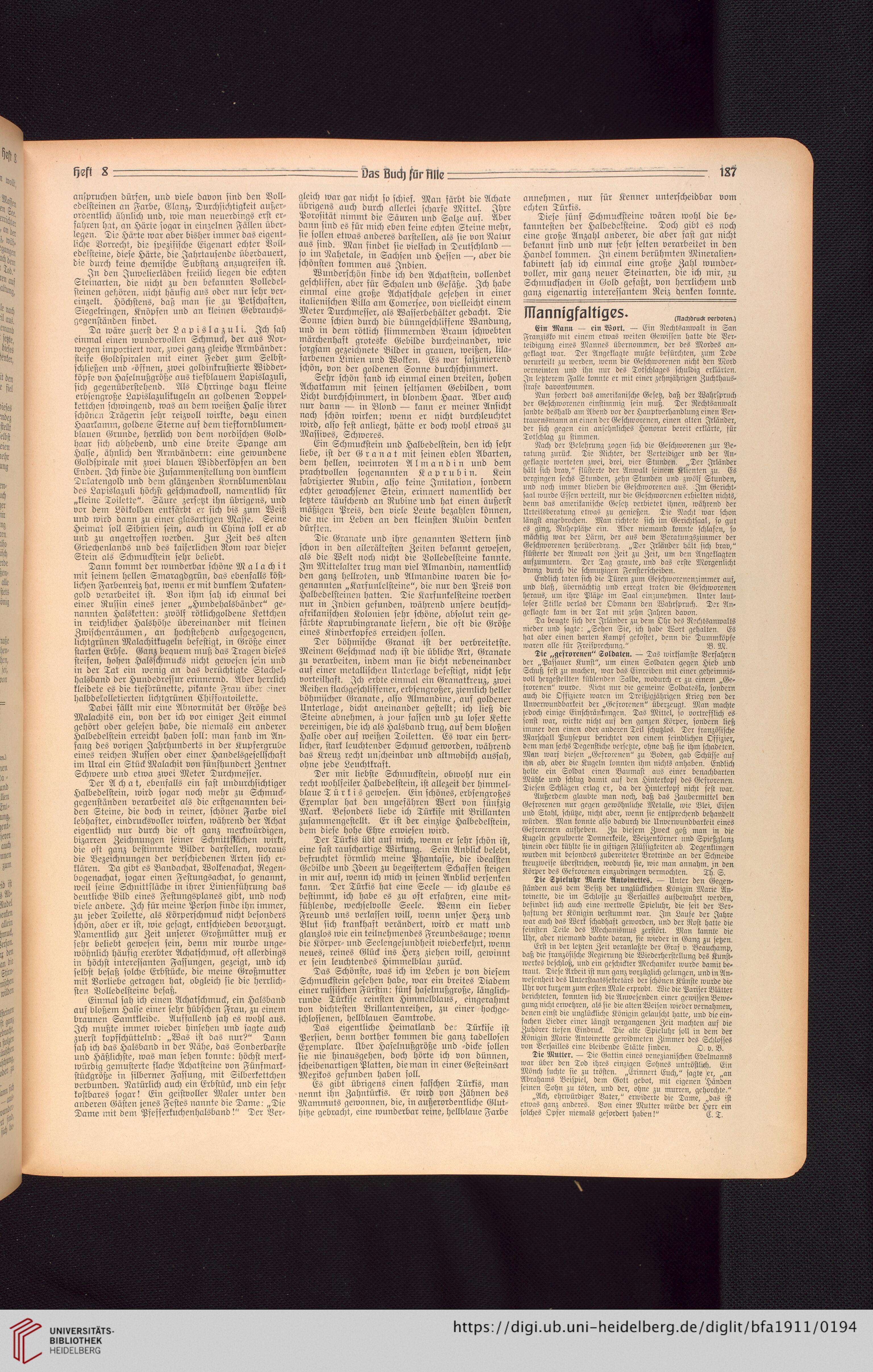187
Das Luch füi-LIIe
heft 8
gleich war gar nicht so schief. Man färbt die Achate
nbrigens auch durch allerlei scharfe Mittel. Ihre
Porosität nimmt die Säuren und Salze auf. Aber
dann sind es für mich eben keine echten Steine mehr,
sie sollen etwas anderes darstellen, als sie von Natur
aus sind. Man findet sie vielfach in Deutschland —
so im Nahetale, in Sachsen und Hessen —, aber die
schönsten kommen aus Indien.
Wunderschön finde ich den Achatstein, vollendet
geschliffen, aber für Schalen und Gefäße. Ich habe
einmal eine große Achatschale gesehen in einer
italienischen Villa am Comersee, von vielleicht einem
Meter Durchmesser, als Wasserbehälter gedacht. Die
Sonne schien durch die dünngeschliffene Wandung,
und in dem rötlich flimmernden Braun schwebten
märchenhaft groteske Gebilde durcheinander, wie
sorgsam gezeichnete Bilder in grauen, weißen, lila-
farbenen Linien und Wolken. Es war faszinierend
schön, von der goldenen Sonne durchschimmert.
Sehr schön fand ich einmal einen breiten, hohen
Achatkamm mit seinen seltsamen Gebilden, vom
Licht durchschimmert, in blondem Haar. Aber auch
nur dann — in Blond — kann er meiner Ansicht
nach schön wirken; wenn er nicht durchleuchtet
wird, also fest anliegt, hätte er doch wohl etwas zu
Massives, Schweres.
Ein Schmuckstein und Halbedelstein, den ich sehr
liebe, ist der Granat mit seinen edlen Abarten,
dem Hellen, weinroten Almandin und dem
Prachtvollen sogenannten Kaprubin. Kein
fabrizierter Rubin, also keine Imitation, sondern
echter gewachsener Stein, erinnert namentlich der
letztere täuschend an Rubine und hat einen äußerst
mäßigen Preis, den viele Leute bezahlen können,
die nie im Leben an den kleinsten Rubin denken
dürften.
Die Granate und ihre genannten Vettern sind
schon in den allerältesten Zeiten bekannt gewesen,
als die Welt noch nicht die Volledelsteine kannte.
Im Mittelalter trug man viel Almandin, namentlich
den ganz hellroten, und Almandine waren die so-
genannten „Karfunkelsteine", die nur den Preis von
Halbedelsteinen hatten. Die Karfunkelsteine werden
nur in Indien gefunden, während unsere deutsch-
afrikanischen Kolonien sehr schöne, absolut rein ge-
färbte Kaprubingranate liefern, die oft die Größe
eines Kinderkopfes erreichen sollen.
Der böhmische Granat ist der verbreitetste.
Meinem Geschmack nach ist die übliche Art, Granate
zu verarbeiten, indem man sie dicht nebeneinander
auf einer metallischen Unterlage befestigt, nicht sehr
vorteilhaft. Ich erbte einmal ein Granatkreuz, zwei
Reihen flachgeschliffener, erbsengroßer, ziemlich Heller
böhmischer Granate, also Almandine, auf goldener
Unterlage, dicht aneinander gestellt; ich ließ die
Steine abnehmen, ä sour fassen und zu loser Kette
vereinigen, die ich als Halsband trug, auf dem bloßen
Halse oder auf weißen Toiletten. Es war ein herr-
licher, stark leuchtender Schmuck geworden, während
das Kreuz recht unscheinbar und altmodisch aussah,
ohne jede Leuchtkraft.
Der mir liebste Schmuckstein, obwohl nur ein
recht wohlfeiler Halbedelstein, ist allezeit der himmel-
blaue Türkis gewesen. Ein schönes, erbsengroßes
Exemplar hat den ungefähren Wert von fünfzig
Mark. Besonders liebe ich Türkise mit Brillanten
zusammengestellt. Er ist der einzige Halbedelstein,
dem diese hohe Ehre erwiesen wird.
Der Türkis übt auf mich, wenn er sehr schön ist,
eine fast rauschartige Wirkung. Sein Anblick belebt,
befruchtet förmlich meine Phantasie, die idealsten
Gebilde und Ideen zu begeistertem Schaffen steigen
in mir auf, wenn ich mich in seinen Anblick versenken
kann. Der Türkis hat eine Seele — ich glaube es
bestimmt, ich habe es zu oft erfahren, eine mit-
fühlende, wechselvolle Seele. Wenn ein lieber
Freund uns verlassen will, wenn unser Herz und
Blut sich krankhaft verändert, wird er matt und
glanzlos wie ein teilnehmendes Freundesauge; wenn
die Körper- und Seelengesundheit wiederkehrt, wenn
neues, reines Glück ins Herz ziehen will, gewinnt
er sein leuchtendes Himmelblau zurück.
Das Schönste, was ich im Leben je von diesem
Schmuckstein gesehen habe, war ein breites Diadem
einer russischen Fürstin: fünf haselnußgroße, länglich-
runde Türkise reinsten Himmelblaus, eingerahmt
von dichtesten Brillantenreihen, zu einer hochge-
schlossenen, hellblauen Samtrobe.
Das eigentliche Heimatland dec Türkise ist
Persien, denn dorther kommen die ganz tadellosen
Exemplare. Über Haselnußgröße und -dicke sollen
sie nie hinausgehen, doch hörte ich von dünnen,
scheibenartigen Platten, die man in einer Gesteinsart
Mexikos gefunden haben soll.
Es gibt übrigens einen falschen Türkis, man
nennt ihn Zahntürkis. Er wird von Zähnen des
Mammuts gewonnen, die, in außerordentliche Glut-
hitze gebracht, eine wunderbar reine, hellblaue Farbe
anspruchen dürfen, und viele davon sind den Voll-
edelsteinen an Farbe, Glanz, Durchsichtigkeit außer-
ordentlich ähnlich und, wie man neuerdings erst er-
fahren hat, an Härte sogar in einzelnen Fällen über-
legen. Dis Härte war aber bisher immer das eigent-
liche Vorrecht, dis spezifische Eigenart echter Voll-
edelsteine, diese Härte, die Jahrtausende überdauert,
die durch keine chemische Substanz anzugreifen ist.
In den Juwelierläden freilich liegen die echten
Steinarten, die nicht zu den bekannten Volledel-
steinen gehören, nicht häufig aus oder nur sehr ver-
einzelt. Höchstens, daß man sie zu Petschaften,
Siegelringen, Knöpfen und an kleinen Gebrauchs-
gegenständen findet.
Da wäre zuerst der Lapislazuli. Ich sah
einmal einen wundervollen Schmuck, der aus Nor-
wegen importiert war, zwei ganz gleiche Armbänder:
steife Goldspiralen mit einer Feder zum Selbst-
schließen und -öffnen, zwei goldinkrustierte Widder-
köpfe von Haselnußgröße aus tiefblauem Lapislazuli,
sich gegenüberstehend. Als Ohrringe dazu kleine
erbsengroße Lapislazulikugeln an goldenen Doppel-
kettchen schwingend, was an dem weißen Halse ihrer
schönen Trägerin sehr reizvoll wirkte, dazu einen
Haarkamm, goldene Sterne auf dem tiefkornblumen-
blauen Grunde, herrlich von dem nordischen Gold-
haar sich abhebend, und eine breite Spange am
Halse, ähnlich den Armbändern: eine gewundene
Goldspirale mit zwei blauen Widderköpfen an den
Enden. Ich finde die Zusammenstellung von dunklem
Dukatengold und dem glänzenden Kornblumenblau
des Lapislazuli höchst geschmackvoll, namentlich für
„kleine Toilette". Saure zersetzt ihn übrigens, und
vor dem Lötkolben entfärbt er sich bis zum Weiß
und wird dann zu einer glasartigen Masse. Seine
Heimat soll Sibirien sein, auch in China soll er ab
und zu angetroffen werden. Zur Zeit des alten
Griechenlands und des kaiserlichen Rom war dieser
Stein als Schmuckstein sehr beliebt.
Dann kommt der wunderbar schöne Malachit
mit seinem Hellen Smaragdgrün, das ebenfalls köst-
lichen Farbenreiz hat, wenn er mit dunklem Dukaten-
gold verarbeitet ist. Von ihm sah ich einmal bei
einer Russin eines jener „Hundehalsbänder" ge-
nannten Halsketten: zwölf rötlichgoldene Kettchen
in reichlicher Halshöhe übereinander mit kleinen
Zwischenräumen, an hochstehend aufgezogenen,
lichtgrünen Malachitkugeln befestigt, in Größe einer
starken Erbse. Ganz bequem muß das Tragen dieses
steifen, hohen Halsschmucks nicht gewesen sein und
in der Tat ein wenig an das berüchtigte Stachel-
halsband der Hundedressur erinnernd. Aber herrlich
kleidete es die tiefbrünette, pikante Frau über einer
halbdekollctierten lichtgrünen Chiffontoilette.
Dabei fällt mir eine Abnormität der Größe des
Malachits ein, von der ich vor einiger Zeit einmal
gehört oder gelesen habe, die niemals ein anderer
Halbedelstein erreicht haben soll: man fand im An-
fang des vorigen Jahrhunderts in der Kupfergrube
eines reichen Russen oder einer Handelsgesellschaft
im Ural ein Stück Malachit von fünfhundert Zentner
Schwere und etwa zwei Meter Durchmesser.
Der Achat, ebenfalls ein fast undurchsichtiger
Halbedelstein, wird sogar noch mehr zu Schmuck-
gegenständen verarbeitet als die erstgenannten bei-
den Steine, die doch in reiner, schöner Farbe viel
lebhafter, eindrucksvoller wirken, während der Achat
eigentlich nur durch die oft ganz merkwürdigen,
bizarren Zeichnungen seiner SchnittMchen wirkt,
die oft ganz bestimmte Bilder darstellen, woraus
die Bezeichnungen der verschiedenen Arten sich er-
klären. Da gibt es Bandachat, Wolkenachat, Regen-
bogenachat, sogar einen Festungsachat, so genannt,
weil seine Schnittfläche in ihrer Linienführung das
deutliche Bild eines Festungsplanes gibt, und noch
viele andere. Ich für meine Person finde ihn immer,
zu jeder Toilette, als Körperschmuck nicht besonders
schön, aber er ist, wie gesagt, entschieden bevorzugt.
Namentlich zur Zeit unserer Großmütter muß er
sehr beliebt gewesen sein, denn mir wurde unge-
wöhnlich häufig ererbter Achatschmuck, oft allerdings
in höchst interessanten Fassungen, gezeigt, und ich
selbst besaß solche Erbstücke, die meine Großmutter
mit Vorliebe getragen hat, obgleich sie die herrlich-
sten Volledelsteine besaß.
Einmal sah ich einen Achatschmuck, ein Halsband
auf bloßem Halse einer sehr hübschen Frau, zu einem
braunen Samtkleide. Auffallend sah es wohl aus.
Ich mußte immer wieder Hinsehen und sagte auch
zuerst kopfschüttelnd: „Was ist das nur?" Dann
sah ich das Halsband in der Nähe, das Sonderbarste
und Häßlichste, was man sehen konnte: höchst merk-
würdig gemusterte flache Achatsteine von Fünfmark-
stückgröße in silberner Fassung, mit Silberkettchen
verbunden. Natürlich auch ein Erbstück, und ein sehr
kostbares sogar! Ein geistvoller Maler unter den
anderen Gästen jenes Festes nannte die Dame: „Die
Dame mit dem Pfefferkuchenhalsband!" Der Ver-
annehmen, nur für Kenner unterscheidbar vom
echten Türkis.
Diese fünf Schmucksteine wären wohl die be-
kanntesten der Halbedelsteine. Doch gibt es noch
eine große Anzahl anderer, die aber fast gar nicht
bekannt sind und nur sehr selten verarbeitet in den
Handel kommen. In einem berühmten Mineralien-
kabinett sah ich einmal eine große Zahl wunder-
voller, mir ganz neuer Steinarten, die ich mir, zu
Schmucksachen in Gold gefaßt, von herrlichem und
ganz eigenartig interessantem Reiz denken konnte.
wachd uck o-rbM-n.)
Ein Man» — ein Wort. — Ein Rechtsanwalt in San
Franzisko mit einem etwas weiten Gewissen hatte die Ver-
teidigung eines Mannes übernommen, der des Mordes an-
geklagt war. Der Angeklagte mußte befürchten, zum Tode
verurteilt zu werden, wenn die Geschworenen nicht den Mord
verneinten und ihn nur des Totschlages schuldig erklärten.
In letzterem Falle konnte er mit einer zehnjährigen Zuchthaus-
strafe davonkommen.
Nun fordert das amerikanische Gesetz, daß der Wahrspruch
der Geschworenen einstimmig sein muß. Der Rechtsanwalt
sandte deshalb am Abend vor der Hauptverhandlung einen Ver-
trauensmann an einen der Geschworenen, einen alten Irländer,
der sich gegen ein ansehnliches Honorar bereit erklärte, für
Totschlag zu stimmen.
Nach der Belehrung zogen sich die Geschworenen zur Be-
ratung zurück. Die Richter, der Verteidiger und der An-
geklagte warteten zwei, drei, vier Stunden. „Der Irländer
hält sich brav," flüsterte der Anwalt seinem Klienten zu. Es
vergingen sechs Stunden, zehn Stunden und zwölf Stunden,
und noch immer blieben die Geschworenen aus. Im Gericht-
saal wurde Essen verteilt, nur die Geschworenen erhielten nichts,
denn das amerikanische Gesetz verbietet ihnen, während der
Urteilsberatung etwas zu genießen. Tie Nacht war schon
längst angebrochen. Man richtete sich im Gerichtsaal, so gut
es ging, Ruheplätze ein. Aber niemand konnte schlafen, so
mächtig war der Lärm, der aus dem Beratungszimmer der
Geschworenen herüberdrang. „Der Irländer hält sich brav,"
flüsterte der Anwalt von Zeit zu Zeit, um den Angeklagten
aufzumuntern. Der Tag graute, und das erste Morgenlicht
drang durch die schmutzigen Fensterscheiben.
Endlich taten sich die Türen zum Geschworenenzimmer auf,
und blaß, übernächtig und erregt traten die Geschworenen
heraus, um ihre Plätze im Saal einzunehmen. Unter laut-
loser Stille verlas der Obmann den Wahrspruch. Der An-
geklagte kam in der Tat mit zehn Jahren davon.
Da beugte sich der Irländer zu dem Ohr des Rechtsanwalts
nieder und sagte: „Sehen Sie, ich habe Wort gehalten. Es
hat aber einen harten Kampf gekostet, denn die Dummköpfe
waren alle für Freisprechung." B. M.
Die „gefrorenen" Soldaten. — Das wirksamste Verfahren
der „Passauer Kunst", um einen Soldaten gegen Hieb und
Schuß fest zu machen, war das Einrciben mit einer geheimnis-
voll hergestellten küblenden Salbe, wodurch er zu einem „Ge-
frorenen" wurde. Nicht nur sie gemeine Soldateska, sondern
auch die Offiziere waren im Dreißigjährigen Krieg von der
Unverwundbarkeit der „Gefrorenen" überzeugt. Man machte
jedoch einige Einschränkungen. Das Mittel, so vortrefflich es
sonst war, wirkte nicht auf den ganzen Körper, sondern ließ
immer den einen oder anderen Teil schutzlos. Der französische
Marschall Puysepur berichtet von einem feindlichen Offizier,
dem man sechs Degenstiche versetzte, ohne daß sie ihm schadeten.
Man warf diesen „Gefrorenen" zu Boden, gab Schüsse auf
ihn ab, aber die Kugeln konnten ihm nichts anhaben. Endlich
holte ein Soldat einen Baumast aus einer benachbarten
Mühle und schlug damit auf den Hinterkopf des Gefrorenen.
Diesen Schlägen erlag er, da der Hinterkops nicht fest war.
Außerdem glaubte man noch, daß das Zaubermittel den
Gefrorenen nur gegen gewöhnliche Metalle, wie Blei, Eisen
und Stahl, schütze, nicht aber, wenn sie entsprechend behandelt
würden. Man konnte also dadurch die Unverwundbarkeit eines
Gefrorenen aufheben. Zu diesem Zweck goß man in die
Kugeln gepulverte Donnerkeile, Weizenkörner und Spießglanz
hinein oder kühlte sie in giftigen Flüssigkeiten ab Degenklingen
wurden mit besonders zubereiteter Brotrinde an der Schneide
kreuzweise überstrichen, wodurch sie, wie man annahm, .in den
Körper des Gefrorenen einzudringen vermochten. Th. S.
Die Spieluhr Marie Antoinettes. — Unter den Gegen-
ständen aus dem Besitz der unglücklichen Königin Marie An-
toinette, die im Schlosse zu Versailles ausbewahrt werden,
befindet sich auch eine wertvolle Spieluhr, die seit der Ver-
haftung der Königin verstummt war. Im Laufe der Jahre
war auch das Werk schadhaft geworden, und der Rost hatte die
feinsten Teile des Mechanismus zerstört. Man kannte die
Uhr, aber niemand dachte daran, sie wieder in Gang zu setzen.
Erst in der letzten Zeit veranlaßte der Graf v. Beauchamp,
daß die französische Regierung die Wiederherstellung des Kunst-
werkes beschloß, und ein geschickter Mechaniker wurde damit be-
traut. Diese Arbeit ist nun ganz vorzüglich gelungen, und in An-
wesenheit des Unterstaatssekretärs der schönen Künste wurde die
Uhr vor kurzem zum ersten Male erprobt. Wie die Pariser Blätter
berichteten, konnten sich die Anwesenden einer gewissen Bewe-
gung nicht erwehren, als sie die alten Weisen wieder vernahmen,
denen einst die unglückliche Königin gelauscht hatte, und die ein-
fachen Lieder einer längst vergangenen Zeit machten auf die
Zuhörer tiefen Eindruck. Die alte Spieluhr soll in dem der
Königin Marie Antoinette gewidmeten Zimmer des Schlosses
von Versailles eine bleibende Stätte finden. O. v. B.
Die Mutter. — Die Gattin eines venezianischen Edelmanns
war über den Tod ihres einzigen Sobnes untröstlich. Ein
Mönch suchte sie zu trösten. „Erinnert Euch," sagte er, „an
Abrahams Beispiel, dem Gott gebot, mit eigenen Händen
fernen Sohn zu töten, und der, ohne zu murren, gehorchte."
„Ach, ehrwürdiger Vater," erwiderte die Dame, „das ist
etwas ganz anderes. Von einer Mutter würde der Herr ein
solches Opfer niemals gefordert haben!" C. T.
Das Luch füi-LIIe
heft 8
gleich war gar nicht so schief. Man färbt die Achate
nbrigens auch durch allerlei scharfe Mittel. Ihre
Porosität nimmt die Säuren und Salze auf. Aber
dann sind es für mich eben keine echten Steine mehr,
sie sollen etwas anderes darstellen, als sie von Natur
aus sind. Man findet sie vielfach in Deutschland —
so im Nahetale, in Sachsen und Hessen —, aber die
schönsten kommen aus Indien.
Wunderschön finde ich den Achatstein, vollendet
geschliffen, aber für Schalen und Gefäße. Ich habe
einmal eine große Achatschale gesehen in einer
italienischen Villa am Comersee, von vielleicht einem
Meter Durchmesser, als Wasserbehälter gedacht. Die
Sonne schien durch die dünngeschliffene Wandung,
und in dem rötlich flimmernden Braun schwebten
märchenhaft groteske Gebilde durcheinander, wie
sorgsam gezeichnete Bilder in grauen, weißen, lila-
farbenen Linien und Wolken. Es war faszinierend
schön, von der goldenen Sonne durchschimmert.
Sehr schön fand ich einmal einen breiten, hohen
Achatkamm mit seinen seltsamen Gebilden, vom
Licht durchschimmert, in blondem Haar. Aber auch
nur dann — in Blond — kann er meiner Ansicht
nach schön wirken; wenn er nicht durchleuchtet
wird, also fest anliegt, hätte er doch wohl etwas zu
Massives, Schweres.
Ein Schmuckstein und Halbedelstein, den ich sehr
liebe, ist der Granat mit seinen edlen Abarten,
dem Hellen, weinroten Almandin und dem
Prachtvollen sogenannten Kaprubin. Kein
fabrizierter Rubin, also keine Imitation, sondern
echter gewachsener Stein, erinnert namentlich der
letztere täuschend an Rubine und hat einen äußerst
mäßigen Preis, den viele Leute bezahlen können,
die nie im Leben an den kleinsten Rubin denken
dürften.
Die Granate und ihre genannten Vettern sind
schon in den allerältesten Zeiten bekannt gewesen,
als die Welt noch nicht die Volledelsteine kannte.
Im Mittelalter trug man viel Almandin, namentlich
den ganz hellroten, und Almandine waren die so-
genannten „Karfunkelsteine", die nur den Preis von
Halbedelsteinen hatten. Die Karfunkelsteine werden
nur in Indien gefunden, während unsere deutsch-
afrikanischen Kolonien sehr schöne, absolut rein ge-
färbte Kaprubingranate liefern, die oft die Größe
eines Kinderkopfes erreichen sollen.
Der böhmische Granat ist der verbreitetste.
Meinem Geschmack nach ist die übliche Art, Granate
zu verarbeiten, indem man sie dicht nebeneinander
auf einer metallischen Unterlage befestigt, nicht sehr
vorteilhaft. Ich erbte einmal ein Granatkreuz, zwei
Reihen flachgeschliffener, erbsengroßer, ziemlich Heller
böhmischer Granate, also Almandine, auf goldener
Unterlage, dicht aneinander gestellt; ich ließ die
Steine abnehmen, ä sour fassen und zu loser Kette
vereinigen, die ich als Halsband trug, auf dem bloßen
Halse oder auf weißen Toiletten. Es war ein herr-
licher, stark leuchtender Schmuck geworden, während
das Kreuz recht unscheinbar und altmodisch aussah,
ohne jede Leuchtkraft.
Der mir liebste Schmuckstein, obwohl nur ein
recht wohlfeiler Halbedelstein, ist allezeit der himmel-
blaue Türkis gewesen. Ein schönes, erbsengroßes
Exemplar hat den ungefähren Wert von fünfzig
Mark. Besonders liebe ich Türkise mit Brillanten
zusammengestellt. Er ist der einzige Halbedelstein,
dem diese hohe Ehre erwiesen wird.
Der Türkis übt auf mich, wenn er sehr schön ist,
eine fast rauschartige Wirkung. Sein Anblick belebt,
befruchtet förmlich meine Phantasie, die idealsten
Gebilde und Ideen zu begeistertem Schaffen steigen
in mir auf, wenn ich mich in seinen Anblick versenken
kann. Der Türkis hat eine Seele — ich glaube es
bestimmt, ich habe es zu oft erfahren, eine mit-
fühlende, wechselvolle Seele. Wenn ein lieber
Freund uns verlassen will, wenn unser Herz und
Blut sich krankhaft verändert, wird er matt und
glanzlos wie ein teilnehmendes Freundesauge; wenn
die Körper- und Seelengesundheit wiederkehrt, wenn
neues, reines Glück ins Herz ziehen will, gewinnt
er sein leuchtendes Himmelblau zurück.
Das Schönste, was ich im Leben je von diesem
Schmuckstein gesehen habe, war ein breites Diadem
einer russischen Fürstin: fünf haselnußgroße, länglich-
runde Türkise reinsten Himmelblaus, eingerahmt
von dichtesten Brillantenreihen, zu einer hochge-
schlossenen, hellblauen Samtrobe.
Das eigentliche Heimatland dec Türkise ist
Persien, denn dorther kommen die ganz tadellosen
Exemplare. Über Haselnußgröße und -dicke sollen
sie nie hinausgehen, doch hörte ich von dünnen,
scheibenartigen Platten, die man in einer Gesteinsart
Mexikos gefunden haben soll.
Es gibt übrigens einen falschen Türkis, man
nennt ihn Zahntürkis. Er wird von Zähnen des
Mammuts gewonnen, die, in außerordentliche Glut-
hitze gebracht, eine wunderbar reine, hellblaue Farbe
anspruchen dürfen, und viele davon sind den Voll-
edelsteinen an Farbe, Glanz, Durchsichtigkeit außer-
ordentlich ähnlich und, wie man neuerdings erst er-
fahren hat, an Härte sogar in einzelnen Fällen über-
legen. Dis Härte war aber bisher immer das eigent-
liche Vorrecht, dis spezifische Eigenart echter Voll-
edelsteine, diese Härte, die Jahrtausende überdauert,
die durch keine chemische Substanz anzugreifen ist.
In den Juwelierläden freilich liegen die echten
Steinarten, die nicht zu den bekannten Volledel-
steinen gehören, nicht häufig aus oder nur sehr ver-
einzelt. Höchstens, daß man sie zu Petschaften,
Siegelringen, Knöpfen und an kleinen Gebrauchs-
gegenständen findet.
Da wäre zuerst der Lapislazuli. Ich sah
einmal einen wundervollen Schmuck, der aus Nor-
wegen importiert war, zwei ganz gleiche Armbänder:
steife Goldspiralen mit einer Feder zum Selbst-
schließen und -öffnen, zwei goldinkrustierte Widder-
köpfe von Haselnußgröße aus tiefblauem Lapislazuli,
sich gegenüberstehend. Als Ohrringe dazu kleine
erbsengroße Lapislazulikugeln an goldenen Doppel-
kettchen schwingend, was an dem weißen Halse ihrer
schönen Trägerin sehr reizvoll wirkte, dazu einen
Haarkamm, goldene Sterne auf dem tiefkornblumen-
blauen Grunde, herrlich von dem nordischen Gold-
haar sich abhebend, und eine breite Spange am
Halse, ähnlich den Armbändern: eine gewundene
Goldspirale mit zwei blauen Widderköpfen an den
Enden. Ich finde die Zusammenstellung von dunklem
Dukatengold und dem glänzenden Kornblumenblau
des Lapislazuli höchst geschmackvoll, namentlich für
„kleine Toilette". Saure zersetzt ihn übrigens, und
vor dem Lötkolben entfärbt er sich bis zum Weiß
und wird dann zu einer glasartigen Masse. Seine
Heimat soll Sibirien sein, auch in China soll er ab
und zu angetroffen werden. Zur Zeit des alten
Griechenlands und des kaiserlichen Rom war dieser
Stein als Schmuckstein sehr beliebt.
Dann kommt der wunderbar schöne Malachit
mit seinem Hellen Smaragdgrün, das ebenfalls köst-
lichen Farbenreiz hat, wenn er mit dunklem Dukaten-
gold verarbeitet ist. Von ihm sah ich einmal bei
einer Russin eines jener „Hundehalsbänder" ge-
nannten Halsketten: zwölf rötlichgoldene Kettchen
in reichlicher Halshöhe übereinander mit kleinen
Zwischenräumen, an hochstehend aufgezogenen,
lichtgrünen Malachitkugeln befestigt, in Größe einer
starken Erbse. Ganz bequem muß das Tragen dieses
steifen, hohen Halsschmucks nicht gewesen sein und
in der Tat ein wenig an das berüchtigte Stachel-
halsband der Hundedressur erinnernd. Aber herrlich
kleidete es die tiefbrünette, pikante Frau über einer
halbdekollctierten lichtgrünen Chiffontoilette.
Dabei fällt mir eine Abnormität der Größe des
Malachits ein, von der ich vor einiger Zeit einmal
gehört oder gelesen habe, die niemals ein anderer
Halbedelstein erreicht haben soll: man fand im An-
fang des vorigen Jahrhunderts in der Kupfergrube
eines reichen Russen oder einer Handelsgesellschaft
im Ural ein Stück Malachit von fünfhundert Zentner
Schwere und etwa zwei Meter Durchmesser.
Der Achat, ebenfalls ein fast undurchsichtiger
Halbedelstein, wird sogar noch mehr zu Schmuck-
gegenständen verarbeitet als die erstgenannten bei-
den Steine, die doch in reiner, schöner Farbe viel
lebhafter, eindrucksvoller wirken, während der Achat
eigentlich nur durch die oft ganz merkwürdigen,
bizarren Zeichnungen seiner SchnittMchen wirkt,
die oft ganz bestimmte Bilder darstellen, woraus
die Bezeichnungen der verschiedenen Arten sich er-
klären. Da gibt es Bandachat, Wolkenachat, Regen-
bogenachat, sogar einen Festungsachat, so genannt,
weil seine Schnittfläche in ihrer Linienführung das
deutliche Bild eines Festungsplanes gibt, und noch
viele andere. Ich für meine Person finde ihn immer,
zu jeder Toilette, als Körperschmuck nicht besonders
schön, aber er ist, wie gesagt, entschieden bevorzugt.
Namentlich zur Zeit unserer Großmütter muß er
sehr beliebt gewesen sein, denn mir wurde unge-
wöhnlich häufig ererbter Achatschmuck, oft allerdings
in höchst interessanten Fassungen, gezeigt, und ich
selbst besaß solche Erbstücke, die meine Großmutter
mit Vorliebe getragen hat, obgleich sie die herrlich-
sten Volledelsteine besaß.
Einmal sah ich einen Achatschmuck, ein Halsband
auf bloßem Halse einer sehr hübschen Frau, zu einem
braunen Samtkleide. Auffallend sah es wohl aus.
Ich mußte immer wieder Hinsehen und sagte auch
zuerst kopfschüttelnd: „Was ist das nur?" Dann
sah ich das Halsband in der Nähe, das Sonderbarste
und Häßlichste, was man sehen konnte: höchst merk-
würdig gemusterte flache Achatsteine von Fünfmark-
stückgröße in silberner Fassung, mit Silberkettchen
verbunden. Natürlich auch ein Erbstück, und ein sehr
kostbares sogar! Ein geistvoller Maler unter den
anderen Gästen jenes Festes nannte die Dame: „Die
Dame mit dem Pfefferkuchenhalsband!" Der Ver-
annehmen, nur für Kenner unterscheidbar vom
echten Türkis.
Diese fünf Schmucksteine wären wohl die be-
kanntesten der Halbedelsteine. Doch gibt es noch
eine große Anzahl anderer, die aber fast gar nicht
bekannt sind und nur sehr selten verarbeitet in den
Handel kommen. In einem berühmten Mineralien-
kabinett sah ich einmal eine große Zahl wunder-
voller, mir ganz neuer Steinarten, die ich mir, zu
Schmucksachen in Gold gefaßt, von herrlichem und
ganz eigenartig interessantem Reiz denken konnte.
wachd uck o-rbM-n.)
Ein Man» — ein Wort. — Ein Rechtsanwalt in San
Franzisko mit einem etwas weiten Gewissen hatte die Ver-
teidigung eines Mannes übernommen, der des Mordes an-
geklagt war. Der Angeklagte mußte befürchten, zum Tode
verurteilt zu werden, wenn die Geschworenen nicht den Mord
verneinten und ihn nur des Totschlages schuldig erklärten.
In letzterem Falle konnte er mit einer zehnjährigen Zuchthaus-
strafe davonkommen.
Nun fordert das amerikanische Gesetz, daß der Wahrspruch
der Geschworenen einstimmig sein muß. Der Rechtsanwalt
sandte deshalb am Abend vor der Hauptverhandlung einen Ver-
trauensmann an einen der Geschworenen, einen alten Irländer,
der sich gegen ein ansehnliches Honorar bereit erklärte, für
Totschlag zu stimmen.
Nach der Belehrung zogen sich die Geschworenen zur Be-
ratung zurück. Die Richter, der Verteidiger und der An-
geklagte warteten zwei, drei, vier Stunden. „Der Irländer
hält sich brav," flüsterte der Anwalt seinem Klienten zu. Es
vergingen sechs Stunden, zehn Stunden und zwölf Stunden,
und noch immer blieben die Geschworenen aus. Im Gericht-
saal wurde Essen verteilt, nur die Geschworenen erhielten nichts,
denn das amerikanische Gesetz verbietet ihnen, während der
Urteilsberatung etwas zu genießen. Tie Nacht war schon
längst angebrochen. Man richtete sich im Gerichtsaal, so gut
es ging, Ruheplätze ein. Aber niemand konnte schlafen, so
mächtig war der Lärm, der aus dem Beratungszimmer der
Geschworenen herüberdrang. „Der Irländer hält sich brav,"
flüsterte der Anwalt von Zeit zu Zeit, um den Angeklagten
aufzumuntern. Der Tag graute, und das erste Morgenlicht
drang durch die schmutzigen Fensterscheiben.
Endlich taten sich die Türen zum Geschworenenzimmer auf,
und blaß, übernächtig und erregt traten die Geschworenen
heraus, um ihre Plätze im Saal einzunehmen. Unter laut-
loser Stille verlas der Obmann den Wahrspruch. Der An-
geklagte kam in der Tat mit zehn Jahren davon.
Da beugte sich der Irländer zu dem Ohr des Rechtsanwalts
nieder und sagte: „Sehen Sie, ich habe Wort gehalten. Es
hat aber einen harten Kampf gekostet, denn die Dummköpfe
waren alle für Freisprechung." B. M.
Die „gefrorenen" Soldaten. — Das wirksamste Verfahren
der „Passauer Kunst", um einen Soldaten gegen Hieb und
Schuß fest zu machen, war das Einrciben mit einer geheimnis-
voll hergestellten küblenden Salbe, wodurch er zu einem „Ge-
frorenen" wurde. Nicht nur sie gemeine Soldateska, sondern
auch die Offiziere waren im Dreißigjährigen Krieg von der
Unverwundbarkeit der „Gefrorenen" überzeugt. Man machte
jedoch einige Einschränkungen. Das Mittel, so vortrefflich es
sonst war, wirkte nicht auf den ganzen Körper, sondern ließ
immer den einen oder anderen Teil schutzlos. Der französische
Marschall Puysepur berichtet von einem feindlichen Offizier,
dem man sechs Degenstiche versetzte, ohne daß sie ihm schadeten.
Man warf diesen „Gefrorenen" zu Boden, gab Schüsse auf
ihn ab, aber die Kugeln konnten ihm nichts anhaben. Endlich
holte ein Soldat einen Baumast aus einer benachbarten
Mühle und schlug damit auf den Hinterkopf des Gefrorenen.
Diesen Schlägen erlag er, da der Hinterkops nicht fest war.
Außerdem glaubte man noch, daß das Zaubermittel den
Gefrorenen nur gegen gewöhnliche Metalle, wie Blei, Eisen
und Stahl, schütze, nicht aber, wenn sie entsprechend behandelt
würden. Man konnte also dadurch die Unverwundbarkeit eines
Gefrorenen aufheben. Zu diesem Zweck goß man in die
Kugeln gepulverte Donnerkeile, Weizenkörner und Spießglanz
hinein oder kühlte sie in giftigen Flüssigkeiten ab Degenklingen
wurden mit besonders zubereiteter Brotrinde an der Schneide
kreuzweise überstrichen, wodurch sie, wie man annahm, .in den
Körper des Gefrorenen einzudringen vermochten. Th. S.
Die Spieluhr Marie Antoinettes. — Unter den Gegen-
ständen aus dem Besitz der unglücklichen Königin Marie An-
toinette, die im Schlosse zu Versailles ausbewahrt werden,
befindet sich auch eine wertvolle Spieluhr, die seit der Ver-
haftung der Königin verstummt war. Im Laufe der Jahre
war auch das Werk schadhaft geworden, und der Rost hatte die
feinsten Teile des Mechanismus zerstört. Man kannte die
Uhr, aber niemand dachte daran, sie wieder in Gang zu setzen.
Erst in der letzten Zeit veranlaßte der Graf v. Beauchamp,
daß die französische Regierung die Wiederherstellung des Kunst-
werkes beschloß, und ein geschickter Mechaniker wurde damit be-
traut. Diese Arbeit ist nun ganz vorzüglich gelungen, und in An-
wesenheit des Unterstaatssekretärs der schönen Künste wurde die
Uhr vor kurzem zum ersten Male erprobt. Wie die Pariser Blätter
berichteten, konnten sich die Anwesenden einer gewissen Bewe-
gung nicht erwehren, als sie die alten Weisen wieder vernahmen,
denen einst die unglückliche Königin gelauscht hatte, und die ein-
fachen Lieder einer längst vergangenen Zeit machten auf die
Zuhörer tiefen Eindruck. Die alte Spieluhr soll in dem der
Königin Marie Antoinette gewidmeten Zimmer des Schlosses
von Versailles eine bleibende Stätte finden. O. v. B.
Die Mutter. — Die Gattin eines venezianischen Edelmanns
war über den Tod ihres einzigen Sobnes untröstlich. Ein
Mönch suchte sie zu trösten. „Erinnert Euch," sagte er, „an
Abrahams Beispiel, dem Gott gebot, mit eigenen Händen
fernen Sohn zu töten, und der, ohne zu murren, gehorchte."
„Ach, ehrwürdiger Vater," erwiderte die Dame, „das ist
etwas ganz anderes. Von einer Mutter würde der Herr ein
solches Opfer niemals gefordert haben!" C. T.