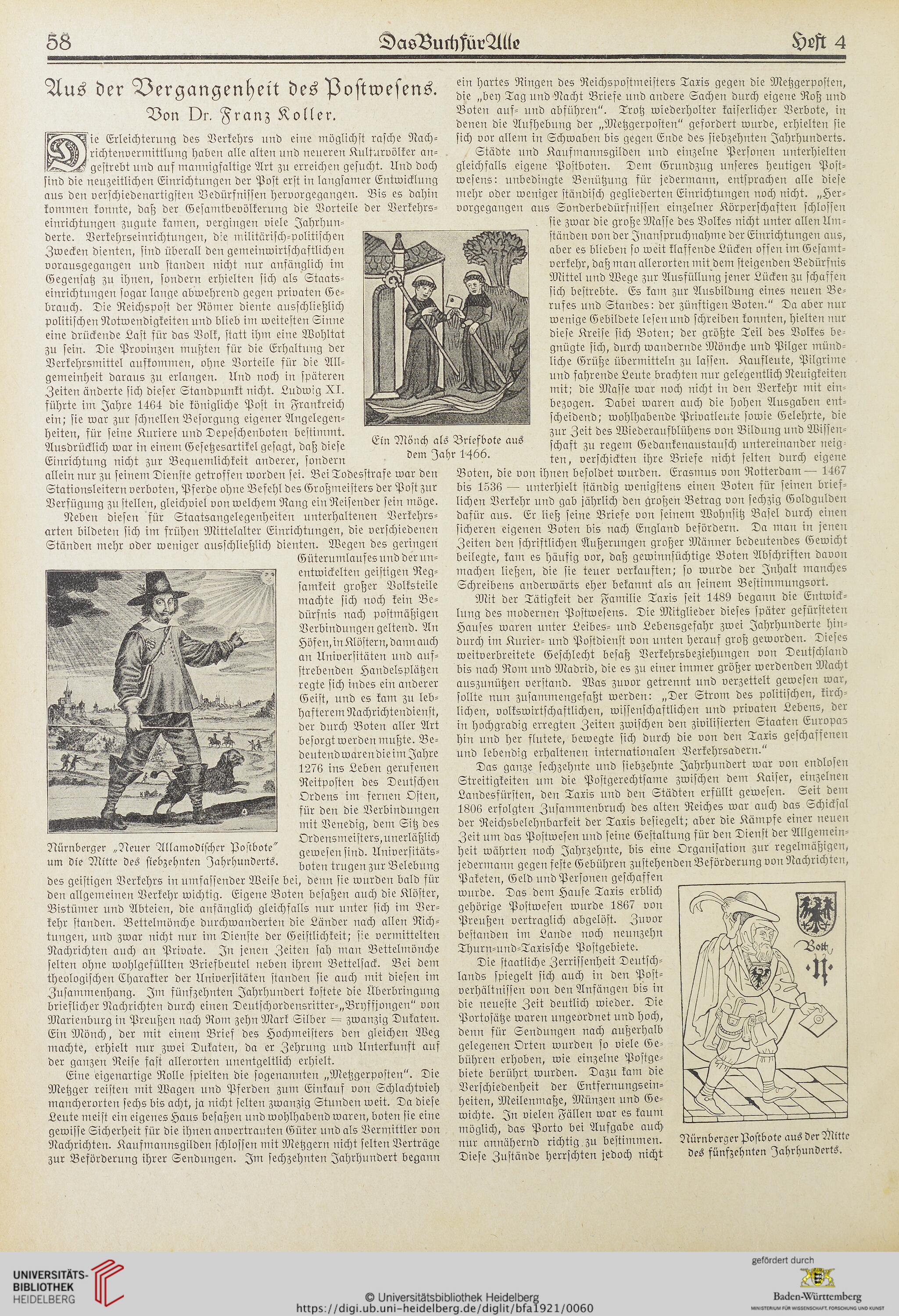S8
ÄasBuchfürAlle
Heft -1
Aus der Vergangenheit des Postwesens.
Von Or. Franz Koller.
Erleichterung des Verkehrs und eine möglichst rasche Nach-
1 richtenvermittlung haben alle alten und neueren Kulturvölker an-
gestrebt und auf mannigfaltige Art zu erreichen gesucht. Und doch
and die neuzeitlichen Einrichtungen der Post erst in langsamer Entwicklung
aus den verschiedenartigsten Bedürfnissen hervorgegangen. Bis es dahin
kommen konnte, daß der Gesamtbevölkerung die Vorteile der Verkehrs-
ein hartes Ringen des Reichspostmeisters Taris gegen die Mehgerposten,
die „bey Tag und Nacht Briefe und andere Sachen durch eigene Roß und
Boten auf- und abführen". Trotz wiederholter kaiserlicher Verbote, in
denen die Aufhebung der „Metzgerposten" gefordert wurde, erhielten sie
sich vor allem in Schwaben bis gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts.
Städte und Kaufmannsgilden und einzelne Personen unterhielten
gleichfalls eigene Postboten. Dem Grundzug unseres heutigen Post-
wesens: unbedingte Benützung für jedermann, entsprachen alle diese
mehr oder weniger ständisch gegliederten Einrichtungen noch nicht. „Her-
vorgegangen aus Sonderbedürfnissen einzelner Körperschaften schlossen
einrichtungen zugute kamen, vergingen viele Jahrhun-
derte. Verkehrseinrichtungen, die militärisch-politischen
Zwecken dienten, sind überall den gemeinwirtschaftlichen
vorausgegangen und standen nicht nur anfänglich im
Gegensatz zu ihnen, sondern erhielten sich als Staats-
einrichtungen sogar lange abwehrend gegen privaten Ge-
brauch. Die Reichspost der Römer diente ausschließlich
politischen Notwendigkeiten und blieb im weitesten Sinne
eine drückende Last für das Volk, statt ihm eine Wohltat
zu sein. Die Provinzen mußten für die Erhaltung der
Verkehrsmittel aufkommen, ohne Vorteile für die All-
gemeinheit daraus zu erlangen. Und noch in späteren
Zeiten änderte sich dieser Standpunkt nicht. Ludwig XI.
führte im Jahre 1464 die königliche Post in Frankreich
ein; sie war zur schnellen Besorgung eigener Angelegen-
heiten, für seine Kuriere und Depeschenboten bestimmt.
Ausdrücklich war in einem Gesetzesartikel gesagt, daß diese
Einrichtung nicht zur Bequemlichkeit anderer, sondern
Ein Mönch als Briefbote aus
dem Jahr 1466.
sie zwar die große Masse des Volkes nicht unter allen Um-
ständen von der Inanspruchnahme der Einrichtungen aus,
aber es blieben so weit klaffende Lücken offen im Gesamt-
verkehr, daß man allerorten mit dem steigenden Bedürfnis
Mittel und Wege zur Ausfüllung jener Lücken zu schaffen
sich bestrebte. Es kam zur Ausbildung eines neuen Be-
rufes und Standes: der zünftigen Boten." Da aber nur
wenige Gebildete lesen und schreiben konnten, hielten nur
diese Kreise sich Boten; der größte Teil des Volkes be-
gnügte sich, durch wandernde Mönche und Pilger münd-
liche Grüße übermitteln zu lassen. Kaufleute, Pilgrime
und fahrende Leute brachten nur gelegentlich Neuigkeiten
mit; die Masse war noch nicht in den Verkehr mit ein-
bezogen. Dabei waren auch die hohen Ausgaben ent-
scheidend; wohlhabende Privatleute sowie Gelehrte, die
zur Zeit des Wiederaufblühens von Bildung und Wissen-
schaft zu regem Gedankenaustausch untereinander neig-
ten, verschickten ihre Briefe nicht selten durch eigene
allein nur zu seinem Dienste getroffen worden sei. Bei Todesstrafe war den
Stationsleiternverboten, Pferde ohne Befehl des Großmeisters der Post zur
Verfügung zu stellen, gleichviel von welchem Rang ein Reisender sein möge.
Neben diesen für Staatsangelegenheiten unterhaltenen Verkehrs-
arten bildeten sich im frühen Mittelalter Einrichtungen, die verschiedenen
Ständen mehr oder weniger ausschließlich dienten. Wegen des geringen
Nürnberger „Neuer Allamodischcr Postbote"
um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts.
Güterumlaufes und der un-
entwickelten geistigen Reg-
samkeit großer Volksteile
machte sich noch kein Be-
dürfnis nach postmäßigen
Verbindungen geltend. An
Höfen, in Klöstern, dann auch
an Universitäten und auf-
strebenden Handelsplätzen
regte sich indes ein anderer
Geist, und es kam zu leb-
hafterem Nachrichtendienst,
der durch Boten aller Art
besorgt werden mußte. Be-
deutendwarendieim Jahre
1276 ins Leben gerufenen
Reitposten des Deutschen
Ordens im fernen Osten,
für den die Verbindungen
mit Venedig, dem Sitz des
Ordensmeisters,unerläßlich
gewesen sind. Universitäts-
boten trugen zur Belebung
des geistigen Verkehrs in umfassender Weise bei, denn sie wurden bald für
den allgemeinen Verkehr wichtig. Eigene Boten besaßen auch die Klöster,
Bistümer und Abteien, die anfänglich gleichfalls nur unter sich im Ver-
kehr standen. Bettelmönche durchwanderten die Länder nach allen Rich-
tungen, und zwar nicht nur im Dienste der Geistlichkeit; sie vermittelten
Nachrichten auch an Private. In jenen Zeiten sah man Bettelmönche
selten ohne wohlgefüllten Briefbeutel neben ihrem Bettelsack. Bei dem
theologischen Charakter der Universitäten standen sie auch mit diesen im
Zusammenhang. Im fünfzehnten Jahrhundert kostete die Überbringung
brieflicher Nachrichten durch einen Deutschordensritter-„Bryffjongen" von
Marienburg in Preußen nach Rom zehn Mark Silber — zwanzig Dukaten.
Ein Mönch, der mit einem Brief des Hochmeisters den gleichen Weg
machte, erhielt nur zwei Dukaten, da er Zehrung und Unterkunft auf
der ganzen Reise fast allerorten unentgeltlich erhielt.
Eine eigenartige Rolle spielten die sogenannten „Mehgerposten". Die
Metzger reisten mit Wagen und Pferden zum Einkauf von Schlachtvieh
mancherorten sechs bis acht, ja nicht selten zwanzig Stunden weit. Da diese
Leute meist ein eigenes Haus besaßen und wohlhabend waren, boten sie eine
gewisse Sicherheit für die ihnen anvertrauten Güter und als Vermittler von
Nachrichten. Kaufmannsgilden schlossen mit Metzgern nicht selten Verträge
zur Beförderung ihrer Sendungen. Im sechzehnten Jahrhundert begann
Boten, die von ihnen besoldet wurden. Erasmus von Rotterdam—- 1467
bis 1536 — unterhielt ständig wenigstens einen Boten für seinen brief-
lichen Verkehr und gab jährlich den großen Betrag von sechzig Goldgulden
dafür aus. Er ließ seine Briefe von seinem Wohnsitz Basel durch einen
sicheren eigenen Boten bis nach England befördern. Da man in jenen
Zeiten den schriftlichen Äußerungen großer Männer bedeutendes Gewicht
beilegte, kam es häufig vor, daß gewinnsüchtige Boten Abschriften davon
machen ließen, die sie teuer verkauften; so wurde der Inhalt manches
Schreibens anderwärts eher bekannt als an seinem Bestimmungsort.
Mit der Tätigkeit der Familie Taris seit 1489 begann die Entwick-
lung des modernen Postwesens. Die Mitglieder dieses später gefürsteten
Hauses waren unter Leibes- und Lebensgefahr zwei Jahrhunderte hin-
durch im Kurier- und Postdienst von unten herauf groß geworden. Dieses
weitverbreitete Geschlecht besaß Verkehrsbeziehungen von Deutschland
bis nach Rom und Madrid, die es zu einer immer größer werdenden Macht
auszunühen verstand. Was zuvor getrennt und verzettelt gewesen war,
sollte nun zusammengefaßt werden: „Der Strom des politischen, kirch-
lichen, volkswirtschaftlichen, wissenschaftlichen und privaten Lebens, der
in hochgradig erregten Zeiten zwischen den zivilisierten Staaten Europas
hin und her flutete, bewegte sich durch die von den Taris geschaffenen
und lebendig erhaltenen internationalen Verkehrsadern."
Das ganze sechzehnte und siebzehnte Jahrhundert war von endlosen
Streitigkeiten um die Postgerechtsame zwischen dem Kaiser, einzelnen
Landesfürsten, den Taris und den Städten erfüllt gewesen. Seit dem
1806 erfolgten Zusammenbruch des alten Reiches war auch das Schicksal
der Reichsbelehnbarkeit der Taris besiegelt; aber die Kämpfe einer neuen
Zeit um das Postwesen und seine Gestaltung für den Dienst der Allgemein-
heit währten noch Jahrzehnte, bis eine Organisation zur regelmäßigen,
jedermann gegen feste Gebühren zustehenden Beförderung von Nachrichten,
Paketen, Geld und Personen geschaffen
wurde. Das dem Hause Taris erblich
gehörige Postwesen wurde 1867 von
Preußen vertraglich abgelöst. Zuvor
bestanden im Lande noch neunzehn
Thurn-und-Tarissche Postgebiete.
Die staatliche Zerrissenheit Deutsch-
lands spiegelt sich auch in den Post-
verhältnissen von den Anfängen bis in
die neueste Zeit deutlich wieder. Die
Portosätze waren ungeordnet und hoch,
denn für Sendungen nach außerhalb
gelegenen Orten wurden so viele Ge-
bühren erhoben, wie einzelne Postge-
biete berührt wurden. Dazu kam die
Verschiedenheit der Entfernungsein-
heiten, Meilenmaße, Münzen und Ge-
wichte. In vielen Fällen mar es kaum
möglich, das Porto bei Aufgabe auch
nur annähernd richtig, zu bestimmen. Nürnberger Postbote aus der Mttte
Diese Zustände herrschten jedoch nicht des fünfzehnten Jahrhunderts.
ÄasBuchfürAlle
Heft -1
Aus der Vergangenheit des Postwesens.
Von Or. Franz Koller.
Erleichterung des Verkehrs und eine möglichst rasche Nach-
1 richtenvermittlung haben alle alten und neueren Kulturvölker an-
gestrebt und auf mannigfaltige Art zu erreichen gesucht. Und doch
and die neuzeitlichen Einrichtungen der Post erst in langsamer Entwicklung
aus den verschiedenartigsten Bedürfnissen hervorgegangen. Bis es dahin
kommen konnte, daß der Gesamtbevölkerung die Vorteile der Verkehrs-
ein hartes Ringen des Reichspostmeisters Taris gegen die Mehgerposten,
die „bey Tag und Nacht Briefe und andere Sachen durch eigene Roß und
Boten auf- und abführen". Trotz wiederholter kaiserlicher Verbote, in
denen die Aufhebung der „Metzgerposten" gefordert wurde, erhielten sie
sich vor allem in Schwaben bis gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts.
Städte und Kaufmannsgilden und einzelne Personen unterhielten
gleichfalls eigene Postboten. Dem Grundzug unseres heutigen Post-
wesens: unbedingte Benützung für jedermann, entsprachen alle diese
mehr oder weniger ständisch gegliederten Einrichtungen noch nicht. „Her-
vorgegangen aus Sonderbedürfnissen einzelner Körperschaften schlossen
einrichtungen zugute kamen, vergingen viele Jahrhun-
derte. Verkehrseinrichtungen, die militärisch-politischen
Zwecken dienten, sind überall den gemeinwirtschaftlichen
vorausgegangen und standen nicht nur anfänglich im
Gegensatz zu ihnen, sondern erhielten sich als Staats-
einrichtungen sogar lange abwehrend gegen privaten Ge-
brauch. Die Reichspost der Römer diente ausschließlich
politischen Notwendigkeiten und blieb im weitesten Sinne
eine drückende Last für das Volk, statt ihm eine Wohltat
zu sein. Die Provinzen mußten für die Erhaltung der
Verkehrsmittel aufkommen, ohne Vorteile für die All-
gemeinheit daraus zu erlangen. Und noch in späteren
Zeiten änderte sich dieser Standpunkt nicht. Ludwig XI.
führte im Jahre 1464 die königliche Post in Frankreich
ein; sie war zur schnellen Besorgung eigener Angelegen-
heiten, für seine Kuriere und Depeschenboten bestimmt.
Ausdrücklich war in einem Gesetzesartikel gesagt, daß diese
Einrichtung nicht zur Bequemlichkeit anderer, sondern
Ein Mönch als Briefbote aus
dem Jahr 1466.
sie zwar die große Masse des Volkes nicht unter allen Um-
ständen von der Inanspruchnahme der Einrichtungen aus,
aber es blieben so weit klaffende Lücken offen im Gesamt-
verkehr, daß man allerorten mit dem steigenden Bedürfnis
Mittel und Wege zur Ausfüllung jener Lücken zu schaffen
sich bestrebte. Es kam zur Ausbildung eines neuen Be-
rufes und Standes: der zünftigen Boten." Da aber nur
wenige Gebildete lesen und schreiben konnten, hielten nur
diese Kreise sich Boten; der größte Teil des Volkes be-
gnügte sich, durch wandernde Mönche und Pilger münd-
liche Grüße übermitteln zu lassen. Kaufleute, Pilgrime
und fahrende Leute brachten nur gelegentlich Neuigkeiten
mit; die Masse war noch nicht in den Verkehr mit ein-
bezogen. Dabei waren auch die hohen Ausgaben ent-
scheidend; wohlhabende Privatleute sowie Gelehrte, die
zur Zeit des Wiederaufblühens von Bildung und Wissen-
schaft zu regem Gedankenaustausch untereinander neig-
ten, verschickten ihre Briefe nicht selten durch eigene
allein nur zu seinem Dienste getroffen worden sei. Bei Todesstrafe war den
Stationsleiternverboten, Pferde ohne Befehl des Großmeisters der Post zur
Verfügung zu stellen, gleichviel von welchem Rang ein Reisender sein möge.
Neben diesen für Staatsangelegenheiten unterhaltenen Verkehrs-
arten bildeten sich im frühen Mittelalter Einrichtungen, die verschiedenen
Ständen mehr oder weniger ausschließlich dienten. Wegen des geringen
Nürnberger „Neuer Allamodischcr Postbote"
um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts.
Güterumlaufes und der un-
entwickelten geistigen Reg-
samkeit großer Volksteile
machte sich noch kein Be-
dürfnis nach postmäßigen
Verbindungen geltend. An
Höfen, in Klöstern, dann auch
an Universitäten und auf-
strebenden Handelsplätzen
regte sich indes ein anderer
Geist, und es kam zu leb-
hafterem Nachrichtendienst,
der durch Boten aller Art
besorgt werden mußte. Be-
deutendwarendieim Jahre
1276 ins Leben gerufenen
Reitposten des Deutschen
Ordens im fernen Osten,
für den die Verbindungen
mit Venedig, dem Sitz des
Ordensmeisters,unerläßlich
gewesen sind. Universitäts-
boten trugen zur Belebung
des geistigen Verkehrs in umfassender Weise bei, denn sie wurden bald für
den allgemeinen Verkehr wichtig. Eigene Boten besaßen auch die Klöster,
Bistümer und Abteien, die anfänglich gleichfalls nur unter sich im Ver-
kehr standen. Bettelmönche durchwanderten die Länder nach allen Rich-
tungen, und zwar nicht nur im Dienste der Geistlichkeit; sie vermittelten
Nachrichten auch an Private. In jenen Zeiten sah man Bettelmönche
selten ohne wohlgefüllten Briefbeutel neben ihrem Bettelsack. Bei dem
theologischen Charakter der Universitäten standen sie auch mit diesen im
Zusammenhang. Im fünfzehnten Jahrhundert kostete die Überbringung
brieflicher Nachrichten durch einen Deutschordensritter-„Bryffjongen" von
Marienburg in Preußen nach Rom zehn Mark Silber — zwanzig Dukaten.
Ein Mönch, der mit einem Brief des Hochmeisters den gleichen Weg
machte, erhielt nur zwei Dukaten, da er Zehrung und Unterkunft auf
der ganzen Reise fast allerorten unentgeltlich erhielt.
Eine eigenartige Rolle spielten die sogenannten „Mehgerposten". Die
Metzger reisten mit Wagen und Pferden zum Einkauf von Schlachtvieh
mancherorten sechs bis acht, ja nicht selten zwanzig Stunden weit. Da diese
Leute meist ein eigenes Haus besaßen und wohlhabend waren, boten sie eine
gewisse Sicherheit für die ihnen anvertrauten Güter und als Vermittler von
Nachrichten. Kaufmannsgilden schlossen mit Metzgern nicht selten Verträge
zur Beförderung ihrer Sendungen. Im sechzehnten Jahrhundert begann
Boten, die von ihnen besoldet wurden. Erasmus von Rotterdam—- 1467
bis 1536 — unterhielt ständig wenigstens einen Boten für seinen brief-
lichen Verkehr und gab jährlich den großen Betrag von sechzig Goldgulden
dafür aus. Er ließ seine Briefe von seinem Wohnsitz Basel durch einen
sicheren eigenen Boten bis nach England befördern. Da man in jenen
Zeiten den schriftlichen Äußerungen großer Männer bedeutendes Gewicht
beilegte, kam es häufig vor, daß gewinnsüchtige Boten Abschriften davon
machen ließen, die sie teuer verkauften; so wurde der Inhalt manches
Schreibens anderwärts eher bekannt als an seinem Bestimmungsort.
Mit der Tätigkeit der Familie Taris seit 1489 begann die Entwick-
lung des modernen Postwesens. Die Mitglieder dieses später gefürsteten
Hauses waren unter Leibes- und Lebensgefahr zwei Jahrhunderte hin-
durch im Kurier- und Postdienst von unten herauf groß geworden. Dieses
weitverbreitete Geschlecht besaß Verkehrsbeziehungen von Deutschland
bis nach Rom und Madrid, die es zu einer immer größer werdenden Macht
auszunühen verstand. Was zuvor getrennt und verzettelt gewesen war,
sollte nun zusammengefaßt werden: „Der Strom des politischen, kirch-
lichen, volkswirtschaftlichen, wissenschaftlichen und privaten Lebens, der
in hochgradig erregten Zeiten zwischen den zivilisierten Staaten Europas
hin und her flutete, bewegte sich durch die von den Taris geschaffenen
und lebendig erhaltenen internationalen Verkehrsadern."
Das ganze sechzehnte und siebzehnte Jahrhundert war von endlosen
Streitigkeiten um die Postgerechtsame zwischen dem Kaiser, einzelnen
Landesfürsten, den Taris und den Städten erfüllt gewesen. Seit dem
1806 erfolgten Zusammenbruch des alten Reiches war auch das Schicksal
der Reichsbelehnbarkeit der Taris besiegelt; aber die Kämpfe einer neuen
Zeit um das Postwesen und seine Gestaltung für den Dienst der Allgemein-
heit währten noch Jahrzehnte, bis eine Organisation zur regelmäßigen,
jedermann gegen feste Gebühren zustehenden Beförderung von Nachrichten,
Paketen, Geld und Personen geschaffen
wurde. Das dem Hause Taris erblich
gehörige Postwesen wurde 1867 von
Preußen vertraglich abgelöst. Zuvor
bestanden im Lande noch neunzehn
Thurn-und-Tarissche Postgebiete.
Die staatliche Zerrissenheit Deutsch-
lands spiegelt sich auch in den Post-
verhältnissen von den Anfängen bis in
die neueste Zeit deutlich wieder. Die
Portosätze waren ungeordnet und hoch,
denn für Sendungen nach außerhalb
gelegenen Orten wurden so viele Ge-
bühren erhoben, wie einzelne Postge-
biete berührt wurden. Dazu kam die
Verschiedenheit der Entfernungsein-
heiten, Meilenmaße, Münzen und Ge-
wichte. In vielen Fällen mar es kaum
möglich, das Porto bei Aufgabe auch
nur annähernd richtig, zu bestimmen. Nürnberger Postbote aus der Mttte
Diese Zustände herrschten jedoch nicht des fünfzehnten Jahrhunderts.