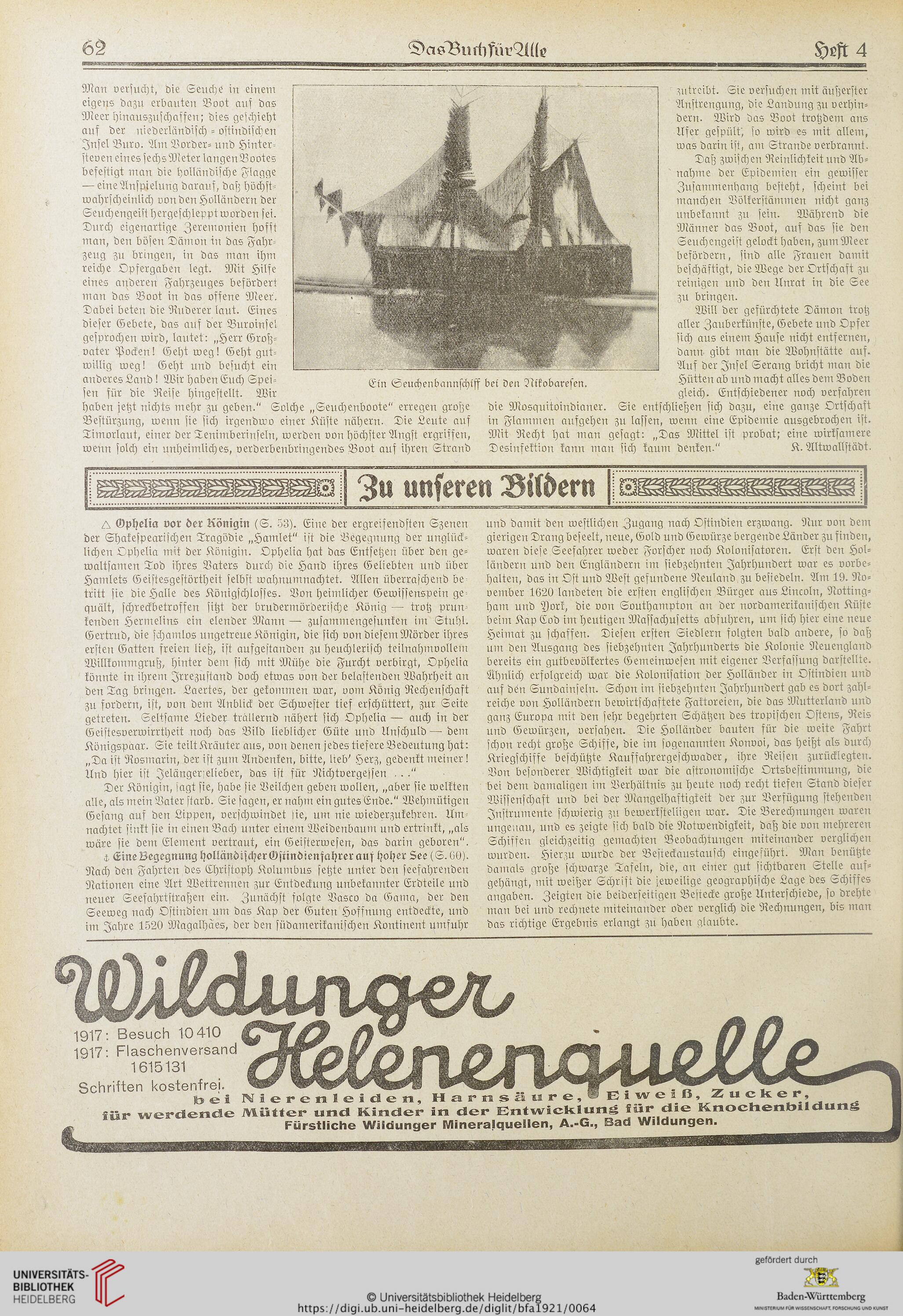62
DnsBuchsüvAlle
Heft 4
Man versucht, die Seuche in einem
eigens dazu erbauten Boot auf das
Meer hinauszuschaffen; dies geschieht
auf der niederländisch - ostiudischeu
Insel Büro. Am Vorder- und Hinter-
steven eines sechs Meter langenBootes
befestigt man die holländische Flagge
— eineAnspielung darauf, daß höchst-
wahrscheinlich von den Holländern der
Seuchengeist hergeschlepptworden sei.
Durch eigenartige Zeremonien hofft
man, den bösen Dämon in das Fahr-
zeug zu bringen, in das man ihm
reiche Opfergaben legt. Mit Hilfe
eines anderen Fahrzeuges befördert
man das Boot in das offene Meer.
Dabei beten die Ruderer laut. Eines
dieser Gebete, das auf der Buroinsei
gesprochen wird, lautet: „Herr Groß-
vater Pocken! Geht weg! Geht gut-
willig weg! Geht und besucht ein
anderes Land! Wir haben Euch Spei-
sen für die Reise hingestellt. Wir
haben jetzt nichts mehr zu geben." Solche „Seuchenboote" erregen große
Bestürzung, wenn sie sich irgendwo einer Lüste nähern. Die Leute auf
Timorlaut, einer der Tenimberinseln, werden von höchster Angst ergriffen,
wenn solch ein unheimliches, verderbenbringendes Boot auf ihren Strand
zutreibt. Sie versuchen mit äußerster
Anstrengung, die Landung zu verhin-
dern. Wird das Boot trotzdem ans
Ufer gespült; so wird es mit allem,
was darin ist, am Strande verbrannt.
Daß zwischen Reinlichkeit und Ab-
nahme der Epidemien ein gewisser
Zusammenhang besteht, scheint bei
manchen Völkerstämmen nicht ganz
unbekannt zu sein. Während die
Männer das Boot, auf das sie den
Seuchengeist gelockt haben, zum Meer
befördern, sind alle Frauen damit
beschäftigt, die Wege der Ortschaft zu
reinigen und den Unrat in die See
zu bringen.
Will der gefürchtete Dämon trotz
aller Zauberkünste, Gebete und Opfer
sich aus einem Hause nicht entfernen,
dann gibt man die Wohnstätte auf.
Auf der Insel Serang bricht man die
Hütten ab und macht alles dem Boden
gleich. Entschiedener noch verfahren
die Mosquitoindianer. Sie entschließen sich dazu, eine ganze Ortschaft
in Flammen aufgehen zu lassen, wenn eine Epidemie ausgebrochen ist.
Mit Recht hat man gesagt: „Das Mittel ist probat; eine wirksamere
Desinfektion kann man sich kaum denken." K. Altwallstädt.
Ein Seuchenbannschisf bei den Bikobaresen.
/X Ophelia vor der Uonigin (S. 53). Eine der ergreifendsten Szenen
der Shakespearischen Tragödie „Hamlet" ist die Begegnung der unglück-
lichen Ophelia mit der Königin. Ophelia hat das Entsetzen über den ge-
waltsamen Tod ihres Vaters durch die Hand ihres Geliebten und über
Hamlets Geistesgestörtheit selbst wahnumnachtet. Allen überraschend be
tritt sie die Halle des Königschlosses. Von heimlicher Gewissenspein ge-
quält, schreckbetroffen sitzt der brudermörderische König — trotz prun-
kenden Hermelins ein elender Mann — zusammengesunken im Stuhl.
Gertrud, die schamlos ungetreue Königin, die sich von diesem Mörder ihres
ersten Gatten freien ließ, ist aufgestanden zu heuchlerisch teilnahmvollem
Willkommgruß, hinter dem sich mit Mühe die Furcht verbirgt, Ophelia
könnte in ihren: Jrrezustand doch etwas von der belastenden Wahrheit an
den Tag bringen. Laertes, der gekommen war, vom König Rechenschaft
zu fordern, ist, von dem Anblick der Schwester tief erschüttert, zur Seite
getreten. Seltsame Lieder trällernd nähert sich Ophelia — auch in der
Eeistesverwirrtheit noch das Bild lieblicher Güte und Unschuld— dem
Königspaar. Sie teiltKräuter aus, von denen jedes tiefere Bedeutung hat:
„Da ist Rosmarin, der ist zum Andenken, bitte, lielL Herz, gedenkt meiner!
Und hier ist Jelängerjelieber, das ist für Nichtvergessen . . ."
Der Königin, sagt sie, habe sie Veilchen geben wollen, „aber sie welkten
alle, als mein Vater starb. Sie sagen, er nahm ein gutes Ende." Wehmütigen
Gesang auf den Lippen, verschwindet jie, um nie wiederzukehren. Um-
nachtet sinkt sie in einen Bach unter einem Weidenbaum und ertrinkt, „als
wäre sie dem Element vertraut, ein Geisterwesen, das darin geboren".
t Eine Begegnung holländischer Gsiindiensahrer auf hoher Lee (S. 60).
Nach den Fahrten des Christoph Kolumbus setzte unter den seefahrenden
Nationen eine Art Wettrennen zur Entdeckung unbekannter Erdteile und
neuer Seefahrtstraßen ein. Zunächst folgte Vasco da Gaum, der den
Seeweg nach Ostindien um das Kap der Guten Hoffnung entdeckte, und
im Jahre 1520 Magalhäes, der den südamerikanischen Kontinent umfuhr
und damit den westlichen Zugang nach Ostindien erzwang. Nur von dem
gierigen Drang beseelt, neue, Gold und Gewürze bergende Länder zu finden,
waren diese Seefahrer weder Forscher noch Kolonisatoren. Erft den Hol-
ländern und den Engländern im siebzehnten Jahrhundert war es Vorbe-
halten, das in Ost und West gefundene Neuland zu besiedeln. Am 19. No-
vember 1620 landeten die ersten englischen Bürger aus Lincoln, Notting-
ham und Porr, die von Southampton an der nordamerikanischen Küste
beim Kap Cod im heutigen Massachusetts abfuhren, um sich hier eine neue
Heimat zu schaffen. Diesen ersten Siedlern folgten bald andere, so daß
uv: den Ausgang des siebzehnten Jahrhunderts die Kolonie Neuengland
bereits ein gutbevölkertes Gemeinwesen mit eigener Verfassung darstellte.
Ähnlich erfolgreich war die Kolonisation der Holländer in Ostindien und
auf den Sundainseln. Schon im siebzehnten Jahrhundert gab es dort zahl-
reiche von Holländern bewirtschaftete Faktoreien, die das Mutterland und
ganz Europa mit den sehr begehrten Schätzen des tropischen Ostens, Reis
und Gewürzen, versahen. Die Holländer bauten für die weite Fahrt
schon recht große Schiffe, die im sogenannten Konvoi, das heißt als durch
Kriegschiffe beschützte Kauffahrergeschwader, ihre Reisen zurücklegten.
Von besonderer Wichtigkeit war die astronomische Ortsbestimmung, die
bei dem damaligen im Verhältnis zu heute noch recht tiefen Stand dieser
Wissenschaft und bei der Mangelhaftigkeit der zur Verfügung stehenden
Instrumente schwierig zu bewerkstelligen war. Die Berechnungen waren
ungenau, und es Zeigte sich bald die Notwendigkeit, daß die von mehreren
Schiffen gleichzeitig gemachten Beobachtungen miteinander verglichen
wurden. Hierzu wurde der Besteckaustausch eingeführt. Man benützte
damals große schwarze Tafeln, die, an einer gut sichtbaren Stelle auf-
gehängt, mit weißer Schrift die jeweilige geographische Lage des Schiffes
angaben. Zeigten die beiderseitigen Bestecke große Unterschiede, so drehte
man bei und rechnete miteinander oder verglich die Rechnungen, bis man
das richtige Ergebnis erlangt zu haben glaubte.
DnsBuchsüvAlle
Heft 4
Man versucht, die Seuche in einem
eigens dazu erbauten Boot auf das
Meer hinauszuschaffen; dies geschieht
auf der niederländisch - ostiudischeu
Insel Büro. Am Vorder- und Hinter-
steven eines sechs Meter langenBootes
befestigt man die holländische Flagge
— eineAnspielung darauf, daß höchst-
wahrscheinlich von den Holländern der
Seuchengeist hergeschlepptworden sei.
Durch eigenartige Zeremonien hofft
man, den bösen Dämon in das Fahr-
zeug zu bringen, in das man ihm
reiche Opfergaben legt. Mit Hilfe
eines anderen Fahrzeuges befördert
man das Boot in das offene Meer.
Dabei beten die Ruderer laut. Eines
dieser Gebete, das auf der Buroinsei
gesprochen wird, lautet: „Herr Groß-
vater Pocken! Geht weg! Geht gut-
willig weg! Geht und besucht ein
anderes Land! Wir haben Euch Spei-
sen für die Reise hingestellt. Wir
haben jetzt nichts mehr zu geben." Solche „Seuchenboote" erregen große
Bestürzung, wenn sie sich irgendwo einer Lüste nähern. Die Leute auf
Timorlaut, einer der Tenimberinseln, werden von höchster Angst ergriffen,
wenn solch ein unheimliches, verderbenbringendes Boot auf ihren Strand
zutreibt. Sie versuchen mit äußerster
Anstrengung, die Landung zu verhin-
dern. Wird das Boot trotzdem ans
Ufer gespült; so wird es mit allem,
was darin ist, am Strande verbrannt.
Daß zwischen Reinlichkeit und Ab-
nahme der Epidemien ein gewisser
Zusammenhang besteht, scheint bei
manchen Völkerstämmen nicht ganz
unbekannt zu sein. Während die
Männer das Boot, auf das sie den
Seuchengeist gelockt haben, zum Meer
befördern, sind alle Frauen damit
beschäftigt, die Wege der Ortschaft zu
reinigen und den Unrat in die See
zu bringen.
Will der gefürchtete Dämon trotz
aller Zauberkünste, Gebete und Opfer
sich aus einem Hause nicht entfernen,
dann gibt man die Wohnstätte auf.
Auf der Insel Serang bricht man die
Hütten ab und macht alles dem Boden
gleich. Entschiedener noch verfahren
die Mosquitoindianer. Sie entschließen sich dazu, eine ganze Ortschaft
in Flammen aufgehen zu lassen, wenn eine Epidemie ausgebrochen ist.
Mit Recht hat man gesagt: „Das Mittel ist probat; eine wirksamere
Desinfektion kann man sich kaum denken." K. Altwallstädt.
Ein Seuchenbannschisf bei den Bikobaresen.
/X Ophelia vor der Uonigin (S. 53). Eine der ergreifendsten Szenen
der Shakespearischen Tragödie „Hamlet" ist die Begegnung der unglück-
lichen Ophelia mit der Königin. Ophelia hat das Entsetzen über den ge-
waltsamen Tod ihres Vaters durch die Hand ihres Geliebten und über
Hamlets Geistesgestörtheit selbst wahnumnachtet. Allen überraschend be
tritt sie die Halle des Königschlosses. Von heimlicher Gewissenspein ge-
quält, schreckbetroffen sitzt der brudermörderische König — trotz prun-
kenden Hermelins ein elender Mann — zusammengesunken im Stuhl.
Gertrud, die schamlos ungetreue Königin, die sich von diesem Mörder ihres
ersten Gatten freien ließ, ist aufgestanden zu heuchlerisch teilnahmvollem
Willkommgruß, hinter dem sich mit Mühe die Furcht verbirgt, Ophelia
könnte in ihren: Jrrezustand doch etwas von der belastenden Wahrheit an
den Tag bringen. Laertes, der gekommen war, vom König Rechenschaft
zu fordern, ist, von dem Anblick der Schwester tief erschüttert, zur Seite
getreten. Seltsame Lieder trällernd nähert sich Ophelia — auch in der
Eeistesverwirrtheit noch das Bild lieblicher Güte und Unschuld— dem
Königspaar. Sie teiltKräuter aus, von denen jedes tiefere Bedeutung hat:
„Da ist Rosmarin, der ist zum Andenken, bitte, lielL Herz, gedenkt meiner!
Und hier ist Jelängerjelieber, das ist für Nichtvergessen . . ."
Der Königin, sagt sie, habe sie Veilchen geben wollen, „aber sie welkten
alle, als mein Vater starb. Sie sagen, er nahm ein gutes Ende." Wehmütigen
Gesang auf den Lippen, verschwindet jie, um nie wiederzukehren. Um-
nachtet sinkt sie in einen Bach unter einem Weidenbaum und ertrinkt, „als
wäre sie dem Element vertraut, ein Geisterwesen, das darin geboren".
t Eine Begegnung holländischer Gsiindiensahrer auf hoher Lee (S. 60).
Nach den Fahrten des Christoph Kolumbus setzte unter den seefahrenden
Nationen eine Art Wettrennen zur Entdeckung unbekannter Erdteile und
neuer Seefahrtstraßen ein. Zunächst folgte Vasco da Gaum, der den
Seeweg nach Ostindien um das Kap der Guten Hoffnung entdeckte, und
im Jahre 1520 Magalhäes, der den südamerikanischen Kontinent umfuhr
und damit den westlichen Zugang nach Ostindien erzwang. Nur von dem
gierigen Drang beseelt, neue, Gold und Gewürze bergende Länder zu finden,
waren diese Seefahrer weder Forscher noch Kolonisatoren. Erft den Hol-
ländern und den Engländern im siebzehnten Jahrhundert war es Vorbe-
halten, das in Ost und West gefundene Neuland zu besiedeln. Am 19. No-
vember 1620 landeten die ersten englischen Bürger aus Lincoln, Notting-
ham und Porr, die von Southampton an der nordamerikanischen Küste
beim Kap Cod im heutigen Massachusetts abfuhren, um sich hier eine neue
Heimat zu schaffen. Diesen ersten Siedlern folgten bald andere, so daß
uv: den Ausgang des siebzehnten Jahrhunderts die Kolonie Neuengland
bereits ein gutbevölkertes Gemeinwesen mit eigener Verfassung darstellte.
Ähnlich erfolgreich war die Kolonisation der Holländer in Ostindien und
auf den Sundainseln. Schon im siebzehnten Jahrhundert gab es dort zahl-
reiche von Holländern bewirtschaftete Faktoreien, die das Mutterland und
ganz Europa mit den sehr begehrten Schätzen des tropischen Ostens, Reis
und Gewürzen, versahen. Die Holländer bauten für die weite Fahrt
schon recht große Schiffe, die im sogenannten Konvoi, das heißt als durch
Kriegschiffe beschützte Kauffahrergeschwader, ihre Reisen zurücklegten.
Von besonderer Wichtigkeit war die astronomische Ortsbestimmung, die
bei dem damaligen im Verhältnis zu heute noch recht tiefen Stand dieser
Wissenschaft und bei der Mangelhaftigkeit der zur Verfügung stehenden
Instrumente schwierig zu bewerkstelligen war. Die Berechnungen waren
ungenau, und es Zeigte sich bald die Notwendigkeit, daß die von mehreren
Schiffen gleichzeitig gemachten Beobachtungen miteinander verglichen
wurden. Hierzu wurde der Besteckaustausch eingeführt. Man benützte
damals große schwarze Tafeln, die, an einer gut sichtbaren Stelle auf-
gehängt, mit weißer Schrift die jeweilige geographische Lage des Schiffes
angaben. Zeigten die beiderseitigen Bestecke große Unterschiede, so drehte
man bei und rechnete miteinander oder verglich die Rechnungen, bis man
das richtige Ergebnis erlangt zu haben glaubte.