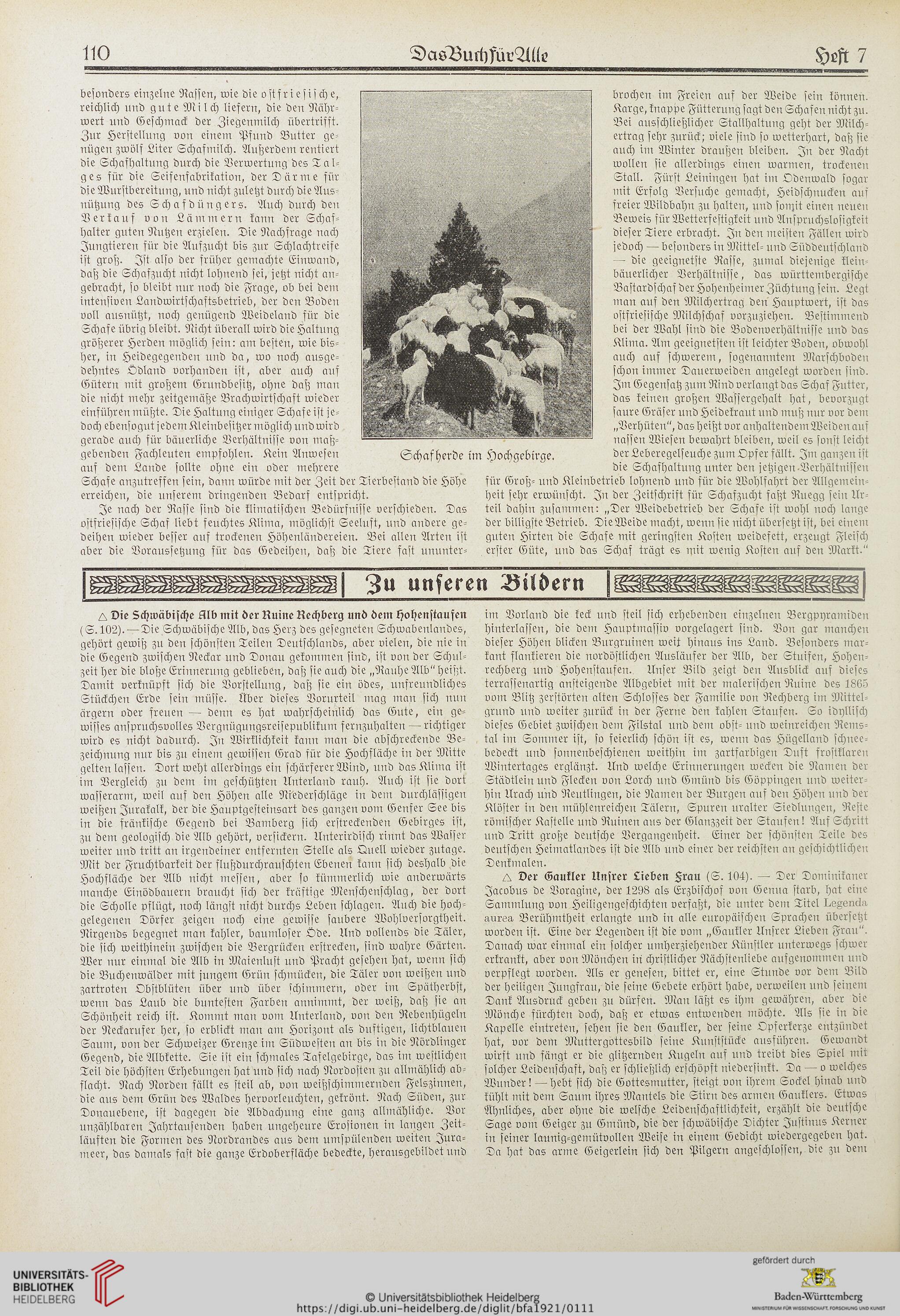110 DasBuchfürAüe
Heft 7
besonders einzelne Nassen, wie die osifriesisch e,
reichlich nnd gute Milch liefern, die den Nähr-
wert und Geschmack der Ziegenmilch übertrifft.
Zur Herstellung von einem Pfund Butter ge-
nügen zwölf Liter Schafmilch. Außerdem rentiert
die Schafhaltung durch die Verwertung des Tal-
ges für die Seifenfabrikation, der Därme für
die Wurstbereitung, und nicht zuletzt durch die Aus-
nützung des Schafdüngers. Auch durch deu
Verkauf von Lämmern kann der Schaf-
halter guten Nutzen erzielen. Die Nachfrage nach
Jungtieren für die Aufzucht bis zur Schlachtreife
ist groß. Ist also der früher gemachte Einwand,
daß die Schafzucht nicht lohnend sei, jetzt nicht an-
gebracht, so bleibt nur noch die Frage, ob bei dem
intensiven Landwirtschaftsbetrieb, der den Boden
voll ausnützt, noch genügend Weideland für die
Schafe übrig bleibt. Nicht überall wird die Haltung
größerer Herden möglich sein: am besten, wie bis-
her, in Heidegegenden und da, wo noch ausge-
dehntes Ödland vorhanden ist, aber auch auf
Gütern mit großem Grundbesitz, ohne daß man
die nicht mehr zeitgemäße Brachwirtschaft wieder
einführen müßte. Die Haltung einiger Schafe ist je-
doch ebensogut jedem Kleinbesitzer möglich und wird
gerade auch für bäuerliche Verhältnisse von maß-
brochen im Freien auf der Weide sein können.
Karge, knappe Fütterung sagt den Schafen nicht zu.
Bei ausschließlicher Stallhaltung geht der Milch-
ertrag sehr zurück; viele sind so wetterhart, daß sie
auch im Winter draußen bleiben. In der Nacht
wollen sie allerdings einen warmen, trockenen
Stall. Fürst Leiningen hat im Odenwald sogar
mit Erfolg Versuche gemacht, Heidschnucken auf
freier Wildbahn zu halten, und soryit einen neuen
Beweis für Wetterfestigkeit und Anspruchslosigkeit
dieser Tiere erbracht. In den meisten Fällen wird
jedoch — besonders in Mittel- und Süddeutschland
— die geeignetste Nasse, zumal diejenige klein-
bäuerlicher Verhältnisse, das württembergische
Bastardschaf der HohenheimerZüchtung sein. Legt
man auf den Milch ertrag den Hauptwerk, ist das
ostfriesische Milchschaf vorzuziehen. Bestimmend
bei der Wahl sind die Bodenverhältnisse und das
Klima. Am geeignetsten ist leichter Boden, obwohl
auch auf schwerem, sogenanntem Marschboden
schon immer Dauerweiden angelegt worden sind.
Im Gegensatz zum Rind verlangt das Schaf Futter,
das keinen großen Wassergehalt hat, bevorzugt
saure Gräser und Heidekraut und muß nur vor dem
„Verhüten", das heißt vor anhaltendemWeiden auf
nassen Wiesen bewahrt bleiben, weil es sonst leicht
gebenden Fachleuten empfohlen. Kein Anwesen Schafherde im Hochgebirge. der Leberegelseuche zum Opfer fällt. Im ganzen ist
auf dem Lande sollte ohne ein oder mehrere die Schafhaltung unter den jetzigen.Verhältnissen
Schafe anzutreffen sein, dann würde mit der Zeit der Tierbestand die Höhe für Groß- und Kleinbetrieb lohnend und für die Wohlfahrt der Allgemein-
erreichen, die unserem dringenden Bedarf entspricht.
Je nach der Rasse sind die klimatischen Bedürfnisse verschieden. Das
ostfriesische Schaf liebt feuchtes Klima, möglichst Seeluft, und andere ge-
deihen wieder besser auf trockenen Höhenlündereien. Bei allen Arten ist
aber die Voraussetzung für das Gedeihen, daß die Tiere fast ununter-
heit sehr erwünscht. In der Zeitschrift für Schafzucht faßt Ruegg sein Ur-
teil dahin zusammen: „Der Weidebetrieb der Schafe ist wohl noch lange
der billigste Betrieb. DieWeide macht, wenn sie nicht übersetzt ist, bei einem
guten Hirten die Schafe mit geringsten Kosten weidefett, erzeugt Fleisch
erster Güte, und das Schaf trägt es mit wenig Kosten auf den Markt."
Zu unseren Bildern s
z^ Die Schwäbische Alb mit -er Ruine Rechberg UN- -em Hohenstaufen
(S. 102).—Die Schwäbische Alb, das Herz des gesegneten Schwabenlandes,
gehört gewiß zu den schönsten Teilen Deutschlands, aber vielen, die nie in
die Gegend zwischen Neckar und Donau gekommen sind, ist von der Schick-
zeit her die bloße Erinnerung geblieben, daß sie auch die „Rauhe Alb" heißt.
Damit verknüpft sich die Vorstellung, daß sie ein ödes, unfreundliches
Stückchen Erde sein müsse. Uber dieses Vorurteil mag man sich nun
ärgern oder freuen — denn es hat wahrscheinlich das Gute, ein ge-
wisses anspruchsvolles Vergnügungsreisepublikum fernzuhalten —richtiger
wird es nicht dadurch. In Wirklichkeit kann man die abschreckende Be-
zeichnung nur bis zu einem gewissen Grad für die Hochfläche in der Mitte
gelten lassen. Dort weht allerdings ein schärferer Wind, und das Klima ist
im Vergleich zu dem im geschützten Unterland rauh. Auch ist sie dort
wasserarm, weil auf den Höhen alle Niederschläge in dem durchlässigen
weißen Jurakalk, der die Hauptgesteinsart des ganzen vom Genfer See bis
in die fränkische Gegend bei Bamberg sich erstreckenden Gebirges ist,
zu dem geologisch die Alb gehört, versickern. Unterirdisch rinnt das Waiser
weiter und tritt an irgendeiner entfernten Stelle als Quell wieder zutage.
Mit der Fruchtbarkeit der flußdurchrauschten Ebenen kann sich deshalb die
Hochfläche der Alb nicht messen, aber so kümmerlich wie anderwärts
manche Einödbauern braucht sich der kräftige Menschenschlag, der dort
die Scholle pflügt, noch längst nicht durchs Leben schlagen. Auch die hoch-
gelegenen Dörfer zeigen noch eine gewisse sanbere Wohlversorgtheit.
Nirgends begegnet man kahler, baumloser Öde. Und vollends die Täler,
die sich weithinein zwischen die Bergrücken erstrecken, sind wahre Gärten.
Wer nur einmal die Alb in Maienlust und Pracht gesehen hat, wenn sich
die Buchenwälder mit jungem Grün schmücken, die Täler von weißen und
zartroten Obstblüten über und über schimmern, oder im Spätherbst,
wenn das Laub die buntesten Farben annimmt, der weiß, daß sie an
Schönheit reich ist. Kommt man vom Unterland, von den Rebenhügeln
der Neckarufer her, so erblickt man am Horizont als duftigen, lichtblauen
Saum, von der Schweizer Grenze im Südwesten an bis in die Nördlinger
Gegend, die Albkette. Sie ist ein schmales Tafelgebirge, das im westlichen
Teil die höchsten Erhebungen hat und sich nach Nordosten zu allmählich ab-
flacht. Nach Norden fällt es steil ab, von weißschimmernden Felszinnen,
die aus dem Grün des Waldes hervorleuchten, gekrönt. Nach Süden, zur
Donauebene, ist dagegen die Abdachung eine ganz allmähliche. Vor
unzählbaren Jahrtausenden haben ungeheure Erosionen in langen Zeit-
läuften die Formen des Nordrandes aus dein umspülenden weiten Jura-
meer, das damals fast die ganze Erdoberfläche bedeckte, herausgebildet und
im Vorland die keck und steil sich erhebenden einzelnen Bergpyramiden
hinterlassen, die dem Hauptmassiv vorgelagert sind. Von gar manchen
dieser Höhen blicken Burgruinen weit hinaus ins Land. Besonders mar-
kant flankieren die nordöstlichen Ausläufer der Alb, der Stuifen, Hohen-
rechberg und Hohenstaufen. Unser Bild zeigt den Ausblick auf dieses
terrassenartig ansteigende Albgebiet mit der malerischen Ruine des 1863
vom Blitz zerstörten alten Schlosses der Familie von Rechberg im Mittel-
grund und weiter zurück in der Ferne den kahlen Staufen. So idyllisch
dieses Gebiet zwischen dem Filstal und dem obst- und weinreichen Rems-
tal im Sommer ist, so feierlich schön ist es, wenn das Hügelland schnee-
bedeckt und sonnenbeschienen weithin im zartfarbigen Duft frostklareu
Wiutertages erglänzt. Und welche Erinnerungen wecken die Namen der
Städtlein und Flecken von Lorch und Gmünd bis Göppingen und weiter-
hin Urach und Reutlingen, die Namen der Burgen auf den Höhen und der
Klöster in den mühlenreichen Tälern, Spuren uralter Siedlungen, Reste
römischer Kastelle und Ruinen aus der Glanzzeit der Staufen! Auf Schritt
und Tritt große deutsche Vergangenheit. Einer der schönsten Teile des
deutschen Heimatlandes ist die Alb und einer der reichsten an geschichtlichen
Denkmalen.
ZX Oer Gaukler Unsrer Lieben Frau (S. 104). — Der Dominikaner-
Jacobus de Voragine, der 1298 als Erzbischof von Genua starb, hat eine
Sammlung von Heiligengeschichten verfaßt, die unter dem Titel DsZencla
anrea Berühmtheit erlangte und in alle europäischen Sprachen überseht
worden ist. Eine der Legenden ist die vom „Gaukler Unsrer Lieben Frau".
Danach war einmal ein solcher umherziehender Künstler unterwegs schwer
erkrankt, aber von Mönchen in christlicher Nächstenliebe ausgenommen und
verpflegt worden. Als er genesen, bittet er, eine Stunde vor dem Bild
der heiligen Jungfrau, die seine Gebete erhört habe, verweilen und seinem
Dank Ausdruck gebeu zu dürfen. Man läßt es ihm gewähren, aber die
Mönche fürchten doch, daß er etwas entwenden möchte. Als sie in die
Kapelle eintreten, sehen sie den Gaukler, der seine Opferkerze entzündet
hat, vor dein Muttergottesbild seine Kunststücke ausführen. Gewandt
wirft und fängt er die glitzernden Kugeln auf und treibt dies Spiel mir
solcher Leidenschaft, daß er schließlich erschöpft niedersinkt. Da — o welches
Wunder! — hebt sich die Gottesmutter, steigt von ihrem Sockel hinab und
kühlt mit dem Saum ihres Mantels die Stirn des armen Gauklers. Etwas
Mnliches, aber ohne die welsche Leidenschaftlichkeit, erzählt die deutsche
Sage vorn Geiger zu Gmünd, die der schwäbische Dichter Justinus Kerner
in seiner launig-gemütvollen Weise in einem Gedicht wiedergegeben hat.
Da hat das arme Eeigerlein sich den Pilgern angeschlossen, die zu dem
Heft 7
besonders einzelne Nassen, wie die osifriesisch e,
reichlich nnd gute Milch liefern, die den Nähr-
wert und Geschmack der Ziegenmilch übertrifft.
Zur Herstellung von einem Pfund Butter ge-
nügen zwölf Liter Schafmilch. Außerdem rentiert
die Schafhaltung durch die Verwertung des Tal-
ges für die Seifenfabrikation, der Därme für
die Wurstbereitung, und nicht zuletzt durch die Aus-
nützung des Schafdüngers. Auch durch deu
Verkauf von Lämmern kann der Schaf-
halter guten Nutzen erzielen. Die Nachfrage nach
Jungtieren für die Aufzucht bis zur Schlachtreife
ist groß. Ist also der früher gemachte Einwand,
daß die Schafzucht nicht lohnend sei, jetzt nicht an-
gebracht, so bleibt nur noch die Frage, ob bei dem
intensiven Landwirtschaftsbetrieb, der den Boden
voll ausnützt, noch genügend Weideland für die
Schafe übrig bleibt. Nicht überall wird die Haltung
größerer Herden möglich sein: am besten, wie bis-
her, in Heidegegenden und da, wo noch ausge-
dehntes Ödland vorhanden ist, aber auch auf
Gütern mit großem Grundbesitz, ohne daß man
die nicht mehr zeitgemäße Brachwirtschaft wieder
einführen müßte. Die Haltung einiger Schafe ist je-
doch ebensogut jedem Kleinbesitzer möglich und wird
gerade auch für bäuerliche Verhältnisse von maß-
brochen im Freien auf der Weide sein können.
Karge, knappe Fütterung sagt den Schafen nicht zu.
Bei ausschließlicher Stallhaltung geht der Milch-
ertrag sehr zurück; viele sind so wetterhart, daß sie
auch im Winter draußen bleiben. In der Nacht
wollen sie allerdings einen warmen, trockenen
Stall. Fürst Leiningen hat im Odenwald sogar
mit Erfolg Versuche gemacht, Heidschnucken auf
freier Wildbahn zu halten, und soryit einen neuen
Beweis für Wetterfestigkeit und Anspruchslosigkeit
dieser Tiere erbracht. In den meisten Fällen wird
jedoch — besonders in Mittel- und Süddeutschland
— die geeignetste Nasse, zumal diejenige klein-
bäuerlicher Verhältnisse, das württembergische
Bastardschaf der HohenheimerZüchtung sein. Legt
man auf den Milch ertrag den Hauptwerk, ist das
ostfriesische Milchschaf vorzuziehen. Bestimmend
bei der Wahl sind die Bodenverhältnisse und das
Klima. Am geeignetsten ist leichter Boden, obwohl
auch auf schwerem, sogenanntem Marschboden
schon immer Dauerweiden angelegt worden sind.
Im Gegensatz zum Rind verlangt das Schaf Futter,
das keinen großen Wassergehalt hat, bevorzugt
saure Gräser und Heidekraut und muß nur vor dem
„Verhüten", das heißt vor anhaltendemWeiden auf
nassen Wiesen bewahrt bleiben, weil es sonst leicht
gebenden Fachleuten empfohlen. Kein Anwesen Schafherde im Hochgebirge. der Leberegelseuche zum Opfer fällt. Im ganzen ist
auf dem Lande sollte ohne ein oder mehrere die Schafhaltung unter den jetzigen.Verhältnissen
Schafe anzutreffen sein, dann würde mit der Zeit der Tierbestand die Höhe für Groß- und Kleinbetrieb lohnend und für die Wohlfahrt der Allgemein-
erreichen, die unserem dringenden Bedarf entspricht.
Je nach der Rasse sind die klimatischen Bedürfnisse verschieden. Das
ostfriesische Schaf liebt feuchtes Klima, möglichst Seeluft, und andere ge-
deihen wieder besser auf trockenen Höhenlündereien. Bei allen Arten ist
aber die Voraussetzung für das Gedeihen, daß die Tiere fast ununter-
heit sehr erwünscht. In der Zeitschrift für Schafzucht faßt Ruegg sein Ur-
teil dahin zusammen: „Der Weidebetrieb der Schafe ist wohl noch lange
der billigste Betrieb. DieWeide macht, wenn sie nicht übersetzt ist, bei einem
guten Hirten die Schafe mit geringsten Kosten weidefett, erzeugt Fleisch
erster Güte, und das Schaf trägt es mit wenig Kosten auf den Markt."
Zu unseren Bildern s
z^ Die Schwäbische Alb mit -er Ruine Rechberg UN- -em Hohenstaufen
(S. 102).—Die Schwäbische Alb, das Herz des gesegneten Schwabenlandes,
gehört gewiß zu den schönsten Teilen Deutschlands, aber vielen, die nie in
die Gegend zwischen Neckar und Donau gekommen sind, ist von der Schick-
zeit her die bloße Erinnerung geblieben, daß sie auch die „Rauhe Alb" heißt.
Damit verknüpft sich die Vorstellung, daß sie ein ödes, unfreundliches
Stückchen Erde sein müsse. Uber dieses Vorurteil mag man sich nun
ärgern oder freuen — denn es hat wahrscheinlich das Gute, ein ge-
wisses anspruchsvolles Vergnügungsreisepublikum fernzuhalten —richtiger
wird es nicht dadurch. In Wirklichkeit kann man die abschreckende Be-
zeichnung nur bis zu einem gewissen Grad für die Hochfläche in der Mitte
gelten lassen. Dort weht allerdings ein schärferer Wind, und das Klima ist
im Vergleich zu dem im geschützten Unterland rauh. Auch ist sie dort
wasserarm, weil auf den Höhen alle Niederschläge in dem durchlässigen
weißen Jurakalk, der die Hauptgesteinsart des ganzen vom Genfer See bis
in die fränkische Gegend bei Bamberg sich erstreckenden Gebirges ist,
zu dem geologisch die Alb gehört, versickern. Unterirdisch rinnt das Waiser
weiter und tritt an irgendeiner entfernten Stelle als Quell wieder zutage.
Mit der Fruchtbarkeit der flußdurchrauschten Ebenen kann sich deshalb die
Hochfläche der Alb nicht messen, aber so kümmerlich wie anderwärts
manche Einödbauern braucht sich der kräftige Menschenschlag, der dort
die Scholle pflügt, noch längst nicht durchs Leben schlagen. Auch die hoch-
gelegenen Dörfer zeigen noch eine gewisse sanbere Wohlversorgtheit.
Nirgends begegnet man kahler, baumloser Öde. Und vollends die Täler,
die sich weithinein zwischen die Bergrücken erstrecken, sind wahre Gärten.
Wer nur einmal die Alb in Maienlust und Pracht gesehen hat, wenn sich
die Buchenwälder mit jungem Grün schmücken, die Täler von weißen und
zartroten Obstblüten über und über schimmern, oder im Spätherbst,
wenn das Laub die buntesten Farben annimmt, der weiß, daß sie an
Schönheit reich ist. Kommt man vom Unterland, von den Rebenhügeln
der Neckarufer her, so erblickt man am Horizont als duftigen, lichtblauen
Saum, von der Schweizer Grenze im Südwesten an bis in die Nördlinger
Gegend, die Albkette. Sie ist ein schmales Tafelgebirge, das im westlichen
Teil die höchsten Erhebungen hat und sich nach Nordosten zu allmählich ab-
flacht. Nach Norden fällt es steil ab, von weißschimmernden Felszinnen,
die aus dem Grün des Waldes hervorleuchten, gekrönt. Nach Süden, zur
Donauebene, ist dagegen die Abdachung eine ganz allmähliche. Vor
unzählbaren Jahrtausenden haben ungeheure Erosionen in langen Zeit-
läuften die Formen des Nordrandes aus dein umspülenden weiten Jura-
meer, das damals fast die ganze Erdoberfläche bedeckte, herausgebildet und
im Vorland die keck und steil sich erhebenden einzelnen Bergpyramiden
hinterlassen, die dem Hauptmassiv vorgelagert sind. Von gar manchen
dieser Höhen blicken Burgruinen weit hinaus ins Land. Besonders mar-
kant flankieren die nordöstlichen Ausläufer der Alb, der Stuifen, Hohen-
rechberg und Hohenstaufen. Unser Bild zeigt den Ausblick auf dieses
terrassenartig ansteigende Albgebiet mit der malerischen Ruine des 1863
vom Blitz zerstörten alten Schlosses der Familie von Rechberg im Mittel-
grund und weiter zurück in der Ferne den kahlen Staufen. So idyllisch
dieses Gebiet zwischen dem Filstal und dem obst- und weinreichen Rems-
tal im Sommer ist, so feierlich schön ist es, wenn das Hügelland schnee-
bedeckt und sonnenbeschienen weithin im zartfarbigen Duft frostklareu
Wiutertages erglänzt. Und welche Erinnerungen wecken die Namen der
Städtlein und Flecken von Lorch und Gmünd bis Göppingen und weiter-
hin Urach und Reutlingen, die Namen der Burgen auf den Höhen und der
Klöster in den mühlenreichen Tälern, Spuren uralter Siedlungen, Reste
römischer Kastelle und Ruinen aus der Glanzzeit der Staufen! Auf Schritt
und Tritt große deutsche Vergangenheit. Einer der schönsten Teile des
deutschen Heimatlandes ist die Alb und einer der reichsten an geschichtlichen
Denkmalen.
ZX Oer Gaukler Unsrer Lieben Frau (S. 104). — Der Dominikaner-
Jacobus de Voragine, der 1298 als Erzbischof von Genua starb, hat eine
Sammlung von Heiligengeschichten verfaßt, die unter dem Titel DsZencla
anrea Berühmtheit erlangte und in alle europäischen Sprachen überseht
worden ist. Eine der Legenden ist die vom „Gaukler Unsrer Lieben Frau".
Danach war einmal ein solcher umherziehender Künstler unterwegs schwer
erkrankt, aber von Mönchen in christlicher Nächstenliebe ausgenommen und
verpflegt worden. Als er genesen, bittet er, eine Stunde vor dem Bild
der heiligen Jungfrau, die seine Gebete erhört habe, verweilen und seinem
Dank Ausdruck gebeu zu dürfen. Man läßt es ihm gewähren, aber die
Mönche fürchten doch, daß er etwas entwenden möchte. Als sie in die
Kapelle eintreten, sehen sie den Gaukler, der seine Opferkerze entzündet
hat, vor dein Muttergottesbild seine Kunststücke ausführen. Gewandt
wirft und fängt er die glitzernden Kugeln auf und treibt dies Spiel mir
solcher Leidenschaft, daß er schließlich erschöpft niedersinkt. Da — o welches
Wunder! — hebt sich die Gottesmutter, steigt von ihrem Sockel hinab und
kühlt mit dem Saum ihres Mantels die Stirn des armen Gauklers. Etwas
Mnliches, aber ohne die welsche Leidenschaftlichkeit, erzählt die deutsche
Sage vorn Geiger zu Gmünd, die der schwäbische Dichter Justinus Kerner
in seiner launig-gemütvollen Weise in einem Gedicht wiedergegeben hat.
Da hat das arme Eeigerlein sich den Pilgern angeschlossen, die zu dem