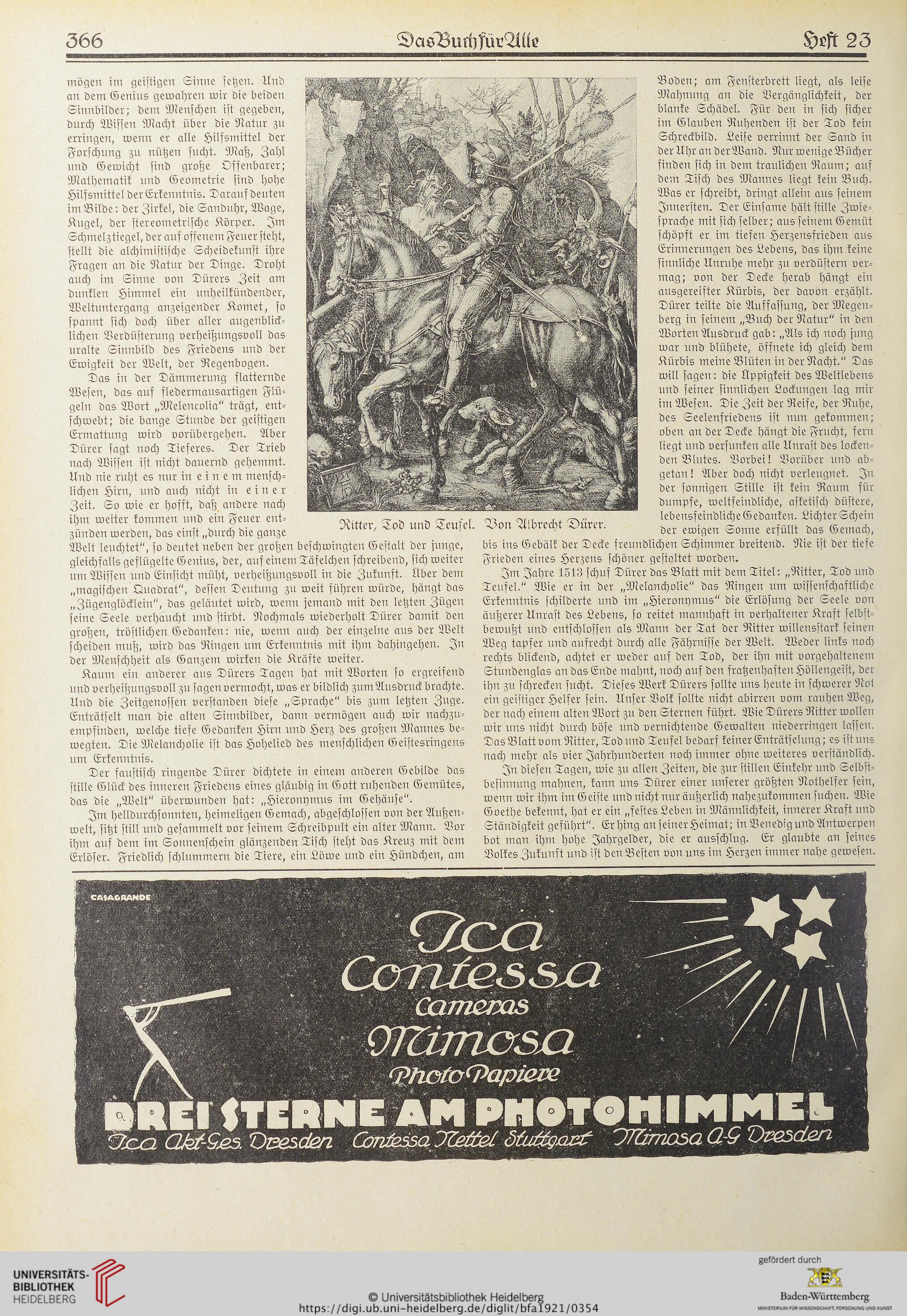366
DasBuchfürAlle
Heft 23
mögen im geistigen Sinne setzen. Und
an dem Genius gewahren wir die beiden
Sinnbilder; dein Menschen ist gegeben,
durch Wissen Macht über die Natur zu
erringen, wenn er alle Hilfsmittel der
Forschung zu nützen sucht. Matz, Zahl
und Gewicht sind grotze Offenbarer;
Mathematik und Geometrie sind hohe
Hilfsmittel der Erkenntnis. Darauf deuten
im Bilde: der Zirkel, die Sanduhr, Wage,
Kugel, der stereometrische Körper. Im
Schmelztiegel, der auf offenem Feuer steht,
stellt die alchimistische Scheidekunst ihre
Fragen an die Natur der Dinge. Droht
auch im Sinne von Dürers Zeit am
dunklen Himmel ein unheilkündender,
Weltuntergang anzeigender Komet, so
spannt sich doch über aller augenblick-
lichen Verdüsterung verheißungsvoll das
uralte Sinnbild des Friedens und der
Ewigkeit der Welt, der Regenbogen.
Das in der Dämmerung flatternde
Wesen, das auf fledermausartigen Flü-
geln das Wort „Melencolia" trägt, ent-
schwebt; die bange Stunde der geistigen
Ermattung wird vorübergehen. Aber
Dürer sagt noch Tieferes. Der Trieb
nach Wissen ist nicht dauernd gehemmt.
Und nie ruht es nur in einem mensch-
lichen Hirn, und auch nicht in einer
Zeit. So wie er hofft, datz andere nach
ihm weiter kommen und ein Feuer ent-
zündenwerden, das einst „durch die ganze
Welt leuchtet", so deutet neben der großen beschwingten Gestalt der junge,
gleichfalls geflügelte Genius, der, auf einem Täfelchen schreibend, sich weiter
um Wissen und Einsicht müht, verheißungsvoll in die Zukunft. Uber dem
„magischen Quadrat", dessen Deutung zu weit führen würde, hängt das
„Zügenglöcklein", das geläutet wird, wenn jemand mit den letzten Zügen
seine Seele verhaucht uud stirbt. Nochmals wiederholt Dürer damit den
großen, tröstlichen Gedanken: nie, wenn auch der einzelne aus der Welt
scheiden mutz, wird das Ringen um Erkenntnis mit ihm dahingehen. In
der Menschheit als Ganzem wirken die Kräfte weiter.
Kaum ein anderer aus Dürers Tagen hat mit Worten so ergreifend
uud verheißungsvoll zu sagen vermocht, was er bildlich zum Ausdruck brachte.
Und die Zeitgenossen verstanden diese „Sprache" bis zum letzten Zuge.
Enträtselt man die alten Sinnbilder, dann vermögen auch wir nachzu-
empfinden, welche tiefe Gedanken Hirn und Herz des großen Mannes be-
wegten. Die Melancholie ist das Hohelied des menschlichen Eeistesringens
um Erkenntnis.
Der faustisch ringende Dürer dichtete in einem anderen Gebilde das
stille Glück des inneren Friedens eines gläubig in Gott ruhenden Gemütes,
das die „Welt" überwunden hat: „Hieronymus im Gehäuse".
Im helldurchsonnten, heimeligen Gemach, abgeschlossen von der Außen-
welt, sitzt still und gesammelt vor seinem Schreibpult eiu alter Maun. Vor
ihm auf dem im Sonnenschein glänzenden Tisch steht das Kreuz mit dem
Erlöser. Friedlich schlummern die Tiere, ein Löwe und ein Hündchen, am
Boden; am Fensterbrett liegt, als leise
Mahnung an die Vergänglichkeit, der
blanke Schädel. Für den in sich sicher
im Glauben Ruhenden ist der Tod kein
Schreckbild. Leise verrinnt der Sand in
der Uhr an derWand. Nur wenige Bücher
finden sich in dem traulichen Raum; auf
dem Tisch des Mannes liegt kein Buch.
Was er schreibt, dringt allein aus seinem
Innersten. Der Einsame hält stille Zwie-
sprache mit sich selber; aus seinem Gemüt
schöpft er im tiefen Herzensfrieden aus
Erinnerungen des Lebens, das ihm keine
sinnliche Unruhe mehr zu verdüstern ver-
mag; von der Decke herab hängt ein
ausgereister Kürbis, der davon erzählt.
Dürer teilte die Auffassung, der Megen-
berg in seinem „Buch der Natur" in den
Worten Ausdruck gab: „Als ich uoch jung
war und blühete, öffnete ich gleich dem
Kürbis meine Blüten in der Nacht." Das
will sagen: die Üppigkeit des Weltlebens
und seiner sinnlichen Lockungen lag mir
im Wesen. Die Zeit der Reife, der Ruhe,
des Seelenfriedens ist nun gekommen;
oben an der Decke hängt die Frucht, fern
liegt und versunken alle Unrast des locken-
den Blutes. Vorbei! Vorüber und ab-
getan! Aber doch nicht verleugnet. In
der sonnigen Stille ist kein Raum für-
dumpfe, weltfeindliche, asketisch düstere,
lebensfeindliche Gedanken. Lichter Schein
der ewigen Sonne erfüllt das Gemach,
bis ins Gebälk der Decke freundlichen Schimmer breitend. Nie ist der tiefe
Frieden eines Herzens schöner gestaltet worden.
Im Jahre 1513 schuf Dürer das Blatt mit dem Titel: „Ritter, Tod und
Teufel." Wie er in der „Melancholie" das Ringen um wissenschaftliche
Erkenntnis schilderte und im „Hieronymus" die Erlösung der Seele von
äußerer Unrast des Lebens, so reitet mannhaft in verhaltener Kraft selbst-
bewußt uud entschlossen als Mann der Tat der Ritter willensstark seinen
Weg tapfer und aufrecht durch alle Fährnisse der Welt. Weder links noch
rechts blickend, achtet er weder auf den Tod, der ihn mit vorgehaltenem
Stundenglas an das Ende mahnt, noch auf den fratzenhaften Höllengeist, der
ihn zu schrecken sucht. Dieses Werk Dürers sollte uns heute in schwerer Nol
ein geistiger Helfer sein. Unser Volk sollte nicht abirren vom rauhen Weg,
der nach einem alten Wort zu den Sternen führt. Wie Dürers Ritter wollen
wir uns nicht durch böse und vernichtende Gewalten niederringen lassen.
Das Blatt vom Ritter, Tod und Teufel bedarf keiner Enträtselung; es ist uns
nach mehr als vier Jahrhunderten noch immer ohne weiteres verständlich.
In diesen Tagen, wie zu allen Zeiten, die zur stillen Einkehr und Selbst-
besinnung mahnen, kann uns Dürer einer unserer größten Nothelfer sein,
wenn wir ihm im Geiste und nicht nur äußerlich nahezukommen suchen. Wie
Goethe bekennt, hat er ein „festes Leben in Männlichkeit, innerer Kraft und
Ständigkeit geführt". Er hing an seiner Heimat; in Venedig uud Antwerpen
bot man ihm hohe Fahrgelder, die er ausschlug. Er glaubte an seines
Volkes Zukunft und ist den Besten von uns im Herzen immer nahe gewesen.
Ritter, Tod und Teufel. Von Albrecht Dürer.
DasBuchfürAlle
Heft 23
mögen im geistigen Sinne setzen. Und
an dem Genius gewahren wir die beiden
Sinnbilder; dein Menschen ist gegeben,
durch Wissen Macht über die Natur zu
erringen, wenn er alle Hilfsmittel der
Forschung zu nützen sucht. Matz, Zahl
und Gewicht sind grotze Offenbarer;
Mathematik und Geometrie sind hohe
Hilfsmittel der Erkenntnis. Darauf deuten
im Bilde: der Zirkel, die Sanduhr, Wage,
Kugel, der stereometrische Körper. Im
Schmelztiegel, der auf offenem Feuer steht,
stellt die alchimistische Scheidekunst ihre
Fragen an die Natur der Dinge. Droht
auch im Sinne von Dürers Zeit am
dunklen Himmel ein unheilkündender,
Weltuntergang anzeigender Komet, so
spannt sich doch über aller augenblick-
lichen Verdüsterung verheißungsvoll das
uralte Sinnbild des Friedens und der
Ewigkeit der Welt, der Regenbogen.
Das in der Dämmerung flatternde
Wesen, das auf fledermausartigen Flü-
geln das Wort „Melencolia" trägt, ent-
schwebt; die bange Stunde der geistigen
Ermattung wird vorübergehen. Aber
Dürer sagt noch Tieferes. Der Trieb
nach Wissen ist nicht dauernd gehemmt.
Und nie ruht es nur in einem mensch-
lichen Hirn, und auch nicht in einer
Zeit. So wie er hofft, datz andere nach
ihm weiter kommen und ein Feuer ent-
zündenwerden, das einst „durch die ganze
Welt leuchtet", so deutet neben der großen beschwingten Gestalt der junge,
gleichfalls geflügelte Genius, der, auf einem Täfelchen schreibend, sich weiter
um Wissen und Einsicht müht, verheißungsvoll in die Zukunft. Uber dem
„magischen Quadrat", dessen Deutung zu weit führen würde, hängt das
„Zügenglöcklein", das geläutet wird, wenn jemand mit den letzten Zügen
seine Seele verhaucht uud stirbt. Nochmals wiederholt Dürer damit den
großen, tröstlichen Gedanken: nie, wenn auch der einzelne aus der Welt
scheiden mutz, wird das Ringen um Erkenntnis mit ihm dahingehen. In
der Menschheit als Ganzem wirken die Kräfte weiter.
Kaum ein anderer aus Dürers Tagen hat mit Worten so ergreifend
uud verheißungsvoll zu sagen vermocht, was er bildlich zum Ausdruck brachte.
Und die Zeitgenossen verstanden diese „Sprache" bis zum letzten Zuge.
Enträtselt man die alten Sinnbilder, dann vermögen auch wir nachzu-
empfinden, welche tiefe Gedanken Hirn und Herz des großen Mannes be-
wegten. Die Melancholie ist das Hohelied des menschlichen Eeistesringens
um Erkenntnis.
Der faustisch ringende Dürer dichtete in einem anderen Gebilde das
stille Glück des inneren Friedens eines gläubig in Gott ruhenden Gemütes,
das die „Welt" überwunden hat: „Hieronymus im Gehäuse".
Im helldurchsonnten, heimeligen Gemach, abgeschlossen von der Außen-
welt, sitzt still und gesammelt vor seinem Schreibpult eiu alter Maun. Vor
ihm auf dem im Sonnenschein glänzenden Tisch steht das Kreuz mit dem
Erlöser. Friedlich schlummern die Tiere, ein Löwe und ein Hündchen, am
Boden; am Fensterbrett liegt, als leise
Mahnung an die Vergänglichkeit, der
blanke Schädel. Für den in sich sicher
im Glauben Ruhenden ist der Tod kein
Schreckbild. Leise verrinnt der Sand in
der Uhr an derWand. Nur wenige Bücher
finden sich in dem traulichen Raum; auf
dem Tisch des Mannes liegt kein Buch.
Was er schreibt, dringt allein aus seinem
Innersten. Der Einsame hält stille Zwie-
sprache mit sich selber; aus seinem Gemüt
schöpft er im tiefen Herzensfrieden aus
Erinnerungen des Lebens, das ihm keine
sinnliche Unruhe mehr zu verdüstern ver-
mag; von der Decke herab hängt ein
ausgereister Kürbis, der davon erzählt.
Dürer teilte die Auffassung, der Megen-
berg in seinem „Buch der Natur" in den
Worten Ausdruck gab: „Als ich uoch jung
war und blühete, öffnete ich gleich dem
Kürbis meine Blüten in der Nacht." Das
will sagen: die Üppigkeit des Weltlebens
und seiner sinnlichen Lockungen lag mir
im Wesen. Die Zeit der Reife, der Ruhe,
des Seelenfriedens ist nun gekommen;
oben an der Decke hängt die Frucht, fern
liegt und versunken alle Unrast des locken-
den Blutes. Vorbei! Vorüber und ab-
getan! Aber doch nicht verleugnet. In
der sonnigen Stille ist kein Raum für-
dumpfe, weltfeindliche, asketisch düstere,
lebensfeindliche Gedanken. Lichter Schein
der ewigen Sonne erfüllt das Gemach,
bis ins Gebälk der Decke freundlichen Schimmer breitend. Nie ist der tiefe
Frieden eines Herzens schöner gestaltet worden.
Im Jahre 1513 schuf Dürer das Blatt mit dem Titel: „Ritter, Tod und
Teufel." Wie er in der „Melancholie" das Ringen um wissenschaftliche
Erkenntnis schilderte und im „Hieronymus" die Erlösung der Seele von
äußerer Unrast des Lebens, so reitet mannhaft in verhaltener Kraft selbst-
bewußt uud entschlossen als Mann der Tat der Ritter willensstark seinen
Weg tapfer und aufrecht durch alle Fährnisse der Welt. Weder links noch
rechts blickend, achtet er weder auf den Tod, der ihn mit vorgehaltenem
Stundenglas an das Ende mahnt, noch auf den fratzenhaften Höllengeist, der
ihn zu schrecken sucht. Dieses Werk Dürers sollte uns heute in schwerer Nol
ein geistiger Helfer sein. Unser Volk sollte nicht abirren vom rauhen Weg,
der nach einem alten Wort zu den Sternen führt. Wie Dürers Ritter wollen
wir uns nicht durch böse und vernichtende Gewalten niederringen lassen.
Das Blatt vom Ritter, Tod und Teufel bedarf keiner Enträtselung; es ist uns
nach mehr als vier Jahrhunderten noch immer ohne weiteres verständlich.
In diesen Tagen, wie zu allen Zeiten, die zur stillen Einkehr und Selbst-
besinnung mahnen, kann uns Dürer einer unserer größten Nothelfer sein,
wenn wir ihm im Geiste und nicht nur äußerlich nahezukommen suchen. Wie
Goethe bekennt, hat er ein „festes Leben in Männlichkeit, innerer Kraft und
Ständigkeit geführt". Er hing an seiner Heimat; in Venedig uud Antwerpen
bot man ihm hohe Fahrgelder, die er ausschlug. Er glaubte an seines
Volkes Zukunft und ist den Besten von uns im Herzen immer nahe gewesen.
Ritter, Tod und Teufel. Von Albrecht Dürer.