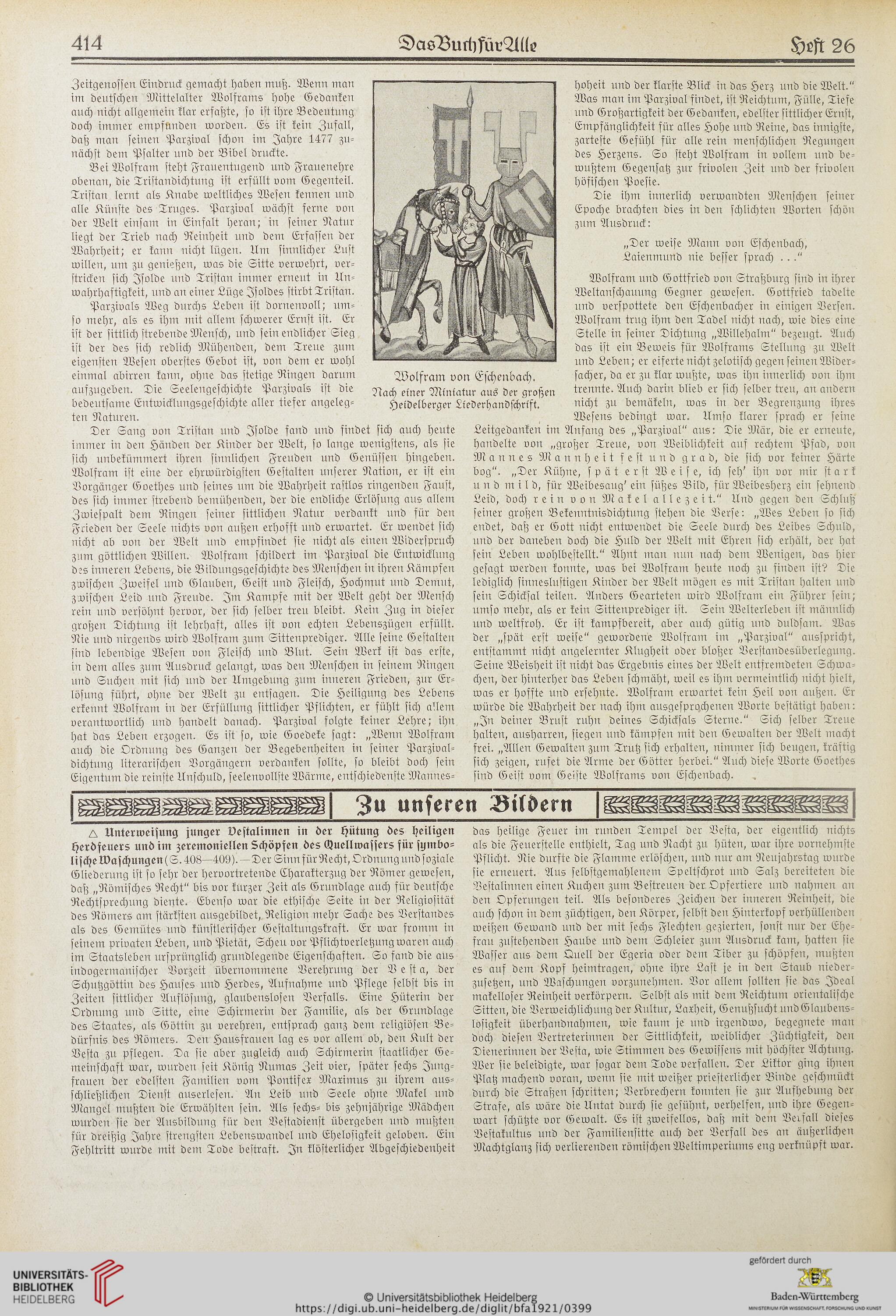DasBuchfürAlle Heft 26
Zeitgenossen Eindruck gemacht haben muß. Wenn man
im deutschen Mittelalter Wolframs hohe Gedanken
auch nicht allgemein klar erfaßte, so ist ihre Bedeutung
doch immer empfunden worden. Es ist kein Zufall,
daß man seinen Parzival schon im Jahre 1477 zu-
nächst dem Psalter und der Bibel druckte.
Bei Wolfram steht Frauentugend und Frauenehre
obenan, die Tristandichtung ist erfüllt vom Gegenteil.
Tristan lernt als Knabe weltliches Wesen kennen und
alle Künste des Truges. Parzival wächst ferue von
der Welt einsam in Einfalt heran; in seiner Natur
liegt der Trieb nach Reinheit und dem Erfassen der
Wahrheit; er kann nicht lügen. Um sinnlicher Lust
willen, um zu genießen, was die Sitte verwehrt, ver-
stricken sich Isolde und Tristan immer erneut in Un-
wahrhaftigkeit, und an einer Lüge Isoldes stirbt Tristan.
Parzioals Weg durchs Leben ist dornenvoll; um-
so mehr, als es ihm mit allem schwerer Ernst ist. Er
ist der sittlich strebende Mensch, und sein endlicher Sieg
ist der des sich redlich Mühenden, dem Treue zum
eigensten Wesen oberstes Gebot ist, von dem er wohl
einmal abirren kann, ohne das stetige Ringen darum
aufzugeben. Die Seelengeschichte Parzivals ist die
bedeutsame Entwicklungsgeschichte aller tiefer angeleg-
ten Naturen.
Der Sang von Tristan und Isolde fand und findet sich auch heute
immer in den Händen der Kinder der Welt, so lange wenigstens, als sie
sich unbekümmert ihren sinnlichen Freuden und Genüssen hingeben.
Wolfram ist eine der ehrwürdigsten Gestalten unserer Nation, er ist ein
Vorgänger Goethes und seines um die Wahrheit rastlos ringenden Faust,
des sich immer strebend bemühenden, der die endliche Erlösung aus allem
Zwiespalt dem Ringen seiner sittlichen Natur verdankt und für den
Frieden der Seele nichts von außen erhofft und erwartet. Er wendet sich
nicht ab von der Welt und empfindet sie nicht als einen Widerspruch
zum göttlichen Willen. Wolfram schildert im Parzival die Entwicklung
des inneren Lebens, die Bildungsgeschichte des Menschen in ihren Kümpfen
zwischen Zweifel und Glauben, Geist und Fleisch, Hochmut und Demut,
zwischen Leid und Freude. Im Kampfe mit der Welt geht der Mensch
rein und versöhnt hervor, der sich selber treu bleibt. Kein Zug in dieser
großen Dichtung ist lehrhaft, alles ist von echten Lebenszügen erfüllt.
Nie und nirgends wird Wolfram zum Sittenprediger. Alle seine Gestalten
sind lebendige Wesen von Fleisch und Blut. Sein Werk ist das erste,
in dem alles zum Ausdruck gelangt, was den Menschen in seinem Ringen
und Suchen mit sich und der Umgebung zum inneren Frieden, zur Er-
lösung führt, ohne der Welt zu entsagen. Die Heiligung des Lebens
erkennt Wolfram in der Erfüllung sittlicher Pflichten, er fühlt sich allem
verantwortlich und handelt danach. Parzival folgte keiner Lehre; ihn
hat das Leben erzogen. Es ist so, wie Goedeke sagt: „Wenn Wolfram
auch die Ordnung des Ganzen der Begebenheiten in seiner Parzival-
dichtung literarischen Vorgängern verdanken sollte, so bleibt doch sein
Eigentum die reinste Unschuld, seelenvollste Wärme, entschiedenste Mannes-
hoheit und der klarste Blick in das Herz und die Welt."
Was man im Parzival findet, ist Reichtum, Fülle, Tiefe
und Großartigkeit der Gedanken, edelster sittlicher Ernst,
Empfänglichkeit für alles Hohe und Reine, das innigste,
zarteste Gefühl für alle rein menschlichen Regungen
des Herzens. So steht Wolfram in vollem und be-
wußtem Gegensatz zur frivolen Zeit und der frivolen
höfischen Poesie.
Die ihm innerlich verwandten Menschen seiner
Epoche brachten dies in den schlichten Worten schön
zum Ausdruck:
„Der weise Mann von Eschenbach,
Laienmund nie besser sprach ..."
Wolfram und Gottfried von Straßburg sind in ihrer
Weltanschauung Gegner gewesen. Gottfried tadelte
und verspottete den Eschenbacher in einigen Versen.
Wolfram trug ihm den Tadel nicht nach, wie dies eine
Stelle in seiner Dichtung „Willehalm" bezeugt. Auch
das ist ein Beweis für Wolframs Stellung zu Welt
und Leben; er eiferte nicht zelotisch gegen seinen Wider-
sacher, da er zu klar wußte, was ihn innerlich von ihm
trennte. Auch darin blieb er sich selber treu, an andern
nicht zu bemäkeln, was in der Begrenzung ihres
Wesens bedingt war. Umso klarer sprach er seine
Leitgedanken im Anfang des „Parzival" aus: Die Mär, die er erneute,
handelte vou „großer Treue, vou Weiblichkeit auf rechtem Pfad, von
M annes Mannheit festund g r a d, die sich vor keiner Härte
bog". „Der Kühne, spät e r st Weise, ich seh' ihn vor mir st a r k
u n d miI d, für Weibesaug' ein süßes Bild, für Weibesherz ein sehnend
Leid, doch rein von Makel allezeit." Und gegen den Schluß
seiner großen Bekenntnisdichtung stehen die Verse: „Wes Leben so sich
endet, daß er Gott nicht entwendet die Seele durch des Leibes Schuld,
und der daneben doch die Huld der Welt mit Ehren sich erhält, der hat
sein Leben wohlbestellt." Ahnt man nun nach dem Wenigen, das hier-
gesagt werden konnte, was bei Wolfram heute noch zu finden ist? Die
lediglich sinneslustigen Kinder der Welt mögen es mit Tristan halten und
sein Schicksal teilen. Anders Gearteten wird Wolfram ein Führer sein;
umso mehr, als er kein Sittenprediger ist. Sein Welterleben ist männlich
und weltfroh. Er ist kampfbereit, aber auch gütig und duldsam. Was
der „spät erst weise" gewordene Wolfram im „Parzival" ausspricht,
entstammt nicht angelernter Klugheit oder bloßer Verstandesüberlegung.
Seine Weisheit ist nicht das Ergebnis eines der Welt entfremdeten Schwa-
chen, der hinterher das Leben schmäht, weil es ihm vermeintlich nicht hielt,
was er hoffte und ersehnte. Wolfram erwartet kein Heil von außen. Er
würde die Wahrheit der nach ihm ausgesprochenen Worte bestätigt haben:
„In deiner Brust ruhn deines Schicksals Sterne." Sich selber Treue
halten, ausharren, siegen und kämpfen mit den Gewalten der Welt macht
frei. „Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten, nimmer sich beugen, kräftig
sich zeigen, rufet die Arme der Götter herbei." Auch diese Worte Goethes
sind Geist vom Geiste Wolframs von Eschenbach.
Wolfram von Eschenbach.
Nach einer Miniatur aus der großen
Heidelberger Lkederhandschrift.
Zu unseren Bildern
Unterweisung junger Vestalinnen in der Hütung des heiligen
Herdfeuers und im zeremoniellen Schöpfen des Buellwassers für symbo-
lische Waschungen (S. 408—409).—Der Sinn für Recht, Ordnung und soziale
Gliederung ist so sehr der hervortretende Charakterzug der Römer gewesen,
daß „Römisches Recht" bis vor kurzer Zeit als Grundlage auch für deutsche
Rechtsprechung diente. Ebenso war die ethische Seite in der Religiosität
des Römers am stärksten ausgebildet, Religion mehr Sache des Verstandes
als des Gemütes und künstlerischer Gestaltungskraft. Er war fromm in
seinem privaten Leben, und Pietät, Scheu vor Pflichtverletzung waren auch
im Staatsleben ursprünglich grundlegende Eigenschaften. So fand die aus
indogermanischer Vorzeit übernommene Verehrung der V e st a, der
Schutzgöttin des Hauses und Herdes, Aufnahme und Pflege selbst bis in
Zeiten sittlicher Auflösung, glaubenslosen Verfalls. Eine Hüterin der
Ordnung und Sitte, eine Schirmerin der Familie, als der Grundlage
des Staates, als Göttin zu verehren, entsprach ganz dem religiösen Be-
dürfnis des Römers. Den Hausfrauen lag es vor allem ob, den Kult der
Vesta zu pflegen. Da sie aber zugleich auch Schirmerin staatlicher Ge-
meinschaft war, wurden seit König Numas Zeit vier, später sechs Jung-
frauen der edelsten Familien vom Pontifex Maximus zu ihrem aus-
schließlichen Dienst auserlesen. An Leib und Seele ohne Makel und
Mangel mußten die Erwählten sein. Als sechs- bis zehnjährige Mädchen
wurden sie der Ausbildung für den Vestadienst übergeben und mußten
für dreißig Jahre strengsten Lebenswandel und Ehelosigkeit geloben. Ein
Fehltritt wurde mit dem Tode bestraft. In klösterlicher Abgeschiedenheit
das heilige Feuer im runden Tempel der Vesta, der eigentlich nichts
als die Feuerstelle enthielt, Tag und Nacht zu hüteu, war ihre vornehmste
Pflicht. Nie durfte die Flamme erlöschen, und nur am Neujahrstag wurde
sie erneuert. Aus selbstgemahlenem Speltschrot und Salz bereiteten die
Vestalinnen einen Kuchen zum Bestreuen der Opfertiere und nahmen an
den Opferungen teil. Als besonderes Zeichen der inneren Reinheit, die
auch schou iu dem züchtigen, den Körper, selbst den Hinterkopf verhüllenden
weißen Gewand und der mit sechs Flechten gezierten, sonst nur der Ehe-
frau zustehenden Haube uud dem Schleier zum Ausdruck kam, hatten sie
Wasser aus dem Quell der Egeria oder dem Tiber zu schöpfen, mußten
es auf dem Kopf Heimtragen, ohne ihre Last je in den Staub nieder-
zusetzen, und Waschungen vorzunehmen. Vor allem sollten sie das Ideal
makelloser Reinheit verkörpern. Selbst als mit dem Reichtum orientalische
Sitten, die Verweichlichung der Kultur, Laxheit, Genußsucht uudGlaubens-
losigkeit Überhandnahmen, wie kaum je und irgendwo, begegnete man
doch diesen Vertreterinnen der Sittlichkeit, weiblicher Züchtigkeit, den
Dienerinnen der Vesta, wie Stimmen des Gewissens mit höchster Achtung.
Wer sie beleidigte, war sogar dem Tode verfallen. Der Liktor ging ihnen
Platz machend voran, wenn sie mit weißer priesterlicher Binde geschmückt
durch die Straßen schritten; Verbrechern konnten sie zur Aufhebung der
Strafe, als wäre die Untat durch sie gesühnt, verhelfen, und ihre Gegen-
wart schützte vor Gewalt. Es ist zweifellos, daß mit dein Verfall dieses
Vestakultus uud der Familiensitte auch der Verfall des an äußerlichen
Machtglanz sich verlierenden römischen Weltimperiums eng verknüpft war.
Zeitgenossen Eindruck gemacht haben muß. Wenn man
im deutschen Mittelalter Wolframs hohe Gedanken
auch nicht allgemein klar erfaßte, so ist ihre Bedeutung
doch immer empfunden worden. Es ist kein Zufall,
daß man seinen Parzival schon im Jahre 1477 zu-
nächst dem Psalter und der Bibel druckte.
Bei Wolfram steht Frauentugend und Frauenehre
obenan, die Tristandichtung ist erfüllt vom Gegenteil.
Tristan lernt als Knabe weltliches Wesen kennen und
alle Künste des Truges. Parzival wächst ferue von
der Welt einsam in Einfalt heran; in seiner Natur
liegt der Trieb nach Reinheit und dem Erfassen der
Wahrheit; er kann nicht lügen. Um sinnlicher Lust
willen, um zu genießen, was die Sitte verwehrt, ver-
stricken sich Isolde und Tristan immer erneut in Un-
wahrhaftigkeit, und an einer Lüge Isoldes stirbt Tristan.
Parzioals Weg durchs Leben ist dornenvoll; um-
so mehr, als es ihm mit allem schwerer Ernst ist. Er
ist der sittlich strebende Mensch, und sein endlicher Sieg
ist der des sich redlich Mühenden, dem Treue zum
eigensten Wesen oberstes Gebot ist, von dem er wohl
einmal abirren kann, ohne das stetige Ringen darum
aufzugeben. Die Seelengeschichte Parzivals ist die
bedeutsame Entwicklungsgeschichte aller tiefer angeleg-
ten Naturen.
Der Sang von Tristan und Isolde fand und findet sich auch heute
immer in den Händen der Kinder der Welt, so lange wenigstens, als sie
sich unbekümmert ihren sinnlichen Freuden und Genüssen hingeben.
Wolfram ist eine der ehrwürdigsten Gestalten unserer Nation, er ist ein
Vorgänger Goethes und seines um die Wahrheit rastlos ringenden Faust,
des sich immer strebend bemühenden, der die endliche Erlösung aus allem
Zwiespalt dem Ringen seiner sittlichen Natur verdankt und für den
Frieden der Seele nichts von außen erhofft und erwartet. Er wendet sich
nicht ab von der Welt und empfindet sie nicht als einen Widerspruch
zum göttlichen Willen. Wolfram schildert im Parzival die Entwicklung
des inneren Lebens, die Bildungsgeschichte des Menschen in ihren Kümpfen
zwischen Zweifel und Glauben, Geist und Fleisch, Hochmut und Demut,
zwischen Leid und Freude. Im Kampfe mit der Welt geht der Mensch
rein und versöhnt hervor, der sich selber treu bleibt. Kein Zug in dieser
großen Dichtung ist lehrhaft, alles ist von echten Lebenszügen erfüllt.
Nie und nirgends wird Wolfram zum Sittenprediger. Alle seine Gestalten
sind lebendige Wesen von Fleisch und Blut. Sein Werk ist das erste,
in dem alles zum Ausdruck gelangt, was den Menschen in seinem Ringen
und Suchen mit sich und der Umgebung zum inneren Frieden, zur Er-
lösung führt, ohne der Welt zu entsagen. Die Heiligung des Lebens
erkennt Wolfram in der Erfüllung sittlicher Pflichten, er fühlt sich allem
verantwortlich und handelt danach. Parzival folgte keiner Lehre; ihn
hat das Leben erzogen. Es ist so, wie Goedeke sagt: „Wenn Wolfram
auch die Ordnung des Ganzen der Begebenheiten in seiner Parzival-
dichtung literarischen Vorgängern verdanken sollte, so bleibt doch sein
Eigentum die reinste Unschuld, seelenvollste Wärme, entschiedenste Mannes-
hoheit und der klarste Blick in das Herz und die Welt."
Was man im Parzival findet, ist Reichtum, Fülle, Tiefe
und Großartigkeit der Gedanken, edelster sittlicher Ernst,
Empfänglichkeit für alles Hohe und Reine, das innigste,
zarteste Gefühl für alle rein menschlichen Regungen
des Herzens. So steht Wolfram in vollem und be-
wußtem Gegensatz zur frivolen Zeit und der frivolen
höfischen Poesie.
Die ihm innerlich verwandten Menschen seiner
Epoche brachten dies in den schlichten Worten schön
zum Ausdruck:
„Der weise Mann von Eschenbach,
Laienmund nie besser sprach ..."
Wolfram und Gottfried von Straßburg sind in ihrer
Weltanschauung Gegner gewesen. Gottfried tadelte
und verspottete den Eschenbacher in einigen Versen.
Wolfram trug ihm den Tadel nicht nach, wie dies eine
Stelle in seiner Dichtung „Willehalm" bezeugt. Auch
das ist ein Beweis für Wolframs Stellung zu Welt
und Leben; er eiferte nicht zelotisch gegen seinen Wider-
sacher, da er zu klar wußte, was ihn innerlich von ihm
trennte. Auch darin blieb er sich selber treu, an andern
nicht zu bemäkeln, was in der Begrenzung ihres
Wesens bedingt war. Umso klarer sprach er seine
Leitgedanken im Anfang des „Parzival" aus: Die Mär, die er erneute,
handelte vou „großer Treue, vou Weiblichkeit auf rechtem Pfad, von
M annes Mannheit festund g r a d, die sich vor keiner Härte
bog". „Der Kühne, spät e r st Weise, ich seh' ihn vor mir st a r k
u n d miI d, für Weibesaug' ein süßes Bild, für Weibesherz ein sehnend
Leid, doch rein von Makel allezeit." Und gegen den Schluß
seiner großen Bekenntnisdichtung stehen die Verse: „Wes Leben so sich
endet, daß er Gott nicht entwendet die Seele durch des Leibes Schuld,
und der daneben doch die Huld der Welt mit Ehren sich erhält, der hat
sein Leben wohlbestellt." Ahnt man nun nach dem Wenigen, das hier-
gesagt werden konnte, was bei Wolfram heute noch zu finden ist? Die
lediglich sinneslustigen Kinder der Welt mögen es mit Tristan halten und
sein Schicksal teilen. Anders Gearteten wird Wolfram ein Führer sein;
umso mehr, als er kein Sittenprediger ist. Sein Welterleben ist männlich
und weltfroh. Er ist kampfbereit, aber auch gütig und duldsam. Was
der „spät erst weise" gewordene Wolfram im „Parzival" ausspricht,
entstammt nicht angelernter Klugheit oder bloßer Verstandesüberlegung.
Seine Weisheit ist nicht das Ergebnis eines der Welt entfremdeten Schwa-
chen, der hinterher das Leben schmäht, weil es ihm vermeintlich nicht hielt,
was er hoffte und ersehnte. Wolfram erwartet kein Heil von außen. Er
würde die Wahrheit der nach ihm ausgesprochenen Worte bestätigt haben:
„In deiner Brust ruhn deines Schicksals Sterne." Sich selber Treue
halten, ausharren, siegen und kämpfen mit den Gewalten der Welt macht
frei. „Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten, nimmer sich beugen, kräftig
sich zeigen, rufet die Arme der Götter herbei." Auch diese Worte Goethes
sind Geist vom Geiste Wolframs von Eschenbach.
Wolfram von Eschenbach.
Nach einer Miniatur aus der großen
Heidelberger Lkederhandschrift.
Zu unseren Bildern
Unterweisung junger Vestalinnen in der Hütung des heiligen
Herdfeuers und im zeremoniellen Schöpfen des Buellwassers für symbo-
lische Waschungen (S. 408—409).—Der Sinn für Recht, Ordnung und soziale
Gliederung ist so sehr der hervortretende Charakterzug der Römer gewesen,
daß „Römisches Recht" bis vor kurzer Zeit als Grundlage auch für deutsche
Rechtsprechung diente. Ebenso war die ethische Seite in der Religiosität
des Römers am stärksten ausgebildet, Religion mehr Sache des Verstandes
als des Gemütes und künstlerischer Gestaltungskraft. Er war fromm in
seinem privaten Leben, und Pietät, Scheu vor Pflichtverletzung waren auch
im Staatsleben ursprünglich grundlegende Eigenschaften. So fand die aus
indogermanischer Vorzeit übernommene Verehrung der V e st a, der
Schutzgöttin des Hauses und Herdes, Aufnahme und Pflege selbst bis in
Zeiten sittlicher Auflösung, glaubenslosen Verfalls. Eine Hüterin der
Ordnung und Sitte, eine Schirmerin der Familie, als der Grundlage
des Staates, als Göttin zu verehren, entsprach ganz dem religiösen Be-
dürfnis des Römers. Den Hausfrauen lag es vor allem ob, den Kult der
Vesta zu pflegen. Da sie aber zugleich auch Schirmerin staatlicher Ge-
meinschaft war, wurden seit König Numas Zeit vier, später sechs Jung-
frauen der edelsten Familien vom Pontifex Maximus zu ihrem aus-
schließlichen Dienst auserlesen. An Leib und Seele ohne Makel und
Mangel mußten die Erwählten sein. Als sechs- bis zehnjährige Mädchen
wurden sie der Ausbildung für den Vestadienst übergeben und mußten
für dreißig Jahre strengsten Lebenswandel und Ehelosigkeit geloben. Ein
Fehltritt wurde mit dem Tode bestraft. In klösterlicher Abgeschiedenheit
das heilige Feuer im runden Tempel der Vesta, der eigentlich nichts
als die Feuerstelle enthielt, Tag und Nacht zu hüteu, war ihre vornehmste
Pflicht. Nie durfte die Flamme erlöschen, und nur am Neujahrstag wurde
sie erneuert. Aus selbstgemahlenem Speltschrot und Salz bereiteten die
Vestalinnen einen Kuchen zum Bestreuen der Opfertiere und nahmen an
den Opferungen teil. Als besonderes Zeichen der inneren Reinheit, die
auch schou iu dem züchtigen, den Körper, selbst den Hinterkopf verhüllenden
weißen Gewand und der mit sechs Flechten gezierten, sonst nur der Ehe-
frau zustehenden Haube uud dem Schleier zum Ausdruck kam, hatten sie
Wasser aus dem Quell der Egeria oder dem Tiber zu schöpfen, mußten
es auf dem Kopf Heimtragen, ohne ihre Last je in den Staub nieder-
zusetzen, und Waschungen vorzunehmen. Vor allem sollten sie das Ideal
makelloser Reinheit verkörpern. Selbst als mit dem Reichtum orientalische
Sitten, die Verweichlichung der Kultur, Laxheit, Genußsucht uudGlaubens-
losigkeit Überhandnahmen, wie kaum je und irgendwo, begegnete man
doch diesen Vertreterinnen der Sittlichkeit, weiblicher Züchtigkeit, den
Dienerinnen der Vesta, wie Stimmen des Gewissens mit höchster Achtung.
Wer sie beleidigte, war sogar dem Tode verfallen. Der Liktor ging ihnen
Platz machend voran, wenn sie mit weißer priesterlicher Binde geschmückt
durch die Straßen schritten; Verbrechern konnten sie zur Aufhebung der
Strafe, als wäre die Untat durch sie gesühnt, verhelfen, und ihre Gegen-
wart schützte vor Gewalt. Es ist zweifellos, daß mit dein Verfall dieses
Vestakultus uud der Familiensitte auch der Verfall des an äußerlichen
Machtglanz sich verlierenden römischen Weltimperiums eng verknüpft war.