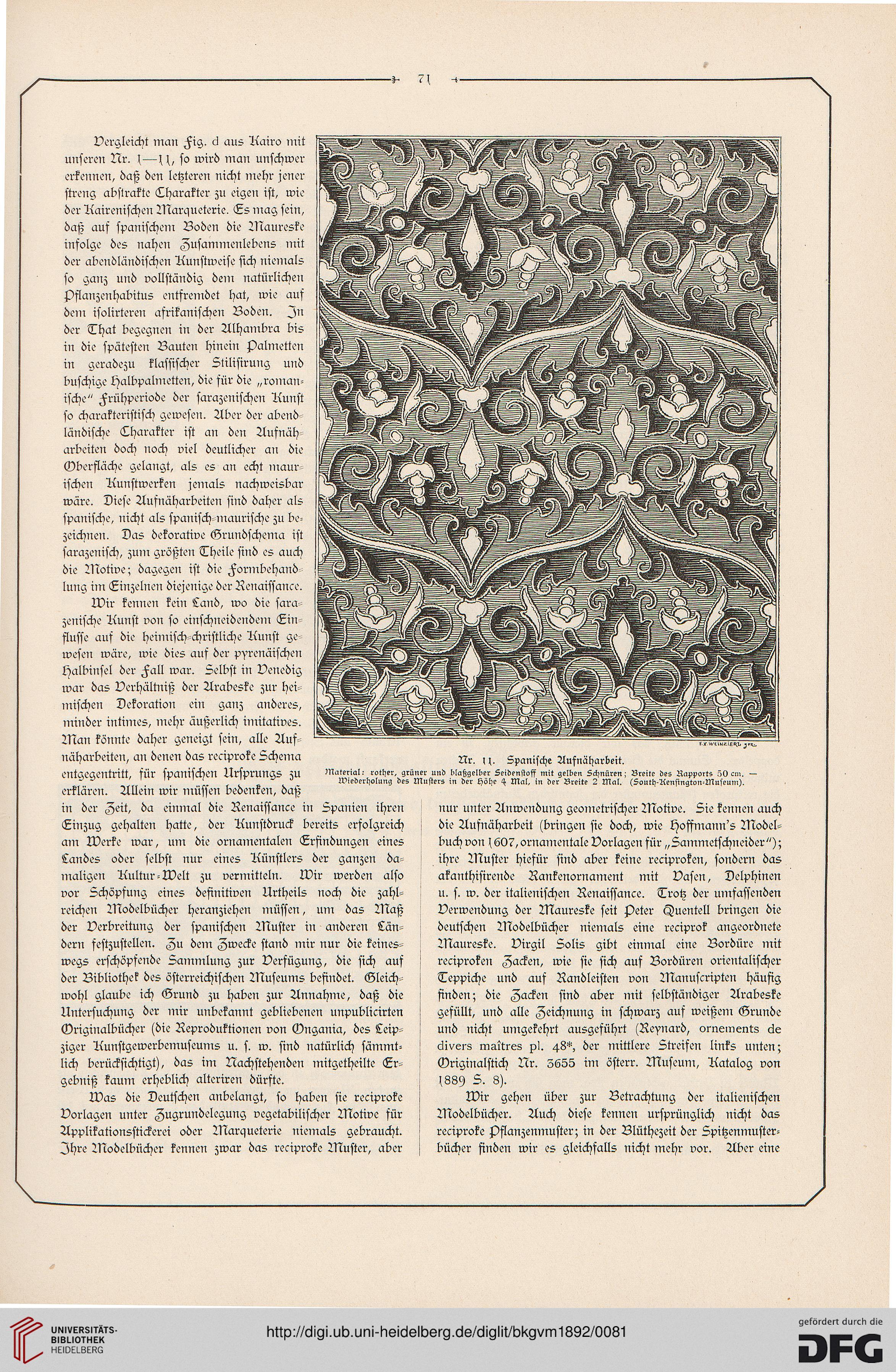f-X WEiNr.iE^l,
Nr. \ \. Spanische Aufnäharbeit.
Material: rother, grüner und blaßgelber Seidenstoff mit gelben Schnüren; Breite des Rapports 50 cm. —
Wiederholung des Musters in der höbe $ Mal, in der Breite 2 Mal. (South-Aensington-Museum).
Vergleicht man Fig. 6 aus Kairo mit
unseren Nr. s—so wird man unschwer
erkennen, daß den letzteren nicht mehr jener
streng abstrakte Eharakter zu eigen ist, wie
der Kairenischen Marqueterie. Es mag sein,
daß aus spanischem Boden die Maureske
insolge des nahen Zusammenlebens mit
der abendländischen Kunstweise sich niemals
so ganz und vollständig dein natürlichen
Pflanzenhabitus entfremdet hat, wie aus
dem isolirteren afrikanischen Boden, In
der Thal begegnen in der Alhambra bis
in die spätesten Bauten hinein Palmetten
in geradezu klassischer Stilisirung und
buschige chalbpalmetten, die für die „roman-
ische" Frühperiode der sarazenischen Kunst
so charakteristisch gewesen. Aber der abend-
ländische Eharakter ist an den Aufnäh-
arbeiten doch noch viel deutlicher an die
Mberfläche gelangt, als es an echt maur-
ischen Kunstwerken jemals nachweisbar
wäre. Diese Aufnäharbeiten sind daher als
spanische, nicht als spanisch-maurische zu be-
zeichnen. Das dekorative Grundschema ist
sarazenisch, zum größten Theile sind es auch
die Motive; dagegen ist die Formbehand
lung iin Einzelnen diejenige der Renaissance.
Wir kennen kein Land, wo die sara-
zenische Kunst von so einschneidendem Ein
flusse aus die heimisch-christliche Kunst ge-
wesen wäre, wie dies auf der pyrenäischen
Halbinsel der Fall war. Selbst in Venedig
war das Verhältnis; der Arabeske zur hei-
inischen Dekoration ein ganz anderes,
minder intimes, inehr äußerlich imitatives.
Man könnte daher geneigt sein, alle Auf-
näharbeiten, an denen das reciproke Schema
entgegentritt, für spanischen Ursprungs zu
erklären. Allein wir müssen bedenken, daß
in der Zeit, da einmal die Renaissance in Spanien ihren
Einzug gehalten hatte, der Kunstdruck bereits erfolgreich
am Werke war, um die ornamentalen Erfindungen eines
Landes oder selbst nur eines Künstlers der ganzen da
maligen Kultur-Welt zu vermitteln. Wir werden also
vor Schöpfung eines definitiven Urtheils noch die zahl-
reichen Modelbücher heranziehen müssen, um das Maß
der Verbreitung der spanischen Muster in anderen Län
dern festzustellen. Zu dem Zwecke stand inir nur die keines-
wegs erschöpfende Sammlung zur Verfügung, die sich auf
der Bibliothek des österreichischen Museums befindet. Gleich
wohl glaube ich Grund zu haben zur Annahme, daß die
Untersuchung der mir unbekannt gebliebenen unpublicirten
Griginalbücher (die Reproduktionen von Vngania, des Leip
ziger Kunstgewerbemuseums u. s. w. sind natürlich sämmt-
lich berücksichtigt), das im Nachstehenden mitgetheilte Er-
gcbniß kann; erheblich alteriren dürste.
Was die Deutschen anbelangt, so haben sie reciproke
Vorlagen unter Zugrundelegung vegetabilischer Motive für
Applikationsstickerei oder Marqueterie niemals gebraucht.
Ihre Modelbücher kennen zwar das reciproke Muster, aber
nur unter Anwendung geometrischer Motive. Sie kennen auch
die Aufnäharbeit (bringen sie doch, wie poffmann's Model-
buch von f 607, ornamentale Vorlagen für „Sammetschneider");
ihre Muster hiefür sind aber keine reciproken, sondern das
akanthisirende Rankenornament mit Vasen, Delphinen
u. s. w. der italienischen Renaissance. Trotz der umfassenden
Verwendung der Maureske seit Peter Quentel! bringen die
deutschen Modelbücher niemals eine reciprok angeordnete
Maureske. Virgil Solls gibt einmal eine Bordüre mit
reciproken Zacken, wie sie sich auf Bordüren orientalischer
Teppiche und auf Randleisten von Manuscripten häufig
finden; die Zacken sind aber mit selbständiger Arabeske
gefüllt, und alle Zeichnung in schwarz aus weißem Grunde
und nicht umgekehrt ausgeführt (Reynard, ornements de
divers maitres pl. 48*, der mittlere Streifen links unten;
Vriginalstich Nr. 5655 im österr. Museum, Katalog von
1889 S. 8).
Wir gehen über zur Betrachtung der italienischen
Modelbücher. Auch diese kennen ursprünglich nicht das
reciproke Pflanzenmuster; in der Blüthezeit der Spitzenmuster-
bücher finden wir cs gleichfalls nicht mehr vor. Aber eine
Nr. \ \. Spanische Aufnäharbeit.
Material: rother, grüner und blaßgelber Seidenstoff mit gelben Schnüren; Breite des Rapports 50 cm. —
Wiederholung des Musters in der höbe $ Mal, in der Breite 2 Mal. (South-Aensington-Museum).
Vergleicht man Fig. 6 aus Kairo mit
unseren Nr. s—so wird man unschwer
erkennen, daß den letzteren nicht mehr jener
streng abstrakte Eharakter zu eigen ist, wie
der Kairenischen Marqueterie. Es mag sein,
daß aus spanischem Boden die Maureske
insolge des nahen Zusammenlebens mit
der abendländischen Kunstweise sich niemals
so ganz und vollständig dein natürlichen
Pflanzenhabitus entfremdet hat, wie aus
dem isolirteren afrikanischen Boden, In
der Thal begegnen in der Alhambra bis
in die spätesten Bauten hinein Palmetten
in geradezu klassischer Stilisirung und
buschige chalbpalmetten, die für die „roman-
ische" Frühperiode der sarazenischen Kunst
so charakteristisch gewesen. Aber der abend-
ländische Eharakter ist an den Aufnäh-
arbeiten doch noch viel deutlicher an die
Mberfläche gelangt, als es an echt maur-
ischen Kunstwerken jemals nachweisbar
wäre. Diese Aufnäharbeiten sind daher als
spanische, nicht als spanisch-maurische zu be-
zeichnen. Das dekorative Grundschema ist
sarazenisch, zum größten Theile sind es auch
die Motive; dagegen ist die Formbehand
lung iin Einzelnen diejenige der Renaissance.
Wir kennen kein Land, wo die sara-
zenische Kunst von so einschneidendem Ein
flusse aus die heimisch-christliche Kunst ge-
wesen wäre, wie dies auf der pyrenäischen
Halbinsel der Fall war. Selbst in Venedig
war das Verhältnis; der Arabeske zur hei-
inischen Dekoration ein ganz anderes,
minder intimes, inehr äußerlich imitatives.
Man könnte daher geneigt sein, alle Auf-
näharbeiten, an denen das reciproke Schema
entgegentritt, für spanischen Ursprungs zu
erklären. Allein wir müssen bedenken, daß
in der Zeit, da einmal die Renaissance in Spanien ihren
Einzug gehalten hatte, der Kunstdruck bereits erfolgreich
am Werke war, um die ornamentalen Erfindungen eines
Landes oder selbst nur eines Künstlers der ganzen da
maligen Kultur-Welt zu vermitteln. Wir werden also
vor Schöpfung eines definitiven Urtheils noch die zahl-
reichen Modelbücher heranziehen müssen, um das Maß
der Verbreitung der spanischen Muster in anderen Län
dern festzustellen. Zu dem Zwecke stand inir nur die keines-
wegs erschöpfende Sammlung zur Verfügung, die sich auf
der Bibliothek des österreichischen Museums befindet. Gleich
wohl glaube ich Grund zu haben zur Annahme, daß die
Untersuchung der mir unbekannt gebliebenen unpublicirten
Griginalbücher (die Reproduktionen von Vngania, des Leip
ziger Kunstgewerbemuseums u. s. w. sind natürlich sämmt-
lich berücksichtigt), das im Nachstehenden mitgetheilte Er-
gcbniß kann; erheblich alteriren dürste.
Was die Deutschen anbelangt, so haben sie reciproke
Vorlagen unter Zugrundelegung vegetabilischer Motive für
Applikationsstickerei oder Marqueterie niemals gebraucht.
Ihre Modelbücher kennen zwar das reciproke Muster, aber
nur unter Anwendung geometrischer Motive. Sie kennen auch
die Aufnäharbeit (bringen sie doch, wie poffmann's Model-
buch von f 607, ornamentale Vorlagen für „Sammetschneider");
ihre Muster hiefür sind aber keine reciproken, sondern das
akanthisirende Rankenornament mit Vasen, Delphinen
u. s. w. der italienischen Renaissance. Trotz der umfassenden
Verwendung der Maureske seit Peter Quentel! bringen die
deutschen Modelbücher niemals eine reciprok angeordnete
Maureske. Virgil Solls gibt einmal eine Bordüre mit
reciproken Zacken, wie sie sich auf Bordüren orientalischer
Teppiche und auf Randleisten von Manuscripten häufig
finden; die Zacken sind aber mit selbständiger Arabeske
gefüllt, und alle Zeichnung in schwarz aus weißem Grunde
und nicht umgekehrt ausgeführt (Reynard, ornements de
divers maitres pl. 48*, der mittlere Streifen links unten;
Vriginalstich Nr. 5655 im österr. Museum, Katalog von
1889 S. 8).
Wir gehen über zur Betrachtung der italienischen
Modelbücher. Auch diese kennen ursprünglich nicht das
reciproke Pflanzenmuster; in der Blüthezeit der Spitzenmuster-
bücher finden wir cs gleichfalls nicht mehr vor. Aber eine