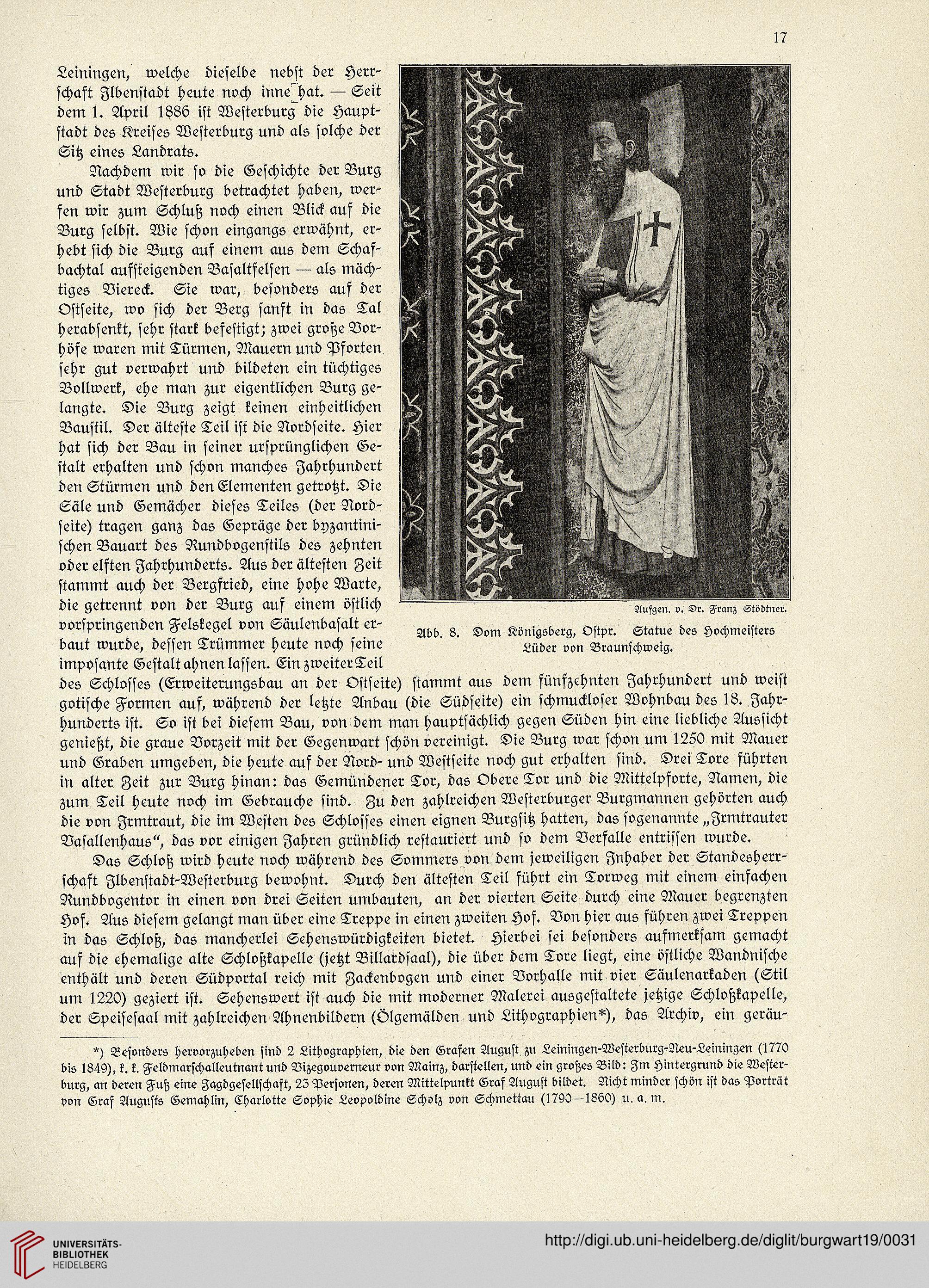17
Leiningen, welche dieselbe nebst der Herr-
schaft Ilbenstadt heute noch inne hat. — Seit
dem 1. April 1886 ist Westerburg die Haupt-
stadt des Kreises Westerburg und als solche der
Sitz eines Landrats.
Nachdem wir so die Geschichte der Burg
und Stadt Westerburg betrachtet haben, wer-
fen wir zum Schluß noch einen Blick auf die
Burg selbst. Wie schon eingangs erwähnt, er-
hebt sich die Burg auf einem aus dem Schaf-
bachtal aufsteigenden Basaltfelsen — als mäch-
tiges Viereck. Sie war, besonders auf der
Ostseite, wo sich der Berg sanft in das Tal
herabsenkt, sehr stark befestigt; zwei große Vor-
höfe waren mit Türmen, Mauern und Pforten
sehr gut verwahrt und bildeten ein tüchtiges
Bollwerk, che man zur eigentlichen Burg ge-
langte. Die Burg zeigt keinen einheitlichen
Baustil. Der älteste Teil ist die Nordseite. Hier
hat sich der Bau in seiner ursprünglichen Ge-
stalt erhalten und schon manches Jahrhundert
den Stürmen und den Elementen getrotzt. Die
Säle und Gemächer dieses Teiles (der Nord-
seite) tragen ganz das Gepräge der byzantini-
schen Bauart des Nundbogenstils des zehnten
oder elften Jahrhunderts. Aus der ältesten Zeit
stammt auch der Bergfried, eine hohe Warte,
die getrennt von der Burg auf einem östlich
vorspringendcn Felskegel von Säulenbasalt er-
baut wurde, dessen Trümmer heute noch seine
imposante Gestalt ahnen lassen. Ein zweiter Teil
des Schlosses (Erweiterungsbau an der Ostseite) stammt aus dem fünfzehnten Jahrhundert und weist
gotische Formen auf, während der letzte Anbau (die Südseite) ein schmuckloser Wohnbau des 18. Jahr-
hunderts ist. So ist bei diesem Bau, von dem man hauptsächlich gegen Süden hin eine liebliche Aussicht
genießt, die graue Vorzeit mit der Gegenwart schön vereinigt. Die Burg war schon um 1250 mit Mauer
und Graben umgeben, die heute auf der Nord- und Westseite noch gut erhalten sind. Drei Tore führten
in alter Zeit zur Burg hinan: das Gemündener Tor, das Obere Tor und die Mittelpforte, Namen, die
zum Teil heute noch im Gebrauche sind. Zu den zahlreichen Westerburger Burgmannen gehörten auch
die von Irmtraut, die im Westen des Schlosses einen eignen Burgsitz hatten, das sogenannte „Irmtrauter
Vasallenhaus", das vor einigen Jahren gründlich restauriert und so dein Verfalle entrissen wurde.
Das Schloß wird heute noch während des Sommers von dem jeweiligen Inhaber der Standesherr-
schaft Ilbenstadt-Westerburg bewohnt. Durch den ältesten Teil führt ein Torweg mit einem einfachen
Rundbogentor in einen von drei Seiten umbauten, an der vierten Seite durch eine Mauer begrenzten
Hof. Aus diesem gelangt man über eine Treppe in einen zweiten Hof. Von hier aus führen zwei Treppen
in das Schloß, das mancherlei Sehenswürdigkeiten bietet. Hierbei sei besonders aufmerksam gemacht
auf die ehemalige alte Schloßkapelle (jetzt Billardsaal), die über dem Tore liegt, eine östliche Wandnische
enthält und deren Südportal reich mit Zackenbogen und einer Vorhalle mit vier Säulenarkaden (Stil
um 1220) geziert ist. Sehenswert ist auch die mit moderner Malerei ausgestaltete jetzige Schloßkapelle,
der Speisesaal mit zahlreichen Ahnenbildcrn (Ölgemälden und Lithographien*), das Archiv, ein geräu-
H Besonders hervorzuheben sind 2 Lithographien, die den Grafen August zu Leiningen-Westerburg-Neu-Leiningen (1770
bis 1849), k. k. Feldmarschalleutnant und Vizegouverneur von Mainz, darstellen, und ein großes Bild: Am Hintergrund die Wester-
burg, an deren Fuß eine Jagdgesellschaft, 23 Personen, deren Mittelpunkt Gras August bildet. Nicht minder schön ist das Porträt
von Graf Augusts Gemahlin, Charlotte Sophie Leopoldine Scholz von Schmettau (1792—1860) u. a. m.
Leiningen, welche dieselbe nebst der Herr-
schaft Ilbenstadt heute noch inne hat. — Seit
dem 1. April 1886 ist Westerburg die Haupt-
stadt des Kreises Westerburg und als solche der
Sitz eines Landrats.
Nachdem wir so die Geschichte der Burg
und Stadt Westerburg betrachtet haben, wer-
fen wir zum Schluß noch einen Blick auf die
Burg selbst. Wie schon eingangs erwähnt, er-
hebt sich die Burg auf einem aus dem Schaf-
bachtal aufsteigenden Basaltfelsen — als mäch-
tiges Viereck. Sie war, besonders auf der
Ostseite, wo sich der Berg sanft in das Tal
herabsenkt, sehr stark befestigt; zwei große Vor-
höfe waren mit Türmen, Mauern und Pforten
sehr gut verwahrt und bildeten ein tüchtiges
Bollwerk, che man zur eigentlichen Burg ge-
langte. Die Burg zeigt keinen einheitlichen
Baustil. Der älteste Teil ist die Nordseite. Hier
hat sich der Bau in seiner ursprünglichen Ge-
stalt erhalten und schon manches Jahrhundert
den Stürmen und den Elementen getrotzt. Die
Säle und Gemächer dieses Teiles (der Nord-
seite) tragen ganz das Gepräge der byzantini-
schen Bauart des Nundbogenstils des zehnten
oder elften Jahrhunderts. Aus der ältesten Zeit
stammt auch der Bergfried, eine hohe Warte,
die getrennt von der Burg auf einem östlich
vorspringendcn Felskegel von Säulenbasalt er-
baut wurde, dessen Trümmer heute noch seine
imposante Gestalt ahnen lassen. Ein zweiter Teil
des Schlosses (Erweiterungsbau an der Ostseite) stammt aus dem fünfzehnten Jahrhundert und weist
gotische Formen auf, während der letzte Anbau (die Südseite) ein schmuckloser Wohnbau des 18. Jahr-
hunderts ist. So ist bei diesem Bau, von dem man hauptsächlich gegen Süden hin eine liebliche Aussicht
genießt, die graue Vorzeit mit der Gegenwart schön vereinigt. Die Burg war schon um 1250 mit Mauer
und Graben umgeben, die heute auf der Nord- und Westseite noch gut erhalten sind. Drei Tore führten
in alter Zeit zur Burg hinan: das Gemündener Tor, das Obere Tor und die Mittelpforte, Namen, die
zum Teil heute noch im Gebrauche sind. Zu den zahlreichen Westerburger Burgmannen gehörten auch
die von Irmtraut, die im Westen des Schlosses einen eignen Burgsitz hatten, das sogenannte „Irmtrauter
Vasallenhaus", das vor einigen Jahren gründlich restauriert und so dein Verfalle entrissen wurde.
Das Schloß wird heute noch während des Sommers von dem jeweiligen Inhaber der Standesherr-
schaft Ilbenstadt-Westerburg bewohnt. Durch den ältesten Teil führt ein Torweg mit einem einfachen
Rundbogentor in einen von drei Seiten umbauten, an der vierten Seite durch eine Mauer begrenzten
Hof. Aus diesem gelangt man über eine Treppe in einen zweiten Hof. Von hier aus führen zwei Treppen
in das Schloß, das mancherlei Sehenswürdigkeiten bietet. Hierbei sei besonders aufmerksam gemacht
auf die ehemalige alte Schloßkapelle (jetzt Billardsaal), die über dem Tore liegt, eine östliche Wandnische
enthält und deren Südportal reich mit Zackenbogen und einer Vorhalle mit vier Säulenarkaden (Stil
um 1220) geziert ist. Sehenswert ist auch die mit moderner Malerei ausgestaltete jetzige Schloßkapelle,
der Speisesaal mit zahlreichen Ahnenbildcrn (Ölgemälden und Lithographien*), das Archiv, ein geräu-
H Besonders hervorzuheben sind 2 Lithographien, die den Grafen August zu Leiningen-Westerburg-Neu-Leiningen (1770
bis 1849), k. k. Feldmarschalleutnant und Vizegouverneur von Mainz, darstellen, und ein großes Bild: Am Hintergrund die Wester-
burg, an deren Fuß eine Jagdgesellschaft, 23 Personen, deren Mittelpunkt Gras August bildet. Nicht minder schön ist das Porträt
von Graf Augusts Gemahlin, Charlotte Sophie Leopoldine Scholz von Schmettau (1792—1860) u. a. m.