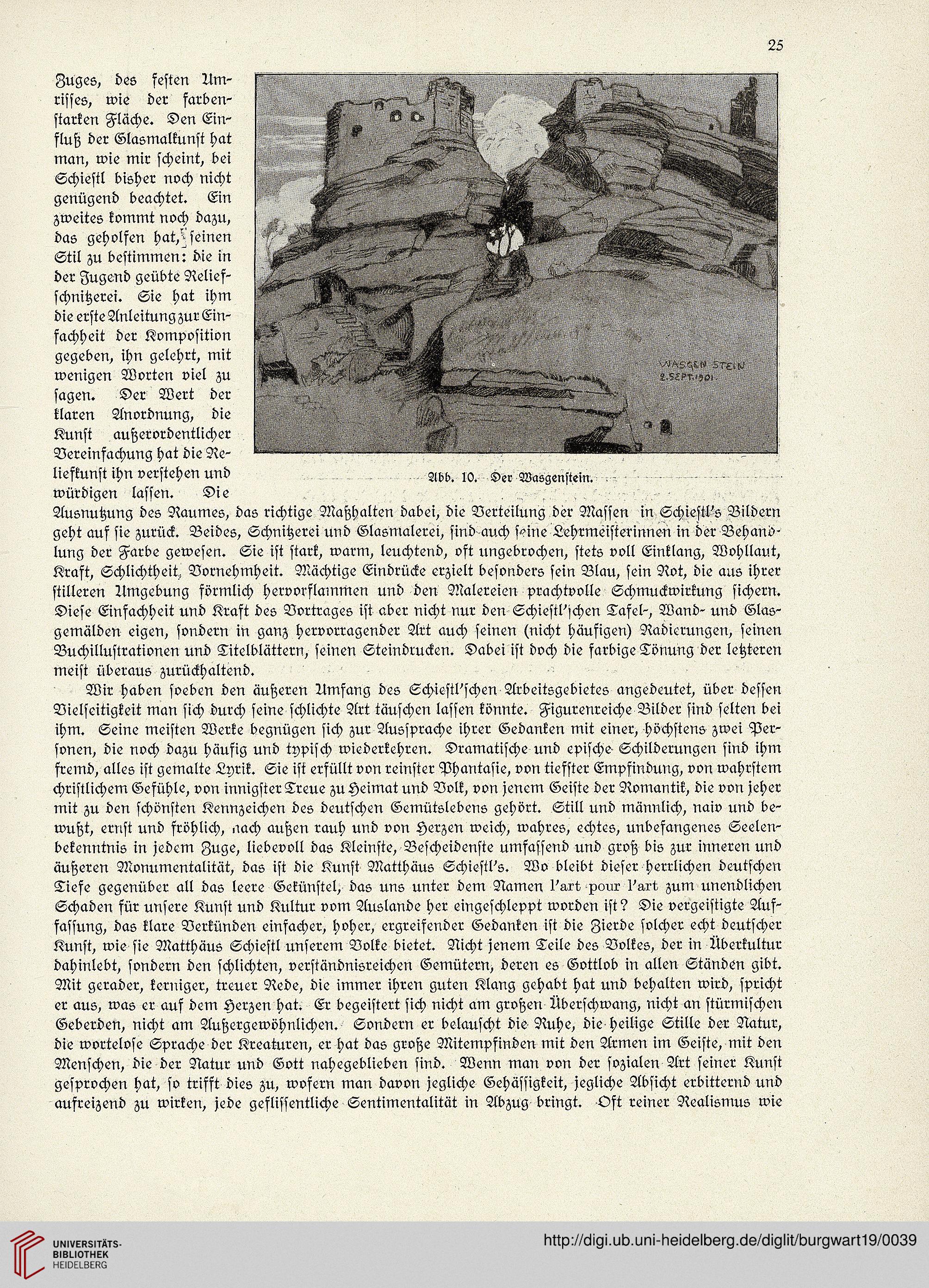25
Zuges, des festen Um-
risses, wie der farben-
starken Fläche. Den Ein-
fluß der Glasmalkunst hat
man, wie mir scheint, bei
Schiestl bisher noch nicht
genügend beachtet. Ein
zweites kommt noch dazu,
das geholfen hat/ seinen
Stil zu bestimmen: die in
der Jugend geübte Relief-
schnitzerei. Sie hat ihm
die erste Anleitung zur Ein-
fachheit der Komposition
gegeben, ihn gelehrt, mit
wenigen Worten viel zu
sagen. Der Wert der
klaren Anordnung, die
Kunst außerordentlicher
Vereinfachung hat die Re-
liefkunst ihn verstehen und Abb. 10. Der Wasgenstein.
würdigen lassen. Die
Ausnutzung des Raumes, das richtige Maßhalten dabei, die Verteilung der Massen in Schiestbs Bildern
geht auf sie zurück. Beides, Schnitzerei und Glasmalerei, sind auch seine Lehrmeisterinnen in der Behand-
lung der Farbe gewesen. Sie ist stark, warm, leuchtend, oft ungebrochen, stets voll Einklang, Wohllaut,
Kraft, Schlichtheit, Vornehmheit. Mächtige Eindrücke erzielt besonders sein Blau, sein Rot, die aus ihrer
stilleren Umgebung förmlich hervorflammen und den Malereien prachtvolle Schmuckwirkung sichern.
Diese Einfachheit und Kraft des Vortrages ist aber nicht nur den Schiestbschen Tafel-, Wand- und Glas-
gemälden eigen, sondern in ganz hervorragender Art auch seinen (nicht häufigen) Radierungen, seinen
Buchillustrationen und Titelblättern, seinen Steindrucken. Dabei ist doch die farbige Tönung der letzteren
meist überaus zurückhaltend.
Wir haben soeben den äußeren Umfang des Schiestbschen Arbeitsgebietes angedcutet, über dessen
Vielseitigkeit man sich durch seine schlichte Art täuschen lassen könnte. Figurenreiche Bilder sind selten bei
ihm. Seine meisten Werke begnügen sich zur Aussprache ihrer Gedanken mit einer, höchstens zwei Per-
sonen, die noch dazu häufig und typisch wiederkchren. Dramatische und epische Schilderungen sind ihm
fremd, alles ist gemalte Lyrik. Sie ist erfüllt von reinster Phantasie, von tiefster Empfindung, von wahrstem
christlichem Gefühle, von innigster Treue zu Heimat und Volk, von jenem Geiste der Romantik, die von jeher
mit zu den schönsten Kennzeichen des deutschen Gemütslebens gehört. Still und männlich, naiv und be-
wußt, ernst und fröhlich, nach außen rauh und von Herzen weich, wahres, echtes, unbefangenes Seelen-
bekenntnis in jedem Zuge, liebevoll das Kleinste, Bescheidenste umfassend und groß bis zur inneren und
äußeren Monumentalität, das ist die Kunst Matthäus SchiestLs. Wo bleibt dieser herrlichen deutschen
Tiefe gegenüber all das leere Gekünstel, das uns unter dem Namen ponr Ht zum unendlichen
Schaden für unsere Kunst und Kultur vom Auslande her eingeschleppt worden ist? Die vergeistigte Auf-
fassung, das klare Verkünden einfacher, hoher, ergreifender Gedanken ist die Zierde solcher echt deutscher
Kunst, wie sie Matthäus Schiestl unserem Volke bietet. Nicht jenem Teile des Volkes, der in Äberkultur
dahinlebt, sondern den schlichten, verständnisreichen Gemütern, deren es Gottlob in allen Stünden gibt.
Mit gerader, kerniger, treuer Rede, die immer ihren guten Klang gehabt hat und behalten wird, spricht
er aus, was er auf dem Herzen hat. Er begeistert sich nicht am großer: Überschwang, nicht an stürmischen
Geberden, nicht am Außergewöhnlichen. Sondern er belauscht die Ruhe, die heilige Stille der Natur,
die wortelose Sprache der Kreaturen, er hat das große Mitempfinden mit den Armen im Geiste, mit den
Menschen, die der Natur und Gott nahegeblieben sind. Wenn man von der sozialen Art seiner Kunst
gesprochen hat, so trifft dies zu, wofern mm: davon jegliche Gehässigkeit, jegliche Absicht erbitternd und
aufreizend zu wirken, jede geflissentliche Sentimentalität in Abzug bringt. Ost reiner Realismus wie
Zuges, des festen Um-
risses, wie der farben-
starken Fläche. Den Ein-
fluß der Glasmalkunst hat
man, wie mir scheint, bei
Schiestl bisher noch nicht
genügend beachtet. Ein
zweites kommt noch dazu,
das geholfen hat/ seinen
Stil zu bestimmen: die in
der Jugend geübte Relief-
schnitzerei. Sie hat ihm
die erste Anleitung zur Ein-
fachheit der Komposition
gegeben, ihn gelehrt, mit
wenigen Worten viel zu
sagen. Der Wert der
klaren Anordnung, die
Kunst außerordentlicher
Vereinfachung hat die Re-
liefkunst ihn verstehen und Abb. 10. Der Wasgenstein.
würdigen lassen. Die
Ausnutzung des Raumes, das richtige Maßhalten dabei, die Verteilung der Massen in Schiestbs Bildern
geht auf sie zurück. Beides, Schnitzerei und Glasmalerei, sind auch seine Lehrmeisterinnen in der Behand-
lung der Farbe gewesen. Sie ist stark, warm, leuchtend, oft ungebrochen, stets voll Einklang, Wohllaut,
Kraft, Schlichtheit, Vornehmheit. Mächtige Eindrücke erzielt besonders sein Blau, sein Rot, die aus ihrer
stilleren Umgebung förmlich hervorflammen und den Malereien prachtvolle Schmuckwirkung sichern.
Diese Einfachheit und Kraft des Vortrages ist aber nicht nur den Schiestbschen Tafel-, Wand- und Glas-
gemälden eigen, sondern in ganz hervorragender Art auch seinen (nicht häufigen) Radierungen, seinen
Buchillustrationen und Titelblättern, seinen Steindrucken. Dabei ist doch die farbige Tönung der letzteren
meist überaus zurückhaltend.
Wir haben soeben den äußeren Umfang des Schiestbschen Arbeitsgebietes angedcutet, über dessen
Vielseitigkeit man sich durch seine schlichte Art täuschen lassen könnte. Figurenreiche Bilder sind selten bei
ihm. Seine meisten Werke begnügen sich zur Aussprache ihrer Gedanken mit einer, höchstens zwei Per-
sonen, die noch dazu häufig und typisch wiederkchren. Dramatische und epische Schilderungen sind ihm
fremd, alles ist gemalte Lyrik. Sie ist erfüllt von reinster Phantasie, von tiefster Empfindung, von wahrstem
christlichem Gefühle, von innigster Treue zu Heimat und Volk, von jenem Geiste der Romantik, die von jeher
mit zu den schönsten Kennzeichen des deutschen Gemütslebens gehört. Still und männlich, naiv und be-
wußt, ernst und fröhlich, nach außen rauh und von Herzen weich, wahres, echtes, unbefangenes Seelen-
bekenntnis in jedem Zuge, liebevoll das Kleinste, Bescheidenste umfassend und groß bis zur inneren und
äußeren Monumentalität, das ist die Kunst Matthäus SchiestLs. Wo bleibt dieser herrlichen deutschen
Tiefe gegenüber all das leere Gekünstel, das uns unter dem Namen ponr Ht zum unendlichen
Schaden für unsere Kunst und Kultur vom Auslande her eingeschleppt worden ist? Die vergeistigte Auf-
fassung, das klare Verkünden einfacher, hoher, ergreifender Gedanken ist die Zierde solcher echt deutscher
Kunst, wie sie Matthäus Schiestl unserem Volke bietet. Nicht jenem Teile des Volkes, der in Äberkultur
dahinlebt, sondern den schlichten, verständnisreichen Gemütern, deren es Gottlob in allen Stünden gibt.
Mit gerader, kerniger, treuer Rede, die immer ihren guten Klang gehabt hat und behalten wird, spricht
er aus, was er auf dem Herzen hat. Er begeistert sich nicht am großer: Überschwang, nicht an stürmischen
Geberden, nicht am Außergewöhnlichen. Sondern er belauscht die Ruhe, die heilige Stille der Natur,
die wortelose Sprache der Kreaturen, er hat das große Mitempfinden mit den Armen im Geiste, mit den
Menschen, die der Natur und Gott nahegeblieben sind. Wenn man von der sozialen Art seiner Kunst
gesprochen hat, so trifft dies zu, wofern mm: davon jegliche Gehässigkeit, jegliche Absicht erbitternd und
aufreizend zu wirken, jede geflissentliche Sentimentalität in Abzug bringt. Ost reiner Realismus wie