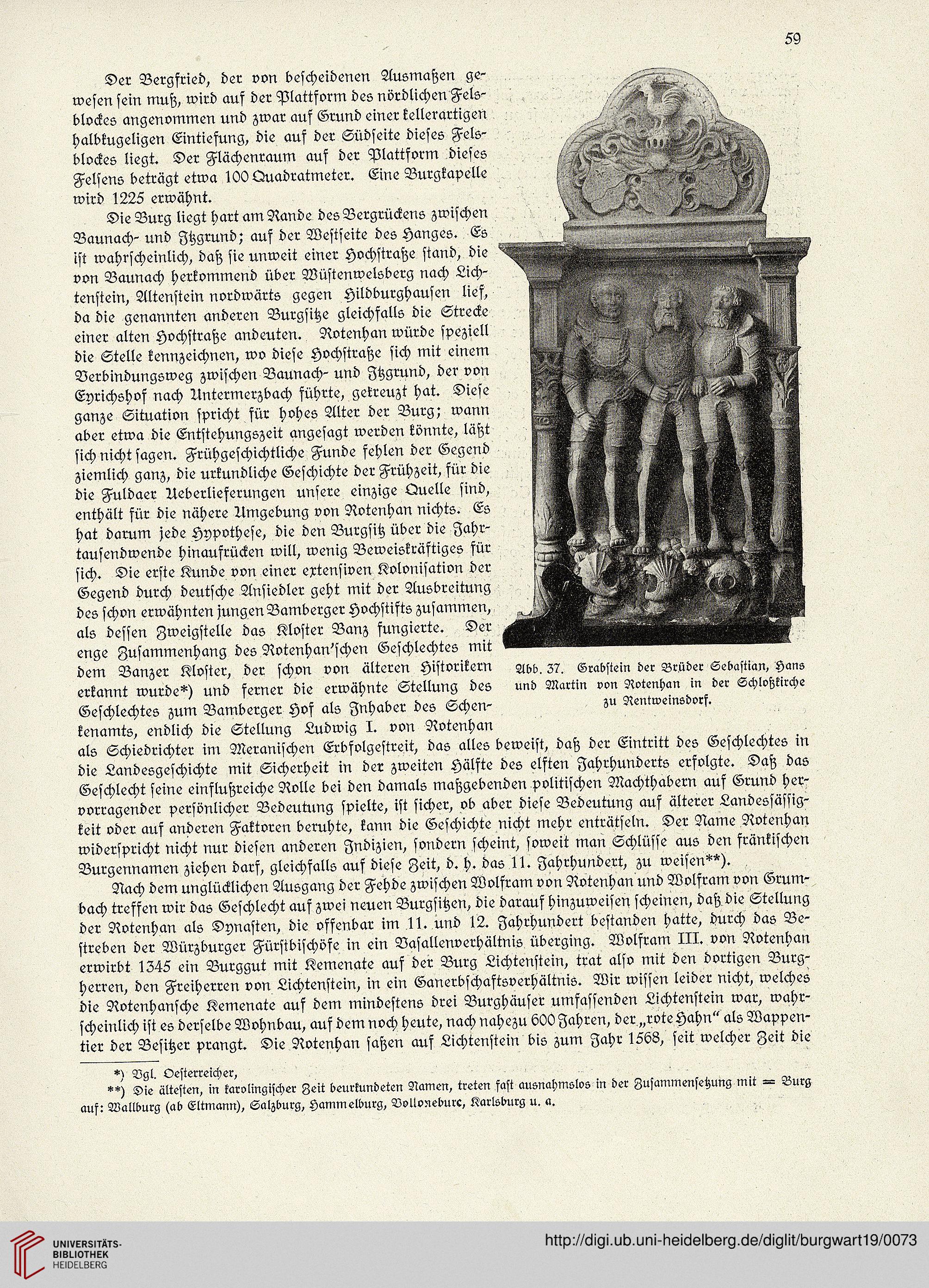5d
Der Bergfried, der von bescheidenen Ausmaßen ge-
wesen sein muß, wird auf der Plattform des nördlichen Fels-
blockcs angenommen und zwar auf Grund einer kellerartigen
halbkugeligen Eintiefung, die aus der Südseite dieses Fels-
blockes liegt. Der Flächenraum auf der Plattform dieses
Felsens beträgt etwa 100 Quadratmeter. Eine Burgkapelle
wird 1225 erwähnt.
Die Burg liegt hart am Rande des Bergrückens zwischen
Baunach- und Itzgrund; auf der Westseite des Hanges. Es
ist wahrscheinlich, daß sie unweit einer Hochstraße stand, die
von Baunach herkommend über Wüstenwelsberg nach Lich-
tenstein, Altenstein nordwärts gegen Hildburghausen lief,
da die genannten anderen Burgsihe gleichfalls die Strecke
einer alten Hochstraße andeuten. Rotenhan würde speziell
die Stelle kennzeichnen, wo diese Hochstraße sich mit einem
Verbindungsweg zwischen Baunach- und Itzgrund, der von
Eyrichshof nach Antermerzbach führte, gekreuzt hat. Diese
ganze Situation spricht für hohes Alter der Burg; wann
aber etwa die Entstehungszeit angesagt werden könnte, läßt
sich nicht sagen. Frühgeschichtliche Funde fehlen der Gegend
ziemlich ganz, die urkundliche Geschichte der Frühzeit, für die
die Fuldaer Aeberliefcrungen unsere einzige Quelle sind,
enthält für die nähere Umgebung von Rotenhan nichts. Es
hat darum jede Hypothese, die den Burgsitz über die Iahr-
tausendwende Hinaufrücken will, wenig Beweiskräftiges für
sich. Die erste Kunde von einer extensiven Kolonisation der
Gegend durch deutsche Ansiedler geht mit der Ausbreitung
des schon erwähnten jungen Bamberger Hochstifts zusammen,
als dessen Zweigstelle das Kloster Banz fungierte. Der
enge Zusammenhang des Rotenhantz'chen Geschlechtes mit
dem Ganzer Kloster, der schon von älteren Historikern Mb. 37. Grabstein der Brüder Sebastian, Hans
erkannt wurde*) und ferner die erwähnte Stellung des und Martin von Rotenhan in der Schloßkirche
Geschlechtes zum Bamberger Hof als Inhaber des Schen- Su Nentweinsdorf.
kenamts, endlich die Stellung Ludwig I. von Rotenhan
als Schiedrichter im Meranischen Erbfolgestreit, das alles beweist, daß der Eintritt des Geschlechtes in
die Landesgeschichte mit Sicherheit in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts erfolgte. Daß das
Geschlecht seine einflußreiche Rolle bei den damals maßgebenden politischen Machthabern auf Grund her-
vorragender persönlicher Bedeutung spielte, ist sicher, ob aber diese Bedeutung auf älterer Landessässig-
keit oder auf anderen Faktoren beruhte, kann die Geschichte nicht mehr enträtseln. Der Name Rotenhan
widerspricht nicht nur diesen anderen Indizien, sondern scheint, soweit man Schlüsse aus den fränkischen
Burgennamen ziehen darf, gleichfalls auf diese Zeit, d. h. das 11. Jahrhundert, zu weisen**).
Nach dem unglücklichen Ausgang der Fehde zwischen Wolfram von Rotenhan und Wolfram von Grum-
bach treffen wir das Geschlecht auf zwei neuen Burgsitzcn, die darauf hinzuweisen scheinen, daß die Stellung
der Rotenhan als Dynasten, die offenbar im 11. und 12. Jahrhundert bestanden hatte, durch das Be-
streben der Würzburger Fürstbischöfe in ein Vasallenverhältnis überging. Wolfram III. von Rotenhan
erwirbt 1345 ein Burggut mit Kemenate auf der Burg Lichtenstein, trat also mit den dortigen Burg-
herren, den Freiherren von Lichtenstein, in ein Ganerbschaftsverhältnis. Wir wissen leider nicht, welches
die Notenhansche Kemenate auf dem mindestens drei Burghäuser umfassenden Lichtenstein war, wahr-
scheinlich ist es derselbe Wohnbau, auf dem noch heute, nach nahezu 600 Jahren, der „rote Hahn" als Wappen-
tier der Besitzer prangt. Die Rotenhan saßen aus Lichtenstein bis zum Jahr 1568, seit welcher Zeit die
*) Vgl. Ocsterreicher,
**) Die ältesten, in karolingischer Zeit beurkundeten Namen, treten fast ausnahmslos in der Zusammensetzung mit — Burg
auf: Wallburg (ab Eltmann), Salzburg, Hammelburg, Volloneburc, Karlsburg u. a.
Der Bergfried, der von bescheidenen Ausmaßen ge-
wesen sein muß, wird auf der Plattform des nördlichen Fels-
blockcs angenommen und zwar auf Grund einer kellerartigen
halbkugeligen Eintiefung, die aus der Südseite dieses Fels-
blockes liegt. Der Flächenraum auf der Plattform dieses
Felsens beträgt etwa 100 Quadratmeter. Eine Burgkapelle
wird 1225 erwähnt.
Die Burg liegt hart am Rande des Bergrückens zwischen
Baunach- und Itzgrund; auf der Westseite des Hanges. Es
ist wahrscheinlich, daß sie unweit einer Hochstraße stand, die
von Baunach herkommend über Wüstenwelsberg nach Lich-
tenstein, Altenstein nordwärts gegen Hildburghausen lief,
da die genannten anderen Burgsihe gleichfalls die Strecke
einer alten Hochstraße andeuten. Rotenhan würde speziell
die Stelle kennzeichnen, wo diese Hochstraße sich mit einem
Verbindungsweg zwischen Baunach- und Itzgrund, der von
Eyrichshof nach Antermerzbach führte, gekreuzt hat. Diese
ganze Situation spricht für hohes Alter der Burg; wann
aber etwa die Entstehungszeit angesagt werden könnte, läßt
sich nicht sagen. Frühgeschichtliche Funde fehlen der Gegend
ziemlich ganz, die urkundliche Geschichte der Frühzeit, für die
die Fuldaer Aeberliefcrungen unsere einzige Quelle sind,
enthält für die nähere Umgebung von Rotenhan nichts. Es
hat darum jede Hypothese, die den Burgsitz über die Iahr-
tausendwende Hinaufrücken will, wenig Beweiskräftiges für
sich. Die erste Kunde von einer extensiven Kolonisation der
Gegend durch deutsche Ansiedler geht mit der Ausbreitung
des schon erwähnten jungen Bamberger Hochstifts zusammen,
als dessen Zweigstelle das Kloster Banz fungierte. Der
enge Zusammenhang des Rotenhantz'chen Geschlechtes mit
dem Ganzer Kloster, der schon von älteren Historikern Mb. 37. Grabstein der Brüder Sebastian, Hans
erkannt wurde*) und ferner die erwähnte Stellung des und Martin von Rotenhan in der Schloßkirche
Geschlechtes zum Bamberger Hof als Inhaber des Schen- Su Nentweinsdorf.
kenamts, endlich die Stellung Ludwig I. von Rotenhan
als Schiedrichter im Meranischen Erbfolgestreit, das alles beweist, daß der Eintritt des Geschlechtes in
die Landesgeschichte mit Sicherheit in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts erfolgte. Daß das
Geschlecht seine einflußreiche Rolle bei den damals maßgebenden politischen Machthabern auf Grund her-
vorragender persönlicher Bedeutung spielte, ist sicher, ob aber diese Bedeutung auf älterer Landessässig-
keit oder auf anderen Faktoren beruhte, kann die Geschichte nicht mehr enträtseln. Der Name Rotenhan
widerspricht nicht nur diesen anderen Indizien, sondern scheint, soweit man Schlüsse aus den fränkischen
Burgennamen ziehen darf, gleichfalls auf diese Zeit, d. h. das 11. Jahrhundert, zu weisen**).
Nach dem unglücklichen Ausgang der Fehde zwischen Wolfram von Rotenhan und Wolfram von Grum-
bach treffen wir das Geschlecht auf zwei neuen Burgsitzcn, die darauf hinzuweisen scheinen, daß die Stellung
der Rotenhan als Dynasten, die offenbar im 11. und 12. Jahrhundert bestanden hatte, durch das Be-
streben der Würzburger Fürstbischöfe in ein Vasallenverhältnis überging. Wolfram III. von Rotenhan
erwirbt 1345 ein Burggut mit Kemenate auf der Burg Lichtenstein, trat also mit den dortigen Burg-
herren, den Freiherren von Lichtenstein, in ein Ganerbschaftsverhältnis. Wir wissen leider nicht, welches
die Notenhansche Kemenate auf dem mindestens drei Burghäuser umfassenden Lichtenstein war, wahr-
scheinlich ist es derselbe Wohnbau, auf dem noch heute, nach nahezu 600 Jahren, der „rote Hahn" als Wappen-
tier der Besitzer prangt. Die Rotenhan saßen aus Lichtenstein bis zum Jahr 1568, seit welcher Zeit die
*) Vgl. Ocsterreicher,
**) Die ältesten, in karolingischer Zeit beurkundeten Namen, treten fast ausnahmslos in der Zusammensetzung mit — Burg
auf: Wallburg (ab Eltmann), Salzburg, Hammelburg, Volloneburc, Karlsburg u. a.