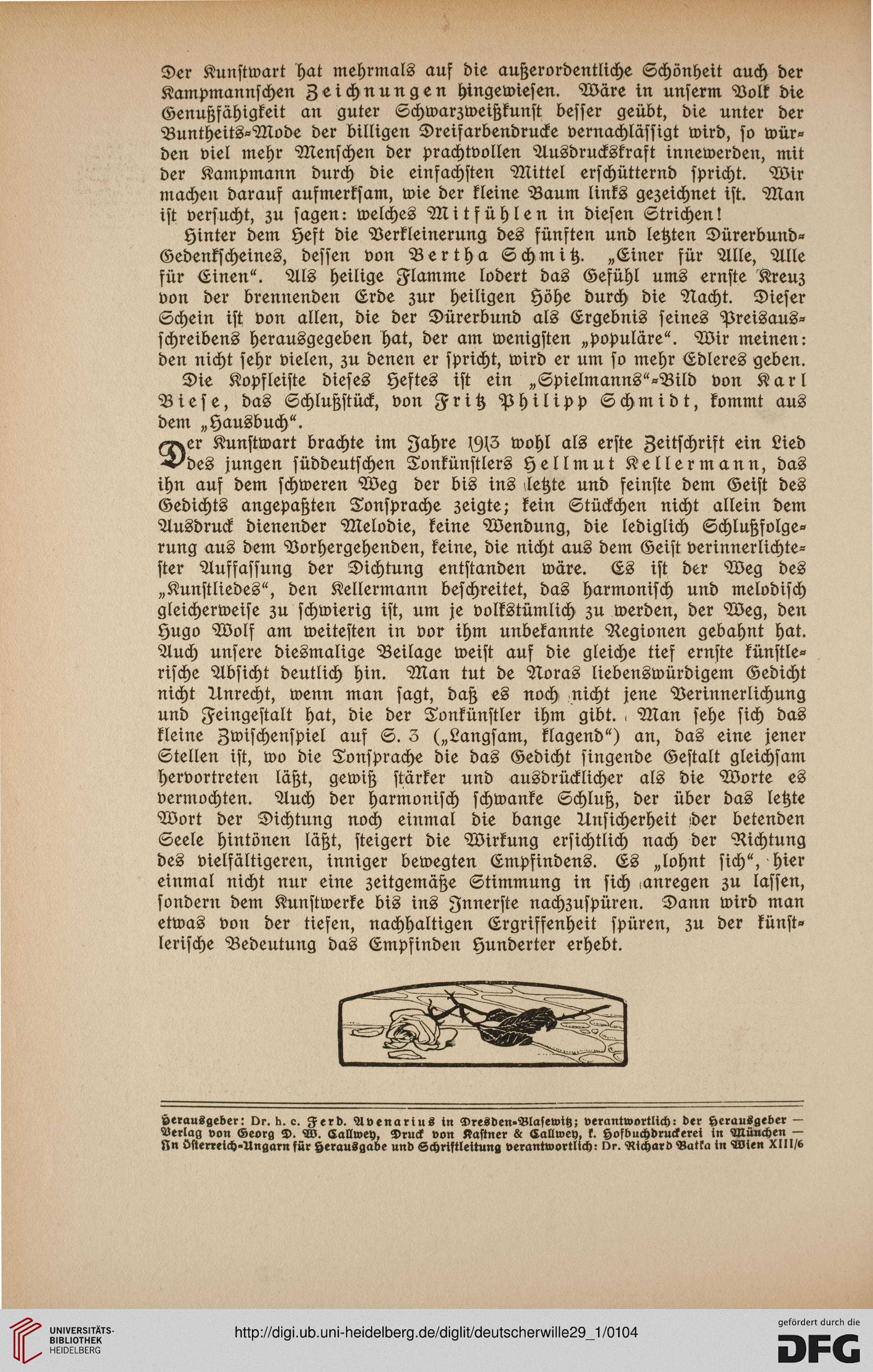Der Kunstwart hat mehrmals auf die außerordentliche Schönheit auch der
Kampmannschen Zeichnungen hingewiesen. Wäre in unserm Volk die
Genußfähigkeit an guter Schwarzweißkunst besser geübt, die unter der
Buntheits-Mode der billigen Dreifarbendrucke vernachlässigt wird, so wür«
den viel mehr Menschen der prachtvollen Ausdruckskraft innewerden, mit
der Kampmann durch die einfachsten Mittel erschütternd spricht. Wir
machen darauf aufmerksarn, wie der kleine Baum links gezeichnet ist. Man
ist versucht, zu sagen: welches Mitfühlen in diesen Strichen!
Hinter dem Heft die Verkleinerung des fünften und letzten Dürerbund»
Gedenkscheines, dessen von Bertha Schmitz. „Einer für Alle, Alle
für Einen". Als heilige Flamme lodert das Gefühl ums ernste Kreuz
von der brennenden Erde zur Heiligen tzöhe durch die Nacht. Dieser
Schein ist von allen, die der Dürerbund als Ergebnis seines Preisaus»
schreibens herausgegeben hat, der am wenigsten „populäre". Wir meinen:
den nicht sehr vielen, zu denen er spricht, wird er um so mehr Edleres geben.
Die Kopfleiste dieses tzeftes ist ein „Spielmanns"«Bild von Karl
Biese, das Schlußstück, von Fritz Philipp Schmidt, kommt aus
dem „Hausbuch^.
^er Kunstwart brachte im Iahre (9(3 wohl als erste Zeitschrift ein Lied
-2^des jungen süddeutschen Tonkünstlers tzellmut Kellermann, das
ihn auf dem schweren Weg der bis ins cketzte und seinste dem Geist des
Gedichts angepaßten Tonsprache zeigte; kein Stückchen nicht allein dem
Ausdruck dienender Melodie, keine Wendung, die lediglich Schlußfolge«
rung aus dem Vorhergehenden, keine, die nicht aus dem Geist verinnerlichte-
ster Auffassung der Dichtung entstanden wäre. Es ist der Weg des
„Kunstliedes", den Kellermann beschreitet, das harmonisch und melodisch
gleicherweise zu schwierig ist, um je volkstümlich zu werden, der Weg, den
Hugo Wolf am weitesten in vor ihm unbekannte Regionen gebahnt hat.
Auch unsere diesmalige Beilage weist auf die gleiche tief ernste künstle«
rische Absicht deutlich hin. Man tut de Noras liebenswürdigem Gedicht
nicht Anrecht, wenn man sagt, daß es noch nicht jene Verinnerlichung
und Feingestalt hat, die der Tonkünstler ihm gibt. . Man sehe sich das
kleine Zwischenspiel auf S. 3 („Langsam, klagend") an, das eine jener
Stellen ist, wo die Tonsprache die das Gedicht singende Gestalt gleichsam
hervortreten läßt, gewiß stärker und ausdrücklicher als die Worte es
vermochten. Auch der harmonisch schwanke Schluß, der über das letzte
Wort der Dichtung noch einmal die bange Unsicherheit der betenden
Seele hintönen läßt, steigert die Wirkung ersichtlich nach der Richtung
des vielfältigeren, inniger bewegten Empfindens. Es „lohnt sich", hier
einmal nicht nur eine zeitgemäße Stimmung in sich >anregen zu lassen,
sondern dem Kunstwerke bis ins Innerste nachzuspüren. Dann wird man
etwas von der tiefen, nachhaltigen Ergriffenheit spüren, zu der künst«
lerische Bedeutung das Empfinden Hunderter erhebt.
verausgeber: vr. K. e. Ferd. Avenarius in Dresden-Blasewitz; verantwortlich: der Herausgeber —
Berlag von Georg D. W. Lallwey. Druck von Kastner Lc Lallwey, k. Hofbuchdruckerei in München —
gn Üsterreich-Ungarnfür Herausgabe und Schriftleitung verantwortlich: Or. Richard Batka in Wien XlII/6
Kampmannschen Zeichnungen hingewiesen. Wäre in unserm Volk die
Genußfähigkeit an guter Schwarzweißkunst besser geübt, die unter der
Buntheits-Mode der billigen Dreifarbendrucke vernachlässigt wird, so wür«
den viel mehr Menschen der prachtvollen Ausdruckskraft innewerden, mit
der Kampmann durch die einfachsten Mittel erschütternd spricht. Wir
machen darauf aufmerksarn, wie der kleine Baum links gezeichnet ist. Man
ist versucht, zu sagen: welches Mitfühlen in diesen Strichen!
Hinter dem Heft die Verkleinerung des fünften und letzten Dürerbund»
Gedenkscheines, dessen von Bertha Schmitz. „Einer für Alle, Alle
für Einen". Als heilige Flamme lodert das Gefühl ums ernste Kreuz
von der brennenden Erde zur Heiligen tzöhe durch die Nacht. Dieser
Schein ist von allen, die der Dürerbund als Ergebnis seines Preisaus»
schreibens herausgegeben hat, der am wenigsten „populäre". Wir meinen:
den nicht sehr vielen, zu denen er spricht, wird er um so mehr Edleres geben.
Die Kopfleiste dieses tzeftes ist ein „Spielmanns"«Bild von Karl
Biese, das Schlußstück, von Fritz Philipp Schmidt, kommt aus
dem „Hausbuch^.
^er Kunstwart brachte im Iahre (9(3 wohl als erste Zeitschrift ein Lied
-2^des jungen süddeutschen Tonkünstlers tzellmut Kellermann, das
ihn auf dem schweren Weg der bis ins cketzte und seinste dem Geist des
Gedichts angepaßten Tonsprache zeigte; kein Stückchen nicht allein dem
Ausdruck dienender Melodie, keine Wendung, die lediglich Schlußfolge«
rung aus dem Vorhergehenden, keine, die nicht aus dem Geist verinnerlichte-
ster Auffassung der Dichtung entstanden wäre. Es ist der Weg des
„Kunstliedes", den Kellermann beschreitet, das harmonisch und melodisch
gleicherweise zu schwierig ist, um je volkstümlich zu werden, der Weg, den
Hugo Wolf am weitesten in vor ihm unbekannte Regionen gebahnt hat.
Auch unsere diesmalige Beilage weist auf die gleiche tief ernste künstle«
rische Absicht deutlich hin. Man tut de Noras liebenswürdigem Gedicht
nicht Anrecht, wenn man sagt, daß es noch nicht jene Verinnerlichung
und Feingestalt hat, die der Tonkünstler ihm gibt. . Man sehe sich das
kleine Zwischenspiel auf S. 3 („Langsam, klagend") an, das eine jener
Stellen ist, wo die Tonsprache die das Gedicht singende Gestalt gleichsam
hervortreten läßt, gewiß stärker und ausdrücklicher als die Worte es
vermochten. Auch der harmonisch schwanke Schluß, der über das letzte
Wort der Dichtung noch einmal die bange Unsicherheit der betenden
Seele hintönen läßt, steigert die Wirkung ersichtlich nach der Richtung
des vielfältigeren, inniger bewegten Empfindens. Es „lohnt sich", hier
einmal nicht nur eine zeitgemäße Stimmung in sich >anregen zu lassen,
sondern dem Kunstwerke bis ins Innerste nachzuspüren. Dann wird man
etwas von der tiefen, nachhaltigen Ergriffenheit spüren, zu der künst«
lerische Bedeutung das Empfinden Hunderter erhebt.
verausgeber: vr. K. e. Ferd. Avenarius in Dresden-Blasewitz; verantwortlich: der Herausgeber —
Berlag von Georg D. W. Lallwey. Druck von Kastner Lc Lallwey, k. Hofbuchdruckerei in München —
gn Üsterreich-Ungarnfür Herausgabe und Schriftleitung verantwortlich: Or. Richard Batka in Wien XlII/6