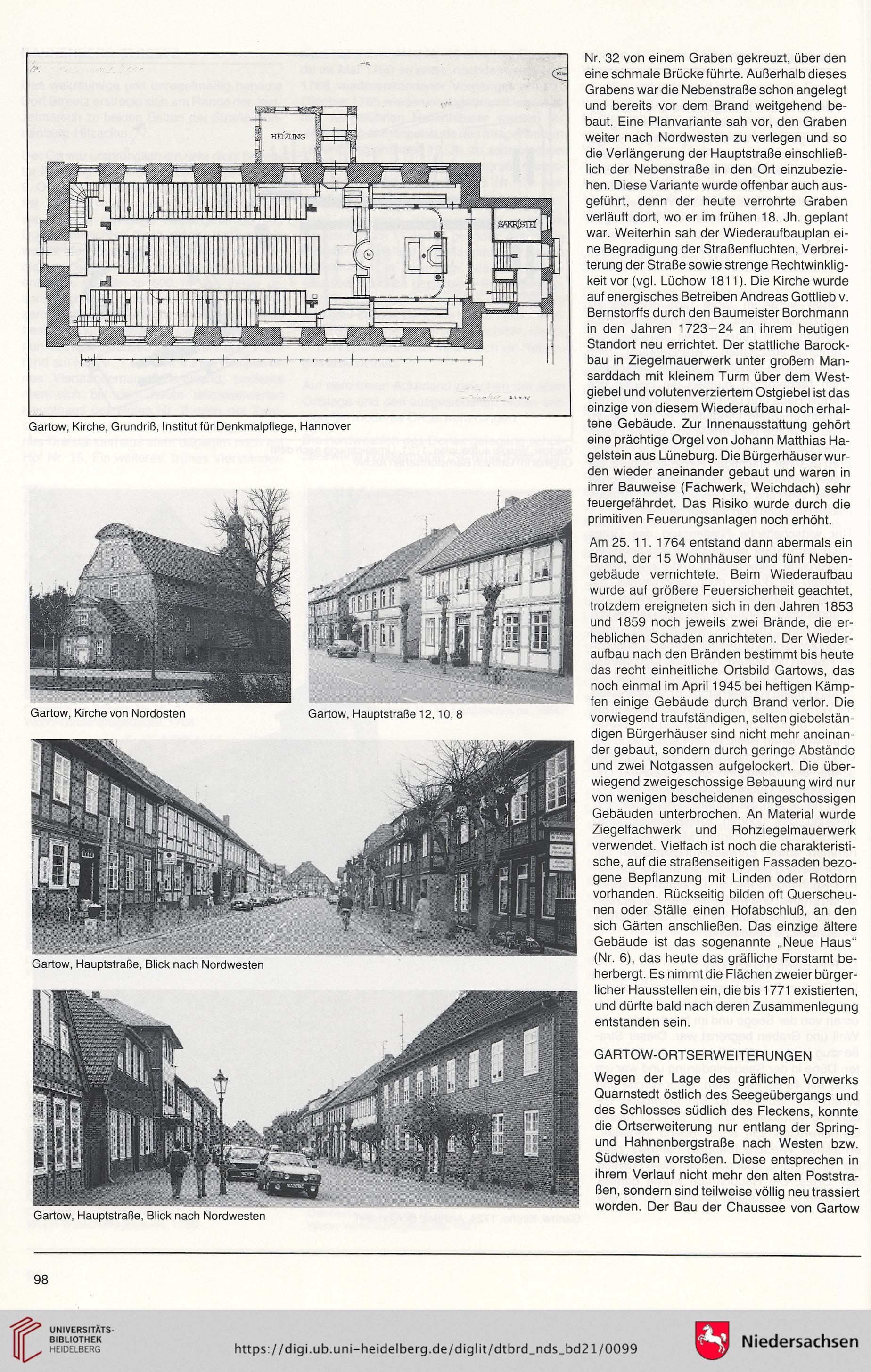W
Gartow, Kirche, Grundriß, Institut für Denkmalpflege, Hannover
Gartow, Kirche von Nordosten
Gartow, Hauptstraße 12, 10, 8
Nr. 32 von einem Graben gekreuzt, über den
eine schmale Brücke führte. Außerhalb dieses
Grabens war die Nebenstraße schon angelegt
und bereits vor dem Brand weitgehend be-
baut. Eine Planvariante sah vor, den Graben
weiter nach Nordwesten zu verlegen und so
die Verlängerung der Hauptstraße einschließ-
lich der Nebenstraße in den Ort einzubezie-
hen. Diese Variante wurde offenbar auch aus-
geführt, denn der heute verrohrte Graben
verläuft dort, wo er im frühen 18. Jh. geplant
war. Weiterhin sah der Wiederaufbauplan ei-
ne Begradigung der Straßenfluchten, Verbrei-
terung der Straße sowie strenge Rechtwinklig-
keit vor (vgl. Lüchow 1811). Die Kirche wurde
auf energisches Betreiben Andreas Gottlieb v.
Bernstorffs durch den Baumeister Borchmann
in den Jahren 1723-24 an ihrem heutigen
Standort neu errichtet. Der stattliche Barock-
bau in Ziegelmauerwerk unter großem Man-
sarddach mit kleinem Turm über dem West-
giebel und volutenverziertem Ostgiebel ist das
einzige von diesem Wiederaufbau noch erhal-
tene Gebäude. Zur Innenausstattung gehört
eine prächtige Orgel von Johann Matthias Ha-
gelstein aus Lüneburg. Die Bürgerhäuser wur-
den wieder aneinander gebaut und waren in
ihrer Bauweise (Fachwerk, Weichdach) sehr
feuergefährdet. Das Risiko wurde durch die
primitiven Feuerungsanlagen noch erhöht.
Am 25. 11. 1764 entstand dann abermals ein
Brand, der 15 Wohnhäuser und fünf Neben-
gebäude vernichtete. Beim Wiederaufbau
wurde auf größere Feuersicherheit geachtet,
trotzdem ereigneten sich in den Jahren 1853
und 1859 noch jeweils zwei Brände, die er-
heblichen Schaden anrichteten. Der Wieder-
aufbau nach den Bränden bestimmt bis heute
das recht einheitliche Ortsbild Gartows, das
noch einmal im April 1945 bei heftigen Kämp-
fen einige Gebäude durch Brand verlor. Die
vorwiegend traufständigen, selten giebelstän-
digen Bürgerhäuser sind nicht mehr aneinan-
der gebaut, sondern durch geringe Abstände
und zwei Notgassen aufgelockert. Die über-
wiegend zweigeschossige Bebauung wird nur
von wenigen bescheidenen eingeschossigen
Gebäuden unterbrochen. An Material wurde
Ziegelfachwerk und Rohziegelmauerwerk
verwendet. Vielfach ist noch die charakteristi-
sche, auf die straßenseitigen Fassaden bezo-
gene Bepflanzung mit Linden oder Rotdorn
vorhanden. Rückseitig bilden oft Querscheu-
nen oder Ställe einen Hofabschluß, an den
sich Gärten anschließen. Das einzige ältere
Gebäude ist das sogenannte „Neue Haus“
(Nr. 6), das heute das gräfliche Forstamt be-
herbergt. Es nimmt die Flächen zweier bürger-
licher Hausstellen ein, die bis 1771 existierten,
und dürfte bald nach deren Zusammenlegung
entstanden sein.
GARTOW-ORTSERWEITERUNGEN
Wegen der Lage des gräflichen Vorwerks
Quarnstedt östlich des Seegeübergangs und
des Schlosses südlich des Fleckens, konnte
die Ortserweiterung nur entlang der Spring-
und Hahnenbergstraße nach Westen bzw.
Südwesten vorstoßen. Diese entsprechen in
ihrem Verlauf nicht mehr den alten Poststra-
ßen, sondern sind teilweise völlig neu trassiert
worden. Der Bau der Chaussee von Gartow
Gartow, Hauptstraße, Blick nach Nordwesten
Gartow, Hauptstraße, Blick nach Nordwesten
98