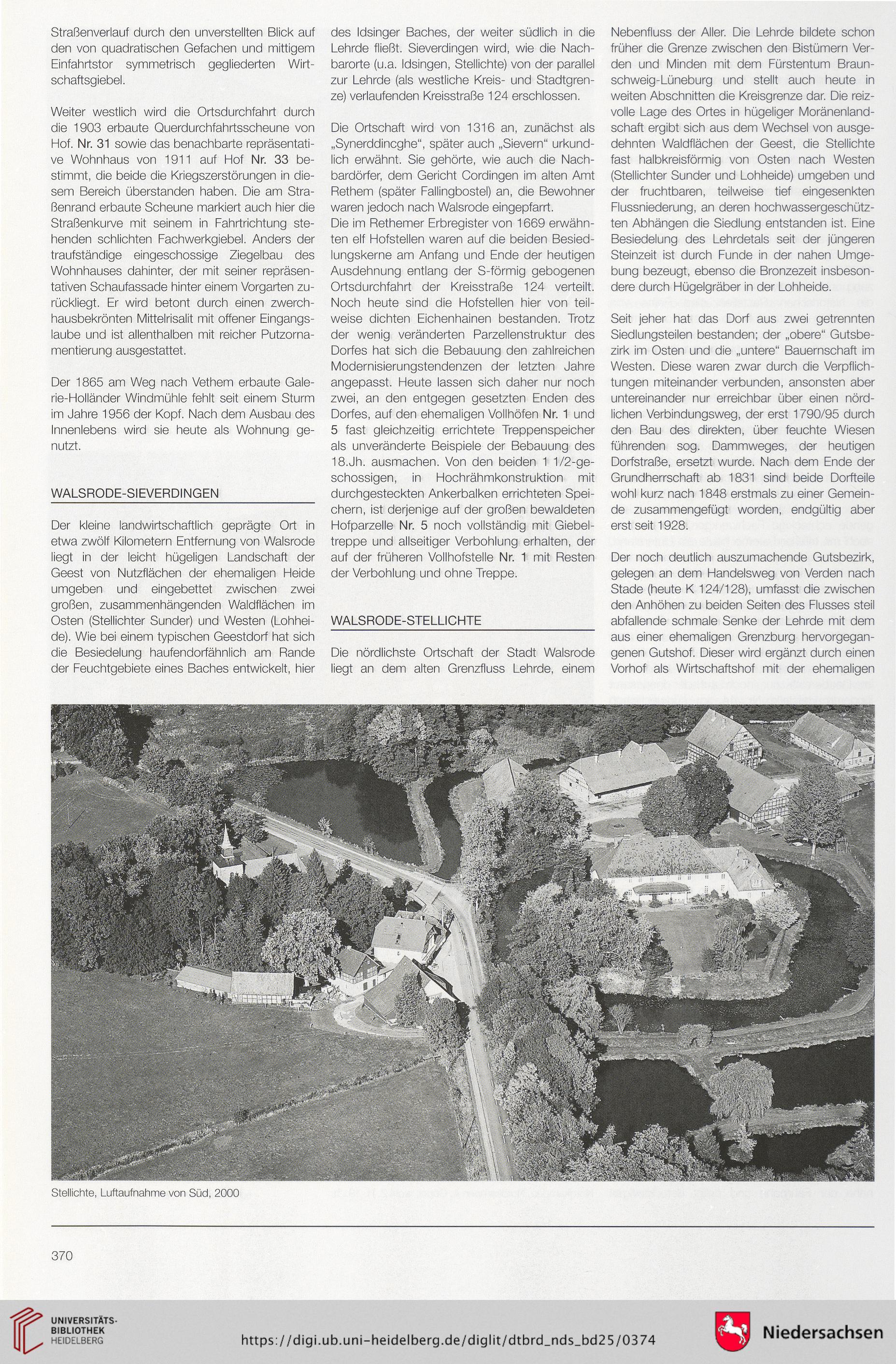Straßenverlauf durch den unverstellten Blick auf
den von quadratischen Gefachen und mittigem
Einfahrtstor symmetrisch gegliederten Wirt-
schaftsgiebel.
Weiter westlich wird die Ortsdurchfahrt durch
die 1903 erbaute Querdurchfahrtsscheune von
Hof. Nr. 31 sowie das benachbarte repräsentati-
ve Wohnhaus von 1911 auf Hof Nr. 33 be-
stimmt, die beide die Kriegszerstörungen in die-
sem Bereich überstanden haben. Die am Stra-
ßenrand erbaute Scheune markiert auch hier die
Straßenkurve mit seinem in Fahrtrichtung ste-
henden schlichten Fachwerkgiebel. Anders der
traufständige eingeschossige Ziegelbau des
Wohnhauses dahinter, der mit seiner repräsen-
tativen Schaufassade hinter einem Vorgarten zu-
rückliegt. Er wird betont durch einen zwerch-
hausbekrönten Mittelrisalit mit offener Eingangs-
laube und ist allenthalben mit reicher Putzorna-
mentierung ausgestattet.
Der 1865 am Weg nach Vethem erbaute Gale-
rie-Holländer Windmühle fehlt seit einem Sturm
im Jahre 1956 der Kopf. Nach dem Ausbau des
Innenlebens wird sie heute als Wohnung ge-
nutzt.
WALSRODE-SIEVERDINGEN
Der kleine landwirtschaftlich geprägte Ort in
etwa zwölf Kilometern Entfernung von Walsrode
liegt in der leicht hügeligen Landschaft der
Geest von Nutzflächen der ehemaligen Heide
umgeben und eingebettet zwischen zwei
großen, zusammenhängenden Waldflächen im
Osten (Stellichter Sünder) und Westen (Lohhei-
de). Wie bei einem typischen Geestdorf hat sich
die Besiedelung haufendorfähnlich am Rande
der Feuchtgebiete eines Baches entwickelt, hier
des Idsinger Baches, der weiter südlich in die
Lehrde fließt. Sieverdingen wird, wie die Nach-
barorte (u.a. Idsingen, Stellichte) von der parallel
zur Lehrde (als westliche Kreis- und Stadtgren-
ze) verlaufenden Kreisstraße 124 erschlossen.
Die Ortschaft wird von 1316 an, zunächst als
„Synerddincghe“, später auch „Sievern“ urkund-
lich erwähnt. Sie gehörte, wie auch die Nach-
bardörfer, dem Gericht Cordingen im alten Amt
Rethem (später Fallingbostel) an, die Bewohner
waren jedoch nach Walsrode eingepfarrt.
Die im Rethemer Erbregister von 1669 erwähn-
ten elf Hofstellen waren auf die beiden Besied-
lungskerne am Anfang und Ende der heutigen
Ausdehnung entlang der S-förmig gebogenen
Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 124 verteilt.
Noch heute sind die Hofstellen hier von teil-
weise dichten Eichenhainen bestanden. Trotz
der wenig veränderten Parzellenstruktur des
Dorfes hat sich die Bebauung den zahlreichen
Modernisierungstendenzen der letzten Jahre
angepasst. Heute lassen sich daher nur noch
zwei, an den entgegen gesetzten Enden des
Dorfes, auf den ehemaligen Vollhöfen Nr. 1 und
5 fast gleichzeitig errichtete Treppenspeicher
als unveränderte Beispiele der Bebauung des
18.Jh. ausmachen. Von den beiden 1 1/2-ge-
schossigen, in Hochrähmkonstruktion mit
durchgesteckten Ankerbalken errichteten Spei-
chern, ist derjenige auf der großen bewaldeten
Hofparzelle Nr. 5 noch vollständig mit Giebel-
treppe und allseitiger Verbohlung erhalten, der
auf der früheren Vollhofstelle Nr. 1 mit Resten
der Verbohlung und ohne Treppe.
WALSRODE-STELLICHTE
Die nördlichste Ortschaft der Stadt Walsrode
liegt an dem alten Grenzfluss Lehrde, einem
Nebenfluss der Aller. Die Lehrde bildete schon
früher die Grenze zwischen den Bistümern Ver-
den und Minden mit dem Fürstentum Braun-
schweig-Lüneburg und stellt auch heute in
weiten Abschnitten die Kreisgrenze dar. Die reiz-
volle Lage des Ortes in hügeliger Moränenland-
schaft ergibt sich aus dem Wechsel von ausge-
dehnten Waldflächen der Geest, die Stellichte
fast halbkreisförmig von Osten nach Westen
(Stellichter Sünder und Lohheide) umgeben und
der fruchtbaren, teilweise tief eingesenkten
Flussniederung, an deren hochwassergeschütz-
ten Abhängen die Siedlung entstanden ist. Eine
Besiedelung des Lehrdetals seit der jüngeren
Steinzeit ist durch Funde in der nahen Umge-
bung bezeugt, ebenso die Bronzezeit insbeson-
dere durch Hügelgräber in der Lohheide.
Seit jeher hat das Dorf aus zwei getrennten
Siedlungsteilen bestanden; der „obere“ Gutsbe-
zirk im Osten und die „untere“ Bauernschaft im
Westen. Diese waren zwar durch die Verpflich-
tungen miteinander verbunden, ansonsten aber
untereinander nur erreichbar über einen nörd-
lichen Verbindungsweg, der erst 1790/95 durch
den Bau des direkten, über feuchte Wiesen
führenden sog. Dammweges, der heutigen
Dorfstraße, ersetzt wurde. Nach dem Ende der
Grundherrschaft ab 1831 sind beide Dorfteile
wohl kurz nach 1848 erstmals zu einer Gemein-
de zusammengefügt worden, endgültig aber
erst seit 1928.
Der noch deutlich auszumachende Gutsbezirk,
gelegen an dem Handelsweg von Verden nach
Stade (heute K 124/128), umfasst die zwischen
den Anhöhen zu beiden Seiten des Flusses steil
abfallende schmale Senke der Lehrde mit dem
aus einer ehemaligen Grenzburg hervorgegan-
genen Gutshof. Dieser wird ergänzt durch einen
Vorhof als Wirtschaftshof mit der ehemaligen
Stellichte, Luftaufnahme von Süd, 2000
370
den von quadratischen Gefachen und mittigem
Einfahrtstor symmetrisch gegliederten Wirt-
schaftsgiebel.
Weiter westlich wird die Ortsdurchfahrt durch
die 1903 erbaute Querdurchfahrtsscheune von
Hof. Nr. 31 sowie das benachbarte repräsentati-
ve Wohnhaus von 1911 auf Hof Nr. 33 be-
stimmt, die beide die Kriegszerstörungen in die-
sem Bereich überstanden haben. Die am Stra-
ßenrand erbaute Scheune markiert auch hier die
Straßenkurve mit seinem in Fahrtrichtung ste-
henden schlichten Fachwerkgiebel. Anders der
traufständige eingeschossige Ziegelbau des
Wohnhauses dahinter, der mit seiner repräsen-
tativen Schaufassade hinter einem Vorgarten zu-
rückliegt. Er wird betont durch einen zwerch-
hausbekrönten Mittelrisalit mit offener Eingangs-
laube und ist allenthalben mit reicher Putzorna-
mentierung ausgestattet.
Der 1865 am Weg nach Vethem erbaute Gale-
rie-Holländer Windmühle fehlt seit einem Sturm
im Jahre 1956 der Kopf. Nach dem Ausbau des
Innenlebens wird sie heute als Wohnung ge-
nutzt.
WALSRODE-SIEVERDINGEN
Der kleine landwirtschaftlich geprägte Ort in
etwa zwölf Kilometern Entfernung von Walsrode
liegt in der leicht hügeligen Landschaft der
Geest von Nutzflächen der ehemaligen Heide
umgeben und eingebettet zwischen zwei
großen, zusammenhängenden Waldflächen im
Osten (Stellichter Sünder) und Westen (Lohhei-
de). Wie bei einem typischen Geestdorf hat sich
die Besiedelung haufendorfähnlich am Rande
der Feuchtgebiete eines Baches entwickelt, hier
des Idsinger Baches, der weiter südlich in die
Lehrde fließt. Sieverdingen wird, wie die Nach-
barorte (u.a. Idsingen, Stellichte) von der parallel
zur Lehrde (als westliche Kreis- und Stadtgren-
ze) verlaufenden Kreisstraße 124 erschlossen.
Die Ortschaft wird von 1316 an, zunächst als
„Synerddincghe“, später auch „Sievern“ urkund-
lich erwähnt. Sie gehörte, wie auch die Nach-
bardörfer, dem Gericht Cordingen im alten Amt
Rethem (später Fallingbostel) an, die Bewohner
waren jedoch nach Walsrode eingepfarrt.
Die im Rethemer Erbregister von 1669 erwähn-
ten elf Hofstellen waren auf die beiden Besied-
lungskerne am Anfang und Ende der heutigen
Ausdehnung entlang der S-förmig gebogenen
Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 124 verteilt.
Noch heute sind die Hofstellen hier von teil-
weise dichten Eichenhainen bestanden. Trotz
der wenig veränderten Parzellenstruktur des
Dorfes hat sich die Bebauung den zahlreichen
Modernisierungstendenzen der letzten Jahre
angepasst. Heute lassen sich daher nur noch
zwei, an den entgegen gesetzten Enden des
Dorfes, auf den ehemaligen Vollhöfen Nr. 1 und
5 fast gleichzeitig errichtete Treppenspeicher
als unveränderte Beispiele der Bebauung des
18.Jh. ausmachen. Von den beiden 1 1/2-ge-
schossigen, in Hochrähmkonstruktion mit
durchgesteckten Ankerbalken errichteten Spei-
chern, ist derjenige auf der großen bewaldeten
Hofparzelle Nr. 5 noch vollständig mit Giebel-
treppe und allseitiger Verbohlung erhalten, der
auf der früheren Vollhofstelle Nr. 1 mit Resten
der Verbohlung und ohne Treppe.
WALSRODE-STELLICHTE
Die nördlichste Ortschaft der Stadt Walsrode
liegt an dem alten Grenzfluss Lehrde, einem
Nebenfluss der Aller. Die Lehrde bildete schon
früher die Grenze zwischen den Bistümern Ver-
den und Minden mit dem Fürstentum Braun-
schweig-Lüneburg und stellt auch heute in
weiten Abschnitten die Kreisgrenze dar. Die reiz-
volle Lage des Ortes in hügeliger Moränenland-
schaft ergibt sich aus dem Wechsel von ausge-
dehnten Waldflächen der Geest, die Stellichte
fast halbkreisförmig von Osten nach Westen
(Stellichter Sünder und Lohheide) umgeben und
der fruchtbaren, teilweise tief eingesenkten
Flussniederung, an deren hochwassergeschütz-
ten Abhängen die Siedlung entstanden ist. Eine
Besiedelung des Lehrdetals seit der jüngeren
Steinzeit ist durch Funde in der nahen Umge-
bung bezeugt, ebenso die Bronzezeit insbeson-
dere durch Hügelgräber in der Lohheide.
Seit jeher hat das Dorf aus zwei getrennten
Siedlungsteilen bestanden; der „obere“ Gutsbe-
zirk im Osten und die „untere“ Bauernschaft im
Westen. Diese waren zwar durch die Verpflich-
tungen miteinander verbunden, ansonsten aber
untereinander nur erreichbar über einen nörd-
lichen Verbindungsweg, der erst 1790/95 durch
den Bau des direkten, über feuchte Wiesen
führenden sog. Dammweges, der heutigen
Dorfstraße, ersetzt wurde. Nach dem Ende der
Grundherrschaft ab 1831 sind beide Dorfteile
wohl kurz nach 1848 erstmals zu einer Gemein-
de zusammengefügt worden, endgültig aber
erst seit 1928.
Der noch deutlich auszumachende Gutsbezirk,
gelegen an dem Handelsweg von Verden nach
Stade (heute K 124/128), umfasst die zwischen
den Anhöhen zu beiden Seiten des Flusses steil
abfallende schmale Senke der Lehrde mit dem
aus einer ehemaligen Grenzburg hervorgegan-
genen Gutshof. Dieser wird ergänzt durch einen
Vorhof als Wirtschaftshof mit der ehemaligen
Stellichte, Luftaufnahme von Süd, 2000
370