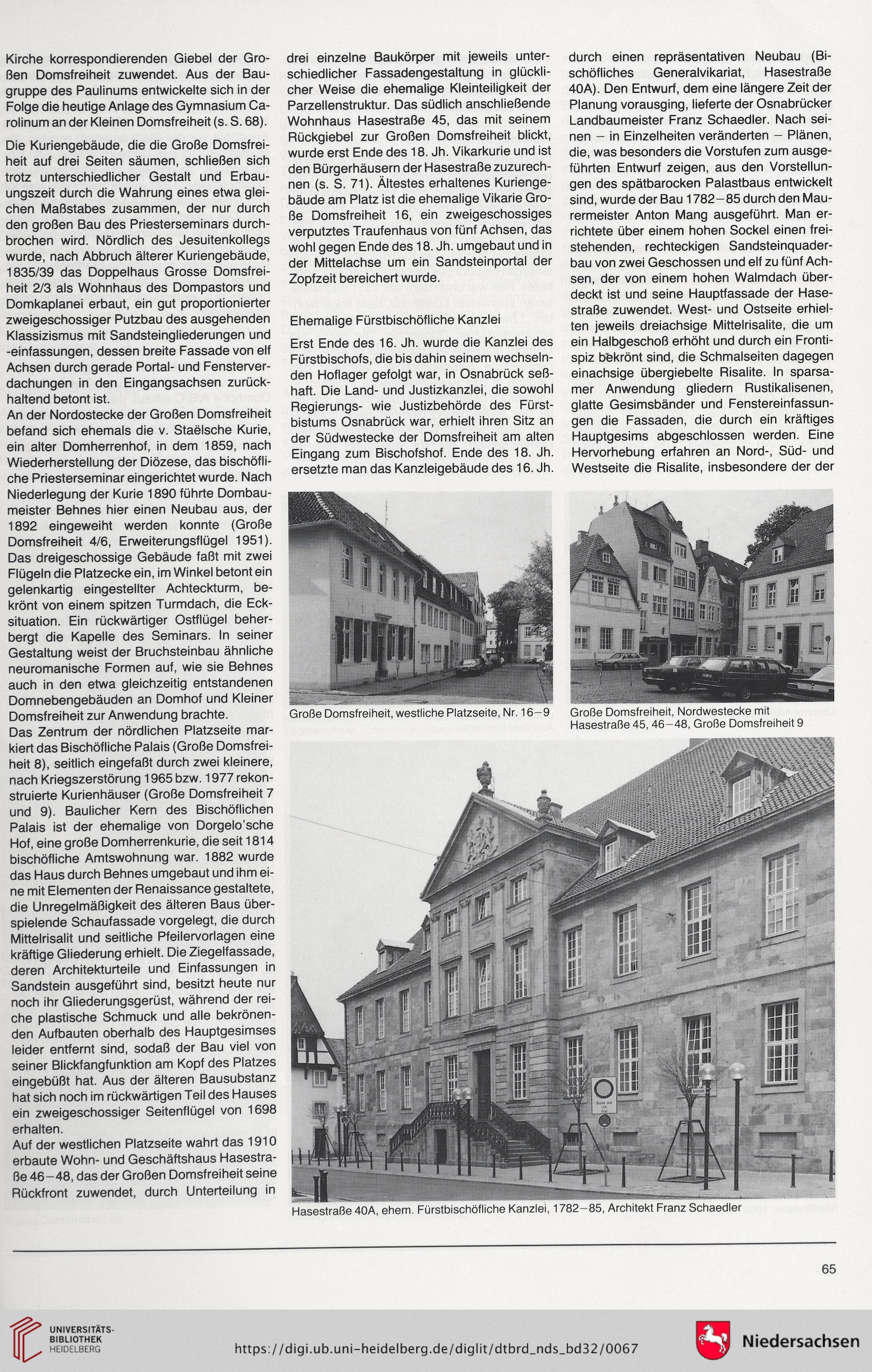Kirche korrespondierenden Giebel der Gro-
ßen Domsfreiheit zuwendet. Aus der Bau-
gruppe des Paulinums entwickelte sich in der
Folge die heutige Anlage des Gymnasium Ca-
rolinum an der Kleinen Domsfreiheit (s. S. 68).
Die Kuriengebäude, die die Große Domsfrei-
heit auf drei Seiten säumen, schließen sich
trotz unterschiedlicher Gestalt und Erbau-
ungszeit durch die Wahrung eines etwa glei-
chen Maßstabes zusammen, der nur durch
den großen Bau des Priesterseminars durch-
brochen wird. Nördlich des Jesuitenkollegs
wurde, nach Abbruch älterer Kuriengebäude,
1835/39 das Doppelhaus Grosse Domsfrei-
heit 2/3 als Wohnhaus des Dompastors und
Domkaplanei erbaut, ein gut proportionierter
zweigeschossiger Putzbau des ausgehenden
Klassizismus mit Sandsteingliederungen und
-einfassungen, dessen breite Fassade von elf
Achsen durch gerade Portal- und Fensterver-
dachungen in den Eingangsachsen zurück-
haltend betont ist.
An der Nordostecke der Großen Domsfreiheit
befand sich ehemals die v. Staelsche Kurie,
ein alter Domherrenhof, in dem 1859, nach
Wiederherstellung der Diözese, das bischöfli-
che Priesterseminar eingerichtet wurde. Nach
Niederlegung der Kurie 1890 führte Dombau-
meister Behnes hier einen Neubau aus, der
1892 eingeweiht werden konnte (Große
Domsfreiheit 4/6, Erweiterungsflügel 1951).
Das dreigeschossige Gebäude faßt mit zwei
Flügeln die Platzecke ein, im Winkel betont ein
gelenkartig eingestellter Achteckturm, be-
krönt von einem spitzen Turmdach, die Eck-
situation. Ein rückwärtiger Ostflügel beher-
bergt die Kapelle des Seminars. In seiner
Gestaltung weist der Bruchsteinbau ähnliche
neuromanische Formen auf, wie sie Behnes
auch in den etwa gleichzeitig entstandenen
Domnebengebäuden an Domhof und Kleiner
Domsfreiheit zur Anwendung brachte.
Das Zentrum der nördlichen Platzseite mar-
kiert das Bischöfliche Palais (Große Domsfrei-
heit 8), seitlich eingefaßt durch zwei kleinere,
nach Kriegszerstörung 1965 bzw. 1977 rekon-
struierte Kurienhäuser (Große Domsfreiheit 7
und 9). Baulicher Kern des Bischöflichen
Palais ist der ehemalige von Dorgelo’sche
Hof, eine große Domherrenkurie, die seit 1814
bischöfliche Amtswohnung war. 1882 wurde
das Haus durch Behnes umgebaut und ihm ei-
ne mit Elementen der Renaissance gestaltete,
die Unregelmäßigkeit des älteren Baus über-
spielende Schaufassade vorgelegt, die durch
Mittelrisalit und seitliche Pfeilervorlagen eine
kräftige Gliederung erhielt. Die Ziegelfassade,
deren Architekturteile und Einfassungen in
Sandstein ausgeführt sind, besitzt heute nur
noch ihr Gliederungsgerüst, während der rei-
che plastische Schmuck und alle bekrönen-
den Aufbauten oberhalb des Hauptgesimses
leider entfernt sind, sodaß der Bau viel von
seiner Blickfangfunktion am Kopf des Platzes
eingebüßt hat. Aus der älteren Bausubstanz
hat sich noch im rückwärtigen Teil des Hauses
ein zweigeschossiger Seitenflügel von 1698
erhalten.
Auf der westlichen Platzseite wahrt das 1910
erbaute Wohn- und Geschäftshaus Hasestra-
ße 46-48, das der Großen Domsfreiheit seine
Rückfront zuwendet, durch Unterteilung in
drei einzelne Baukörper mit jeweils unter-
schiedlicher Fassadengestaltung in glückli-
cher Weise die ehemalige Kleinteiligkeit der
Parzellenstruktur. Das südlich anschließende
Wohnhaus Hasestraße 45, das mit seinem
Rückgiebel zur Großen Domsfreiheit blickt,
wurde erst Ende des 18. Jh. Vikarkurie und ist
den Bürgerhäusern der Hasestraße zuzurech-
nen (s. S. 71). Ältestes erhaltenes Kurienge-
bäude am Platz ist die ehemalige Vikarie Gro-
ße Domsfreiheit 16, ein zweigeschossiges
verputztes Traufenhaus von fünf Achsen, das
wohl gegen Ende des 18. Jh. umgebaut und in
der Mittelachse um ein Sandsteinportal der
Zopfzeit bereichert wurde.
Ehemalige Fürstbischöfliche Kanzlei
Erst Ende des 16. Jh. wurde die Kanzlei des
Fürstbischofs, die bis dahin seinem wechseln-
den Hoflager gefolgt war, in Osnabrück seß-
haft. Die Land- und Justizkanzlei, die sowohl
Regierungs- wie Justizbehörde des Fürst-
bistums Osnabrück war, erhielt ihren Sitz an
der Südwestecke der Domsfreiheit am alten
Eingang zum Bischofshof. Ende des 18. Jh.
ersetzte man das Kanzleigebäude des 16. Jh.
durch einen repräsentativen Neubau (Bi-
schöfliches Generalvikariat, Hasestraße
40A). Den Entwurf, dem eine längere Zeit der
Planung vorausging, lieferte der Osnabrücker
Landbaumeister Franz Schaedler. Nach sei-
nen - in Einzelheiten veränderten - Plänen,
die, was besonders die Vorstufen zum ausge-
führten Entwurf zeigen, aus den Vorstellun-
gen des spätbarocken Palastbaus entwickelt
sind, wurde der Bau 1782-85 durch den Mau-
rermeister Anton Mang ausgeführt. Man er-
richtete über einem hohen Sockel einen frei-
stehenden, rechteckigen Sandsteinquader-
bau von zwei Geschossen und elf zu fünf Ach-
sen, der von einem hohen Walmdach über-
deckt ist und seine Hauptfassade der Hase-
straße zuwendet. West- und Ostseite erhiel-
ten jeweils dreiachsige Mittelrisalite, die um
ein Halbgeschoß erhöht und durch ein Fronti-
spiz bekrönt sind, die Schmalseiten dagegen
einachsige übergiebelte Risalite. In sparsa-
mer Anwendung gliedern Rustikalisenen,
glatte Gesimsbänder und Fenstereinfassun-
gen die Fassaden, die durch ein kräftiges
Hauptgesims abgeschlossen werden. Eine
Hervorhebung erfahren an Nord-, Süd- und
Westseite die Risalite, insbesondere der der
Große Domsfreiheit, westliche Platzseite, Nr. 16-9
Große Domsfreiheit, Nordwestecke mit
Hasestraße 45, 46-48, Große Domsfreiheit 9
Hasestraße 40A, ehern. Fürstbischöfliche Kanzlei, 1782-85, Architekt Franz Schaedler
65
ßen Domsfreiheit zuwendet. Aus der Bau-
gruppe des Paulinums entwickelte sich in der
Folge die heutige Anlage des Gymnasium Ca-
rolinum an der Kleinen Domsfreiheit (s. S. 68).
Die Kuriengebäude, die die Große Domsfrei-
heit auf drei Seiten säumen, schließen sich
trotz unterschiedlicher Gestalt und Erbau-
ungszeit durch die Wahrung eines etwa glei-
chen Maßstabes zusammen, der nur durch
den großen Bau des Priesterseminars durch-
brochen wird. Nördlich des Jesuitenkollegs
wurde, nach Abbruch älterer Kuriengebäude,
1835/39 das Doppelhaus Grosse Domsfrei-
heit 2/3 als Wohnhaus des Dompastors und
Domkaplanei erbaut, ein gut proportionierter
zweigeschossiger Putzbau des ausgehenden
Klassizismus mit Sandsteingliederungen und
-einfassungen, dessen breite Fassade von elf
Achsen durch gerade Portal- und Fensterver-
dachungen in den Eingangsachsen zurück-
haltend betont ist.
An der Nordostecke der Großen Domsfreiheit
befand sich ehemals die v. Staelsche Kurie,
ein alter Domherrenhof, in dem 1859, nach
Wiederherstellung der Diözese, das bischöfli-
che Priesterseminar eingerichtet wurde. Nach
Niederlegung der Kurie 1890 führte Dombau-
meister Behnes hier einen Neubau aus, der
1892 eingeweiht werden konnte (Große
Domsfreiheit 4/6, Erweiterungsflügel 1951).
Das dreigeschossige Gebäude faßt mit zwei
Flügeln die Platzecke ein, im Winkel betont ein
gelenkartig eingestellter Achteckturm, be-
krönt von einem spitzen Turmdach, die Eck-
situation. Ein rückwärtiger Ostflügel beher-
bergt die Kapelle des Seminars. In seiner
Gestaltung weist der Bruchsteinbau ähnliche
neuromanische Formen auf, wie sie Behnes
auch in den etwa gleichzeitig entstandenen
Domnebengebäuden an Domhof und Kleiner
Domsfreiheit zur Anwendung brachte.
Das Zentrum der nördlichen Platzseite mar-
kiert das Bischöfliche Palais (Große Domsfrei-
heit 8), seitlich eingefaßt durch zwei kleinere,
nach Kriegszerstörung 1965 bzw. 1977 rekon-
struierte Kurienhäuser (Große Domsfreiheit 7
und 9). Baulicher Kern des Bischöflichen
Palais ist der ehemalige von Dorgelo’sche
Hof, eine große Domherrenkurie, die seit 1814
bischöfliche Amtswohnung war. 1882 wurde
das Haus durch Behnes umgebaut und ihm ei-
ne mit Elementen der Renaissance gestaltete,
die Unregelmäßigkeit des älteren Baus über-
spielende Schaufassade vorgelegt, die durch
Mittelrisalit und seitliche Pfeilervorlagen eine
kräftige Gliederung erhielt. Die Ziegelfassade,
deren Architekturteile und Einfassungen in
Sandstein ausgeführt sind, besitzt heute nur
noch ihr Gliederungsgerüst, während der rei-
che plastische Schmuck und alle bekrönen-
den Aufbauten oberhalb des Hauptgesimses
leider entfernt sind, sodaß der Bau viel von
seiner Blickfangfunktion am Kopf des Platzes
eingebüßt hat. Aus der älteren Bausubstanz
hat sich noch im rückwärtigen Teil des Hauses
ein zweigeschossiger Seitenflügel von 1698
erhalten.
Auf der westlichen Platzseite wahrt das 1910
erbaute Wohn- und Geschäftshaus Hasestra-
ße 46-48, das der Großen Domsfreiheit seine
Rückfront zuwendet, durch Unterteilung in
drei einzelne Baukörper mit jeweils unter-
schiedlicher Fassadengestaltung in glückli-
cher Weise die ehemalige Kleinteiligkeit der
Parzellenstruktur. Das südlich anschließende
Wohnhaus Hasestraße 45, das mit seinem
Rückgiebel zur Großen Domsfreiheit blickt,
wurde erst Ende des 18. Jh. Vikarkurie und ist
den Bürgerhäusern der Hasestraße zuzurech-
nen (s. S. 71). Ältestes erhaltenes Kurienge-
bäude am Platz ist die ehemalige Vikarie Gro-
ße Domsfreiheit 16, ein zweigeschossiges
verputztes Traufenhaus von fünf Achsen, das
wohl gegen Ende des 18. Jh. umgebaut und in
der Mittelachse um ein Sandsteinportal der
Zopfzeit bereichert wurde.
Ehemalige Fürstbischöfliche Kanzlei
Erst Ende des 16. Jh. wurde die Kanzlei des
Fürstbischofs, die bis dahin seinem wechseln-
den Hoflager gefolgt war, in Osnabrück seß-
haft. Die Land- und Justizkanzlei, die sowohl
Regierungs- wie Justizbehörde des Fürst-
bistums Osnabrück war, erhielt ihren Sitz an
der Südwestecke der Domsfreiheit am alten
Eingang zum Bischofshof. Ende des 18. Jh.
ersetzte man das Kanzleigebäude des 16. Jh.
durch einen repräsentativen Neubau (Bi-
schöfliches Generalvikariat, Hasestraße
40A). Den Entwurf, dem eine längere Zeit der
Planung vorausging, lieferte der Osnabrücker
Landbaumeister Franz Schaedler. Nach sei-
nen - in Einzelheiten veränderten - Plänen,
die, was besonders die Vorstufen zum ausge-
führten Entwurf zeigen, aus den Vorstellun-
gen des spätbarocken Palastbaus entwickelt
sind, wurde der Bau 1782-85 durch den Mau-
rermeister Anton Mang ausgeführt. Man er-
richtete über einem hohen Sockel einen frei-
stehenden, rechteckigen Sandsteinquader-
bau von zwei Geschossen und elf zu fünf Ach-
sen, der von einem hohen Walmdach über-
deckt ist und seine Hauptfassade der Hase-
straße zuwendet. West- und Ostseite erhiel-
ten jeweils dreiachsige Mittelrisalite, die um
ein Halbgeschoß erhöht und durch ein Fronti-
spiz bekrönt sind, die Schmalseiten dagegen
einachsige übergiebelte Risalite. In sparsa-
mer Anwendung gliedern Rustikalisenen,
glatte Gesimsbänder und Fenstereinfassun-
gen die Fassaden, die durch ein kräftiges
Hauptgesims abgeschlossen werden. Eine
Hervorhebung erfahren an Nord-, Süd- und
Westseite die Risalite, insbesondere der der
Große Domsfreiheit, westliche Platzseite, Nr. 16-9
Große Domsfreiheit, Nordwestecke mit
Hasestraße 45, 46-48, Große Domsfreiheit 9
Hasestraße 40A, ehern. Fürstbischöfliche Kanzlei, 1782-85, Architekt Franz Schaedler
65