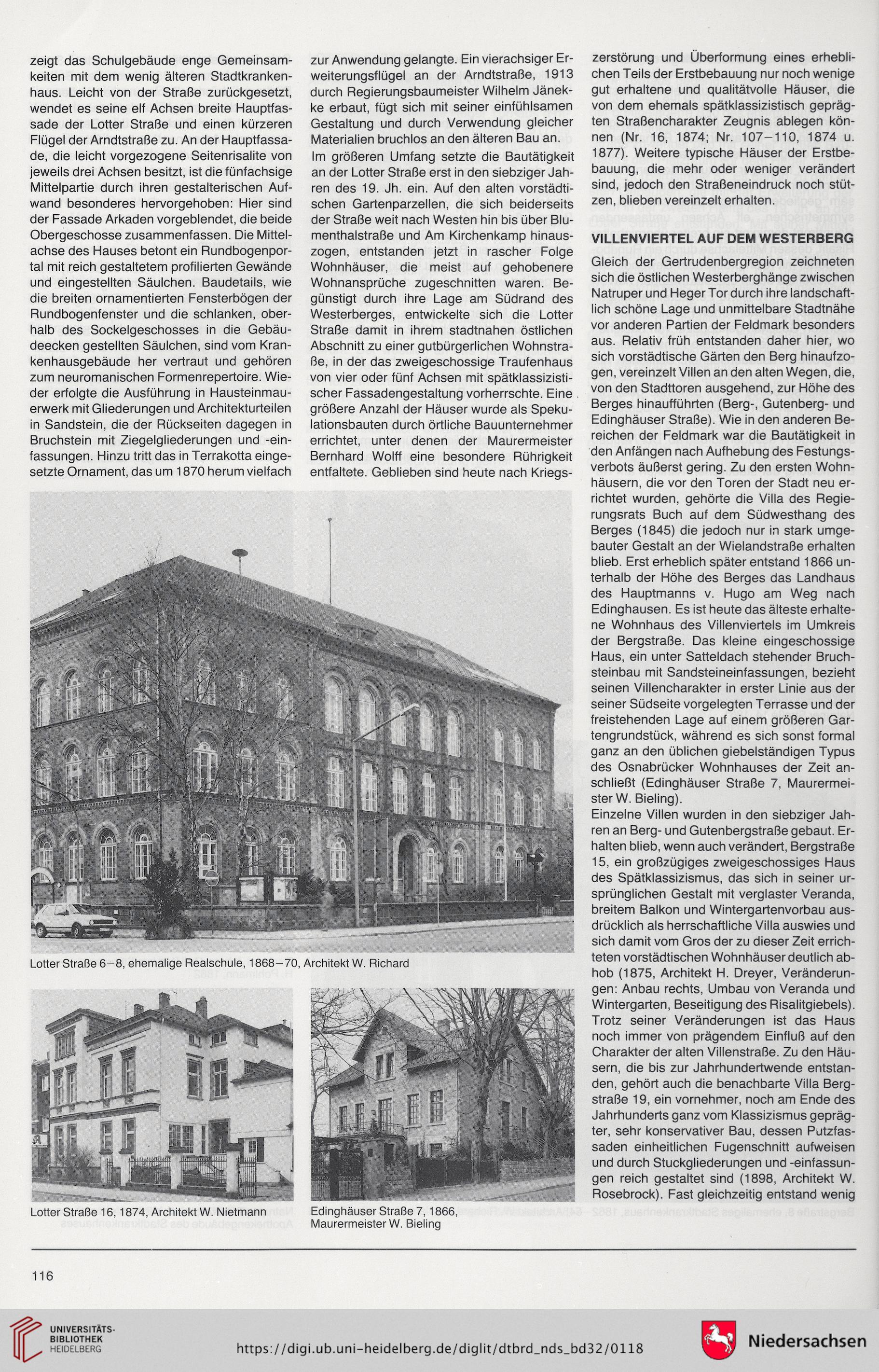zeigt das Schulgebäude enge Gemeinsam-
keiten mit dem wenig älteren Stadtkranken-
haus. Leicht von der Straße zurückgesetzt,
wendet es seine elf Achsen breite Hauptfas-
sade der Lotter Straße und einen kürzeren
Flügel der Arndtstraße zu. An der Hauptfassa-
de, die leicht vorgezogene Seitenrisalite von
jeweils drei Achsen besitzt, ist die fünfachsige
Mittelpartie durch ihren gestalterischen Auf-
wand besonderes hervorgehoben: Hier sind
der Fassade Arkaden vorgeblendet, die beide
Obergeschosse zusammenfassen. Die Mittel-
achse des Hauses betont ein Rundbogenpor-
tal mit reich gestaltetem profilierten Gewände
und eingestellten Säulchen. Baudetails, wie
die breiten ornamentierten Fensterbögen der
Rundbogenfenster und die schlanken, ober-
halb des Sockelgeschosses in die Gebäu-
deecken gestellten Säulchen, sind vom Kran-
kenhausgebäude her vertraut und gehören
zum neuromanischen Formenrepertoire. Wie-
der erfolgte die Ausführung in Hausteinmau-
erwerk mit Gliederungen und Architekturteilen
in Sandstein, die der Rückseiten dagegen in
Bruchstein mit Ziegelgliederungen und -ein-
fassungen. Hinzu tritt das in Terrakotta einge-
setzte Ornament, das um 1870 herum vielfach
zur Anwendung gelangte. Ein vierachsiger Er-
weiterungsflügel an der Arndtstraße, 1913
durch Regierungsbaumeister Wilhelm Jänek-
ke erbaut, fügt sich mit seiner einfühlsamen
Gestaltung und durch Verwendung gleicher
Materialien bruchlos an den älteren Bau an.
Im größeren Umfang setzte die Bautätigkeit
an der Lotter Straße erst in den siebziger Jah-
ren des 19. Jh. ein. Auf den alten vorstädti-
schen Gartenparzellen, die sich beiderseits
der Straße weit nach Westen hin bis über Blu-
menthalstraße und Am Kirchenkamp hinaus-
zogen, entstanden jetzt in rascher Folge
Wohnhäuser, die meist auf gehobenere
Wohnansprüche zugeschnitten waren. Be-
günstigt durch ihre Lage am Südrand des
Westerberges, entwickelte sich die Lotter
Straße damit in ihrem stadtnahen östlichen
Abschnitt zu einer gutbürgerlichen Wohnstra-
ße, in der das zweigeschossige Traufenhaus
von vier oder fünf Achsen mit spätklassizisti-
scher Fassadengestaltung vorherrschte. Eine
größere Anzahl der Häuser wurde als Speku-
lationsbauten durch örtliche Bauunternehmer
errichtet, unter denen der Maurermeister
Bernhard Wolff eine besondere Rührigkeit
entfaltete. Geblieben sind heute nach Kriegs-
Lotter Straße 6-8, ehemalige Realschule, 1868-70, Architekt W. Richard
Lotter Straße 16,1874, Architekt W. Nietmann
Edinghäuser Straße 7,1866,
Maurermeister W. Bieling
Zerstörung und Überformung eines erhebli-
chen Teils der Erstbebauung nur noch wenige
gut erhaltene und qualitätvolle Häuser, die
von dem ehemals spätklassizistisch gepräg-
ten Straßencharakter Zeugnis ablegen kön-
nen (Nr. 16, 1874; Nr. 107-110, 1874 u.
1877). Weitere typische Häuser der Erstbe-
bauung, die mehr oder weniger verändert
sind, jedoch den Straßeneindruck noch stüt-
zen, blieben vereinzelt erhalten.
VILLENVIERTEL AUF DEM WESTERBERG
Gleich der Gertrudenbergregion zeichneten
sich die östlichen Westerberghänge zwischen
Natruper und Heger Tor durch ihre landschaft-
lich schöne Lage und unmittelbare Stadtnähe
vor anderen Partien der Feldmark besonders
aus. Relativ früh entstanden daher hier, wo
sich vorstädtische Gärten den Berg hinaufzo-
gen, vereinzelt Villen an den alten Wegen, die,
von den Stadttoren ausgehend, zur Höhe des
Berges hinaufführten (Berg-, Gutenberg- und
Edinghäuser Straße). Wie in den anderen Be-
reichen der Feldmark war die Bautätigkeit in
den Anfängen nach Aufhebung des Festungs-
verbots äußerst gering. Zu den ersten Wohn-
häusern, die vor den Toren der Stadt neu er-
richtet wurden, gehörte die Villa des Regie-
rungsrats Buch auf dem Südwesthang des
Berges (1845) die jedoch nur in stark umge-
bauter Gestalt an der Wielandstraße erhalten
blieb. Erst erheblich später entstand 1866 un-
terhalb der Höhe des Berges das Landhaus
des Hauptmanns v. Hugo am Weg nach
Edinghausen. Es ist heute das älteste erhalte-
ne Wohnhaus des Villenviertels im Umkreis
der Bergstraße. Das kleine eingeschossige
Haus, ein unter Satteldach stehender Bruch-
steinbau mit Sandsteineinfassungen, bezieht
seinen Villencharakter in erster Linie aus der
seiner Südseite vorgelegten Terrasse und der
freistehenden Lage auf einem größeren Gar-
tengrundstück, während es sich sonst formal
ganz an den üblichen giebelständigen Typus
des Osnabrücker Wohnhauses der Zeit an-
schließt (Edinghäuser Straße 7, Maurermei-
ster W. Bieling).
Einzelne Villen wurden in den siebziger Jah-
ren an Berg- und Gutenbergstraße gebaut. Er-
halten blieb, wenn auch verändert, Bergstraße
15, ein großzügiges zweigeschossiges Haus
des Spätklassizismus, das sich in seiner ur-
sprünglichen Gestalt mit verglaster Veranda,
breitem Balkon und Wintergartenvorbau aus-
drücklich als herrschaftliche Villa auswies und
sich damit vom Gros der zu dieser Zeit errich-
teten vorstädtischen Wohnhäuser deutlich ab-
hob (1875, Architekt H. Dreyer, Veränderun-
gen: Anbau rechts, Umbau von Veranda und
Wintergarten, Beseitigung des Risalitgiebels).
Trotz seiner Veränderungen ist das Haus
noch immer von prägendem Einfluß auf den
Charakter der alten Villenstraße. Zu den Häu-
sern, die bis zur Jahrhundertwende entstan-
den, gehört auch die benachbarte Villa Berg-
straße 19, ein vornehmer, noch am Ende des
Jahrhunderts ganz vom Klassizismus gepräg-
ter, sehr konservativer Bau, dessen Putzfas-
saden einheitlichen Fugenschnitt aufweisen
und durch Stuckgliederungen und -einfassun-
gen reich gestaltet sind (1898, Architekt W.
Rosebrock). Fast gleichzeitig entstand wenig
116
keiten mit dem wenig älteren Stadtkranken-
haus. Leicht von der Straße zurückgesetzt,
wendet es seine elf Achsen breite Hauptfas-
sade der Lotter Straße und einen kürzeren
Flügel der Arndtstraße zu. An der Hauptfassa-
de, die leicht vorgezogene Seitenrisalite von
jeweils drei Achsen besitzt, ist die fünfachsige
Mittelpartie durch ihren gestalterischen Auf-
wand besonderes hervorgehoben: Hier sind
der Fassade Arkaden vorgeblendet, die beide
Obergeschosse zusammenfassen. Die Mittel-
achse des Hauses betont ein Rundbogenpor-
tal mit reich gestaltetem profilierten Gewände
und eingestellten Säulchen. Baudetails, wie
die breiten ornamentierten Fensterbögen der
Rundbogenfenster und die schlanken, ober-
halb des Sockelgeschosses in die Gebäu-
deecken gestellten Säulchen, sind vom Kran-
kenhausgebäude her vertraut und gehören
zum neuromanischen Formenrepertoire. Wie-
der erfolgte die Ausführung in Hausteinmau-
erwerk mit Gliederungen und Architekturteilen
in Sandstein, die der Rückseiten dagegen in
Bruchstein mit Ziegelgliederungen und -ein-
fassungen. Hinzu tritt das in Terrakotta einge-
setzte Ornament, das um 1870 herum vielfach
zur Anwendung gelangte. Ein vierachsiger Er-
weiterungsflügel an der Arndtstraße, 1913
durch Regierungsbaumeister Wilhelm Jänek-
ke erbaut, fügt sich mit seiner einfühlsamen
Gestaltung und durch Verwendung gleicher
Materialien bruchlos an den älteren Bau an.
Im größeren Umfang setzte die Bautätigkeit
an der Lotter Straße erst in den siebziger Jah-
ren des 19. Jh. ein. Auf den alten vorstädti-
schen Gartenparzellen, die sich beiderseits
der Straße weit nach Westen hin bis über Blu-
menthalstraße und Am Kirchenkamp hinaus-
zogen, entstanden jetzt in rascher Folge
Wohnhäuser, die meist auf gehobenere
Wohnansprüche zugeschnitten waren. Be-
günstigt durch ihre Lage am Südrand des
Westerberges, entwickelte sich die Lotter
Straße damit in ihrem stadtnahen östlichen
Abschnitt zu einer gutbürgerlichen Wohnstra-
ße, in der das zweigeschossige Traufenhaus
von vier oder fünf Achsen mit spätklassizisti-
scher Fassadengestaltung vorherrschte. Eine
größere Anzahl der Häuser wurde als Speku-
lationsbauten durch örtliche Bauunternehmer
errichtet, unter denen der Maurermeister
Bernhard Wolff eine besondere Rührigkeit
entfaltete. Geblieben sind heute nach Kriegs-
Lotter Straße 6-8, ehemalige Realschule, 1868-70, Architekt W. Richard
Lotter Straße 16,1874, Architekt W. Nietmann
Edinghäuser Straße 7,1866,
Maurermeister W. Bieling
Zerstörung und Überformung eines erhebli-
chen Teils der Erstbebauung nur noch wenige
gut erhaltene und qualitätvolle Häuser, die
von dem ehemals spätklassizistisch gepräg-
ten Straßencharakter Zeugnis ablegen kön-
nen (Nr. 16, 1874; Nr. 107-110, 1874 u.
1877). Weitere typische Häuser der Erstbe-
bauung, die mehr oder weniger verändert
sind, jedoch den Straßeneindruck noch stüt-
zen, blieben vereinzelt erhalten.
VILLENVIERTEL AUF DEM WESTERBERG
Gleich der Gertrudenbergregion zeichneten
sich die östlichen Westerberghänge zwischen
Natruper und Heger Tor durch ihre landschaft-
lich schöne Lage und unmittelbare Stadtnähe
vor anderen Partien der Feldmark besonders
aus. Relativ früh entstanden daher hier, wo
sich vorstädtische Gärten den Berg hinaufzo-
gen, vereinzelt Villen an den alten Wegen, die,
von den Stadttoren ausgehend, zur Höhe des
Berges hinaufführten (Berg-, Gutenberg- und
Edinghäuser Straße). Wie in den anderen Be-
reichen der Feldmark war die Bautätigkeit in
den Anfängen nach Aufhebung des Festungs-
verbots äußerst gering. Zu den ersten Wohn-
häusern, die vor den Toren der Stadt neu er-
richtet wurden, gehörte die Villa des Regie-
rungsrats Buch auf dem Südwesthang des
Berges (1845) die jedoch nur in stark umge-
bauter Gestalt an der Wielandstraße erhalten
blieb. Erst erheblich später entstand 1866 un-
terhalb der Höhe des Berges das Landhaus
des Hauptmanns v. Hugo am Weg nach
Edinghausen. Es ist heute das älteste erhalte-
ne Wohnhaus des Villenviertels im Umkreis
der Bergstraße. Das kleine eingeschossige
Haus, ein unter Satteldach stehender Bruch-
steinbau mit Sandsteineinfassungen, bezieht
seinen Villencharakter in erster Linie aus der
seiner Südseite vorgelegten Terrasse und der
freistehenden Lage auf einem größeren Gar-
tengrundstück, während es sich sonst formal
ganz an den üblichen giebelständigen Typus
des Osnabrücker Wohnhauses der Zeit an-
schließt (Edinghäuser Straße 7, Maurermei-
ster W. Bieling).
Einzelne Villen wurden in den siebziger Jah-
ren an Berg- und Gutenbergstraße gebaut. Er-
halten blieb, wenn auch verändert, Bergstraße
15, ein großzügiges zweigeschossiges Haus
des Spätklassizismus, das sich in seiner ur-
sprünglichen Gestalt mit verglaster Veranda,
breitem Balkon und Wintergartenvorbau aus-
drücklich als herrschaftliche Villa auswies und
sich damit vom Gros der zu dieser Zeit errich-
teten vorstädtischen Wohnhäuser deutlich ab-
hob (1875, Architekt H. Dreyer, Veränderun-
gen: Anbau rechts, Umbau von Veranda und
Wintergarten, Beseitigung des Risalitgiebels).
Trotz seiner Veränderungen ist das Haus
noch immer von prägendem Einfluß auf den
Charakter der alten Villenstraße. Zu den Häu-
sern, die bis zur Jahrhundertwende entstan-
den, gehört auch die benachbarte Villa Berg-
straße 19, ein vornehmer, noch am Ende des
Jahrhunderts ganz vom Klassizismus gepräg-
ter, sehr konservativer Bau, dessen Putzfas-
saden einheitlichen Fugenschnitt aufweisen
und durch Stuckgliederungen und -einfassun-
gen reich gestaltet sind (1898, Architekt W.
Rosebrock). Fast gleichzeitig entstand wenig
116