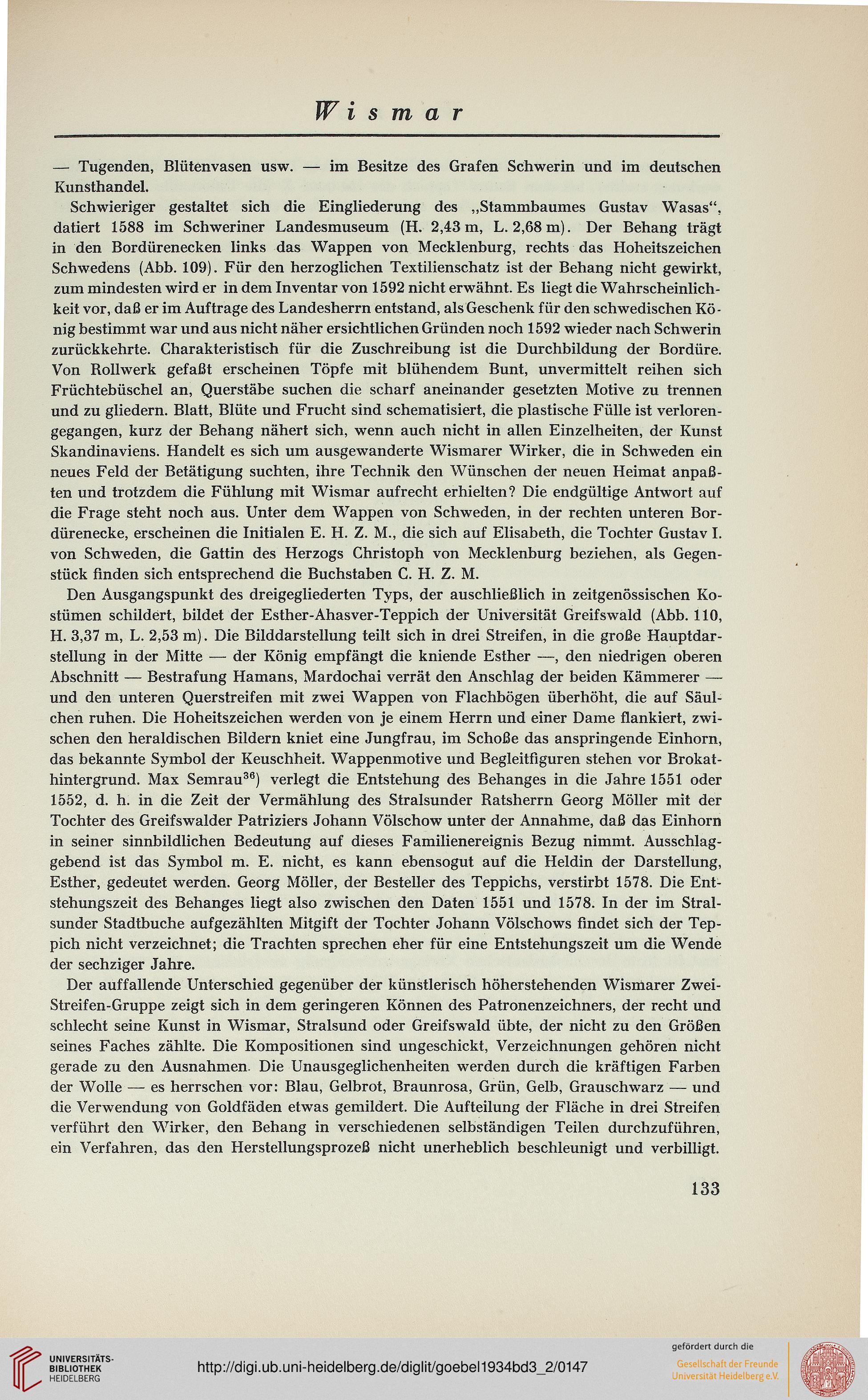Wismar
— Tugenden, Blütenvasen usw. — im Besitze des Grafen Schwerin und im deutschen
Kunsthandel.
Schwieriger gestaltet sich die Eingliederung des „Stammbaumes Gustav Wasas",
datiert 1588 im Schweriner Landesmuseum (H. 2,43 m, L. 2,68 m). Der Behang trägt
in den Bordürenecken links das Wappen von Mecklenburg, rechts das Hoheitszeichen
Schwedens (Abb. 109). Für den herzoglichen Textilienschatz ist der Behang nicht gewirkt,
zum mindesten wird er in dem Inventar von 1592 nicht erwähnt. Es liegt die Wahrscheinlich-
keit vor, daß er im Auftrage des Landesherrn entstand, als Geschenk für den schwedischen Kö-
nig bestimmt war und aus nicht näher ersichtlichen Gründen noch 1592 wieder nach Schwerin
zurückkehrte. Charakteristisch für die Zuschreibung ist die Durchbildung der Bordüre.
Von Rollwerk gefaßt erscheinen Töpfe mit blühendem Bunt, unvermittelt reihen sich
Früchtebüschel an, Querstäbe suchen die scharf aneinander gesetzten Motive zu trennen
und zu gliedern. Blatt, Blüte und Frucht sind schematisiert, die plastische Fülle ist verloren-
gegangen, kurz der Behang nähert sich, wenn auch nicht in allen Einzelheiten, der Kunst
Skandinaviens. Handelt es sich um ausgewanderte Wismarer Wirker, die in Schweden ein
neues Feld der Betätigung suchten, ihre Technik den Wünschen der neuen Heimat anpaß-
ten und trotzdem die Fühlung mit Wismar aufrecht erhielten? Die endgültige Antwort auf
die Frage steht noch aus. Unter dem Wappen von Schweden, in der rechten unteren Bor-
dürenecke, erscheinen die Initialen E. H. Z. M., die sich auf Elisabeth, die Tochter Gustav I.
von Schweden, die Gattin des Herzogs Christoph von Mecklenburg beziehen, als Gegen-
stück finden sich entsprechend die Buchstaben C. H. Z. M.
Den Ausgangspunkt des dreigegliederten Typs, der auschließlich in zeitgenössischen Ko-
stümen schildert, bildet der Esther-Ahasver-Teppich der Universität Greifswald (Abb. 110,
H. 3,37 m, L. 2,53 m). Die Bilddarstellung teilt sich in drei Streifen, in die große Hauptdar-
stellung in der Mitte — der König empfängt die kniende Esther —, den niedrigen oberen
Abschnitt — Bestrafung Hamans, Mardochai verrät den Anschlag der beiden Kämmerer —
und den unteren Querstreifen mit zwei Wappen von Flachbögen überhöht, die auf Säul-
chen ruhen. Die Hoheitszeichen werden von je einem Herrn und einer Dame flankiert, zwi-
schen den heraldischen Bildern kniet eine Jungfrau, im Schöße das anspringende Einhorn,
das bekannte Symbol der Keuschheit. Wappenmotive und Begleitfiguren stehen vor Brokat-
hintergrund. Max Semrau38) verlegt die Entstehung des Behanges in die Jahre 1551 oder
1552, d. h. in die Zeit der Vermählung des Stralsunder Ratsherrn Georg Möller mit der
Tochter des Greifswalder Patriziers Johann Völschow unter der Annahme, daß das Einhorn
in seiner sinnbildlichen Bedeutung auf dieses Familienereignis Bezug nimmt. Ausschlag-
gebend ist das Symbol m. E. nicht, es kann ebensogut auf die Heldin der Darstellung,
Esther, gedeutet werden. Georg Möller, der Besteller des Teppichs, verstirbt 1578. Die Ent-
stehungszeit des Behanges liegt also zwischen den Daten 1551 und 1578. In der im Stral-
sunder Stadtbuche aufgezählten Mitgift der Tochter Johann Völschows findet sich der Tep-
pich nicht verzeichnet; die Trachten sprechen eher für eine Entstehungszeit um die Wende
der sechziger Jahre.
Der auffallende Unterschied gegenüber der künstlerisch höherstehenden Wismarer Zwei-
Streifen-Gruppe zeigt sich in dem geringeren Können des Patronenzeichners, der recht und
schlecht seine Kunst in Wismar, Stralsund oder Greifswald übte, der nicht zu den Größen
seines Faches zählte. Die Kompositionen sind ungeschickt, Verzeichnungen gehören nicht
gerade zu den Ausnahmen. Die Unausgeglichenheiten werden durch die kräftigen Farben
der Wolle — es herrschen vor: Blau, Gelbrot, Braunrosa, Grün, Gelb, Grauschwarz — und
die Verwendung von Goldfäden etwas gemildert. Die Aufteilung der Fläche in drei Streifen
verführt den Wirker, den Behang in verschiedenen selbständigen Teilen durchzuführen,
ein Verfahren, das den Herstellungsprozeß nicht unerheblich beschleunigt und verbilligt.
133
— Tugenden, Blütenvasen usw. — im Besitze des Grafen Schwerin und im deutschen
Kunsthandel.
Schwieriger gestaltet sich die Eingliederung des „Stammbaumes Gustav Wasas",
datiert 1588 im Schweriner Landesmuseum (H. 2,43 m, L. 2,68 m). Der Behang trägt
in den Bordürenecken links das Wappen von Mecklenburg, rechts das Hoheitszeichen
Schwedens (Abb. 109). Für den herzoglichen Textilienschatz ist der Behang nicht gewirkt,
zum mindesten wird er in dem Inventar von 1592 nicht erwähnt. Es liegt die Wahrscheinlich-
keit vor, daß er im Auftrage des Landesherrn entstand, als Geschenk für den schwedischen Kö-
nig bestimmt war und aus nicht näher ersichtlichen Gründen noch 1592 wieder nach Schwerin
zurückkehrte. Charakteristisch für die Zuschreibung ist die Durchbildung der Bordüre.
Von Rollwerk gefaßt erscheinen Töpfe mit blühendem Bunt, unvermittelt reihen sich
Früchtebüschel an, Querstäbe suchen die scharf aneinander gesetzten Motive zu trennen
und zu gliedern. Blatt, Blüte und Frucht sind schematisiert, die plastische Fülle ist verloren-
gegangen, kurz der Behang nähert sich, wenn auch nicht in allen Einzelheiten, der Kunst
Skandinaviens. Handelt es sich um ausgewanderte Wismarer Wirker, die in Schweden ein
neues Feld der Betätigung suchten, ihre Technik den Wünschen der neuen Heimat anpaß-
ten und trotzdem die Fühlung mit Wismar aufrecht erhielten? Die endgültige Antwort auf
die Frage steht noch aus. Unter dem Wappen von Schweden, in der rechten unteren Bor-
dürenecke, erscheinen die Initialen E. H. Z. M., die sich auf Elisabeth, die Tochter Gustav I.
von Schweden, die Gattin des Herzogs Christoph von Mecklenburg beziehen, als Gegen-
stück finden sich entsprechend die Buchstaben C. H. Z. M.
Den Ausgangspunkt des dreigegliederten Typs, der auschließlich in zeitgenössischen Ko-
stümen schildert, bildet der Esther-Ahasver-Teppich der Universität Greifswald (Abb. 110,
H. 3,37 m, L. 2,53 m). Die Bilddarstellung teilt sich in drei Streifen, in die große Hauptdar-
stellung in der Mitte — der König empfängt die kniende Esther —, den niedrigen oberen
Abschnitt — Bestrafung Hamans, Mardochai verrät den Anschlag der beiden Kämmerer —
und den unteren Querstreifen mit zwei Wappen von Flachbögen überhöht, die auf Säul-
chen ruhen. Die Hoheitszeichen werden von je einem Herrn und einer Dame flankiert, zwi-
schen den heraldischen Bildern kniet eine Jungfrau, im Schöße das anspringende Einhorn,
das bekannte Symbol der Keuschheit. Wappenmotive und Begleitfiguren stehen vor Brokat-
hintergrund. Max Semrau38) verlegt die Entstehung des Behanges in die Jahre 1551 oder
1552, d. h. in die Zeit der Vermählung des Stralsunder Ratsherrn Georg Möller mit der
Tochter des Greifswalder Patriziers Johann Völschow unter der Annahme, daß das Einhorn
in seiner sinnbildlichen Bedeutung auf dieses Familienereignis Bezug nimmt. Ausschlag-
gebend ist das Symbol m. E. nicht, es kann ebensogut auf die Heldin der Darstellung,
Esther, gedeutet werden. Georg Möller, der Besteller des Teppichs, verstirbt 1578. Die Ent-
stehungszeit des Behanges liegt also zwischen den Daten 1551 und 1578. In der im Stral-
sunder Stadtbuche aufgezählten Mitgift der Tochter Johann Völschows findet sich der Tep-
pich nicht verzeichnet; die Trachten sprechen eher für eine Entstehungszeit um die Wende
der sechziger Jahre.
Der auffallende Unterschied gegenüber der künstlerisch höherstehenden Wismarer Zwei-
Streifen-Gruppe zeigt sich in dem geringeren Können des Patronenzeichners, der recht und
schlecht seine Kunst in Wismar, Stralsund oder Greifswald übte, der nicht zu den Größen
seines Faches zählte. Die Kompositionen sind ungeschickt, Verzeichnungen gehören nicht
gerade zu den Ausnahmen. Die Unausgeglichenheiten werden durch die kräftigen Farben
der Wolle — es herrschen vor: Blau, Gelbrot, Braunrosa, Grün, Gelb, Grauschwarz — und
die Verwendung von Goldfäden etwas gemildert. Die Aufteilung der Fläche in drei Streifen
verführt den Wirker, den Behang in verschiedenen selbständigen Teilen durchzuführen,
ein Verfahren, das den Herstellungsprozeß nicht unerheblich beschleunigt und verbilligt.
133