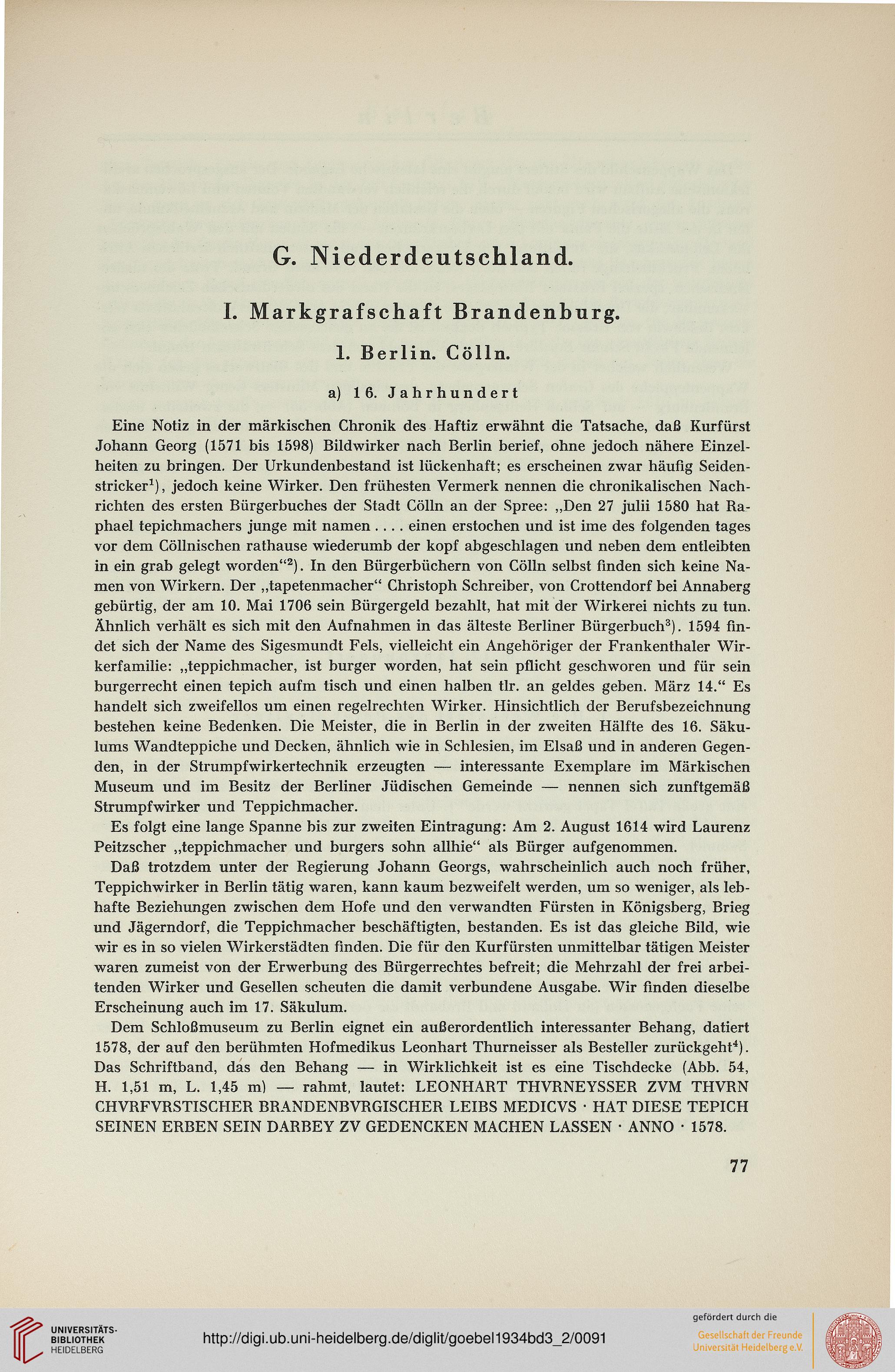G. Niederdeutschland.
I. Markgrafschaft Brandenburg.
1. Berlin. Cölln.
a) 16. Jahrhundert
Eine Notiz in der märkischen Chronik des Haftiz erwähnt die Tatsache, daß Kurfürst
Johann Georg (1571 bis 1598) Bildwirker nach Berlin berief, ohne jedoch nähere Einzel-
heiten zu bringen. Der Urkundenbestand ist lückenhaft; es erscheinen zwar häufig Seiden-
stricker1) , jedoch keine Wirker. Den frühesten Vermerk nennen die chronikalischen Nach-
richten des ersten Bürgerbuches der Stadt Cölln an der Spree: „Den 27 julii 1580 hat Ra-
phael tepichmachers junge mit namen .... einen erstochen und ist ime des folgenden tages
vor dem Cöllnischen rathause wiederumb der köpf abgeschlagen und neben dem entleibten
in ein grab gelegt worden"2). In den Bürgerbüchern von Cölln selbst finden sich keine Na-
men von Wirkern. Der „tapetenmacher" Christoph Schreiber, von Crottendorf bei Annaberg
gebürtig, der am 10. Mai 1706 sein Bürgergeld bezahlt, hat mit der Wirkerei nichts zu tun.
Ähnlich verhält es sich mit den Aufnahmen in das älteste Berliner Bürgerbuch3). 1594 fin-
det sich der Name des Sigesmundt Fels, vielleicht ein Angehöriger der Frankenthaler Wir-
kerfamilie: „teppichmacher, ist burger worden, hat sein pflicht geschworen und für sein
burgerrecht einen tepich aufm lisch und einen halben tlr. an geldes geben. März 14." Es
handelt sich zweifellos um einen regelrechten Wirker. Hinsichtlich der Berufsbezeichnung
bestehen keine Bedenken. Die Meister, die in Berlin in der zweiten Hälfte des 16. Säku-
lums Wandteppiche und Decken, ähnlich wie in Schlesien, im Elsaß und in anderen Gegen-
den, in der Strumpfwirkertechnik erzeugten — interessante Exemplare im Märkischen
Museum und im Besitz der Berliner Jüdischen Gemeinde — nennen sich zunftgemäß
Strumpfwirker und Teppichmacher.
Es folgt eine lange Spanne bis zur zweiten Eintragung: Am 2. August 1614 wird Laurenz
Peitzscher „teppichmacher und burgers söhn allhie" als Bürger aufgenommen.
Daß trotzdem unter der Regierung Johann Georgs, wahrscheinlich auch noch früher,
Teppichwirker in Berlin tätig waren, kann kaum bezweifelt werden, um so weniger, als leb-
hafte Beziehungen zwischen dem Hofe und den verwandten Fürsten in Königsberg, Brieg
und Jägerndorf, die Teppichmacher beschäftigten, bestanden. Es ist das gleiche Bild, wie
wir es in so vielen Wirkerstädten finden. Die für den Kurfürsten unmittelbar tätigen Meister
waren zumeist von der Erwerbung des Bürgerrechtes befreit; die Mehrzahl der frei arbei-
tenden Wirker und Gesellen scheuten die damit verbundene Ausgabe. Wir finden dieselbe
Erscheinung auch im 17. Säkulum.
Dem Schloßmuseum zu Berlin eignet ein außerordentlich interessanter Behang, datiert
1578, der auf den berühmten Hofmedikus Leonhart Thurneisser als Besteller zurückgeht4).
Das Schriftband, das den Behang — in Wirklichkeit ist es eine Tischdecke (Abb. 54,
H. 1,51 m, L. 1,45 m) — rahmt, lautet: LEONHART THVRNEYSSER ZVM THVRN
CHVRFVRSTISCHER BRANDENBVRGISCHER LEIBS MEDICVS ■ HAT DIESE TEPICH
SEINEN ERBEN SEIN DARBEY ZV GEDENCKEN MACHEN LASSEN ■ ANNO ■ 1578.
77
I. Markgrafschaft Brandenburg.
1. Berlin. Cölln.
a) 16. Jahrhundert
Eine Notiz in der märkischen Chronik des Haftiz erwähnt die Tatsache, daß Kurfürst
Johann Georg (1571 bis 1598) Bildwirker nach Berlin berief, ohne jedoch nähere Einzel-
heiten zu bringen. Der Urkundenbestand ist lückenhaft; es erscheinen zwar häufig Seiden-
stricker1) , jedoch keine Wirker. Den frühesten Vermerk nennen die chronikalischen Nach-
richten des ersten Bürgerbuches der Stadt Cölln an der Spree: „Den 27 julii 1580 hat Ra-
phael tepichmachers junge mit namen .... einen erstochen und ist ime des folgenden tages
vor dem Cöllnischen rathause wiederumb der köpf abgeschlagen und neben dem entleibten
in ein grab gelegt worden"2). In den Bürgerbüchern von Cölln selbst finden sich keine Na-
men von Wirkern. Der „tapetenmacher" Christoph Schreiber, von Crottendorf bei Annaberg
gebürtig, der am 10. Mai 1706 sein Bürgergeld bezahlt, hat mit der Wirkerei nichts zu tun.
Ähnlich verhält es sich mit den Aufnahmen in das älteste Berliner Bürgerbuch3). 1594 fin-
det sich der Name des Sigesmundt Fels, vielleicht ein Angehöriger der Frankenthaler Wir-
kerfamilie: „teppichmacher, ist burger worden, hat sein pflicht geschworen und für sein
burgerrecht einen tepich aufm lisch und einen halben tlr. an geldes geben. März 14." Es
handelt sich zweifellos um einen regelrechten Wirker. Hinsichtlich der Berufsbezeichnung
bestehen keine Bedenken. Die Meister, die in Berlin in der zweiten Hälfte des 16. Säku-
lums Wandteppiche und Decken, ähnlich wie in Schlesien, im Elsaß und in anderen Gegen-
den, in der Strumpfwirkertechnik erzeugten — interessante Exemplare im Märkischen
Museum und im Besitz der Berliner Jüdischen Gemeinde — nennen sich zunftgemäß
Strumpfwirker und Teppichmacher.
Es folgt eine lange Spanne bis zur zweiten Eintragung: Am 2. August 1614 wird Laurenz
Peitzscher „teppichmacher und burgers söhn allhie" als Bürger aufgenommen.
Daß trotzdem unter der Regierung Johann Georgs, wahrscheinlich auch noch früher,
Teppichwirker in Berlin tätig waren, kann kaum bezweifelt werden, um so weniger, als leb-
hafte Beziehungen zwischen dem Hofe und den verwandten Fürsten in Königsberg, Brieg
und Jägerndorf, die Teppichmacher beschäftigten, bestanden. Es ist das gleiche Bild, wie
wir es in so vielen Wirkerstädten finden. Die für den Kurfürsten unmittelbar tätigen Meister
waren zumeist von der Erwerbung des Bürgerrechtes befreit; die Mehrzahl der frei arbei-
tenden Wirker und Gesellen scheuten die damit verbundene Ausgabe. Wir finden dieselbe
Erscheinung auch im 17. Säkulum.
Dem Schloßmuseum zu Berlin eignet ein außerordentlich interessanter Behang, datiert
1578, der auf den berühmten Hofmedikus Leonhart Thurneisser als Besteller zurückgeht4).
Das Schriftband, das den Behang — in Wirklichkeit ist es eine Tischdecke (Abb. 54,
H. 1,51 m, L. 1,45 m) — rahmt, lautet: LEONHART THVRNEYSSER ZVM THVRN
CHVRFVRSTISCHER BRANDENBVRGISCHER LEIBS MEDICVS ■ HAT DIESE TEPICH
SEINEN ERBEN SEIN DARBEY ZV GEDENCKEN MACHEN LASSEN ■ ANNO ■ 1578.
77