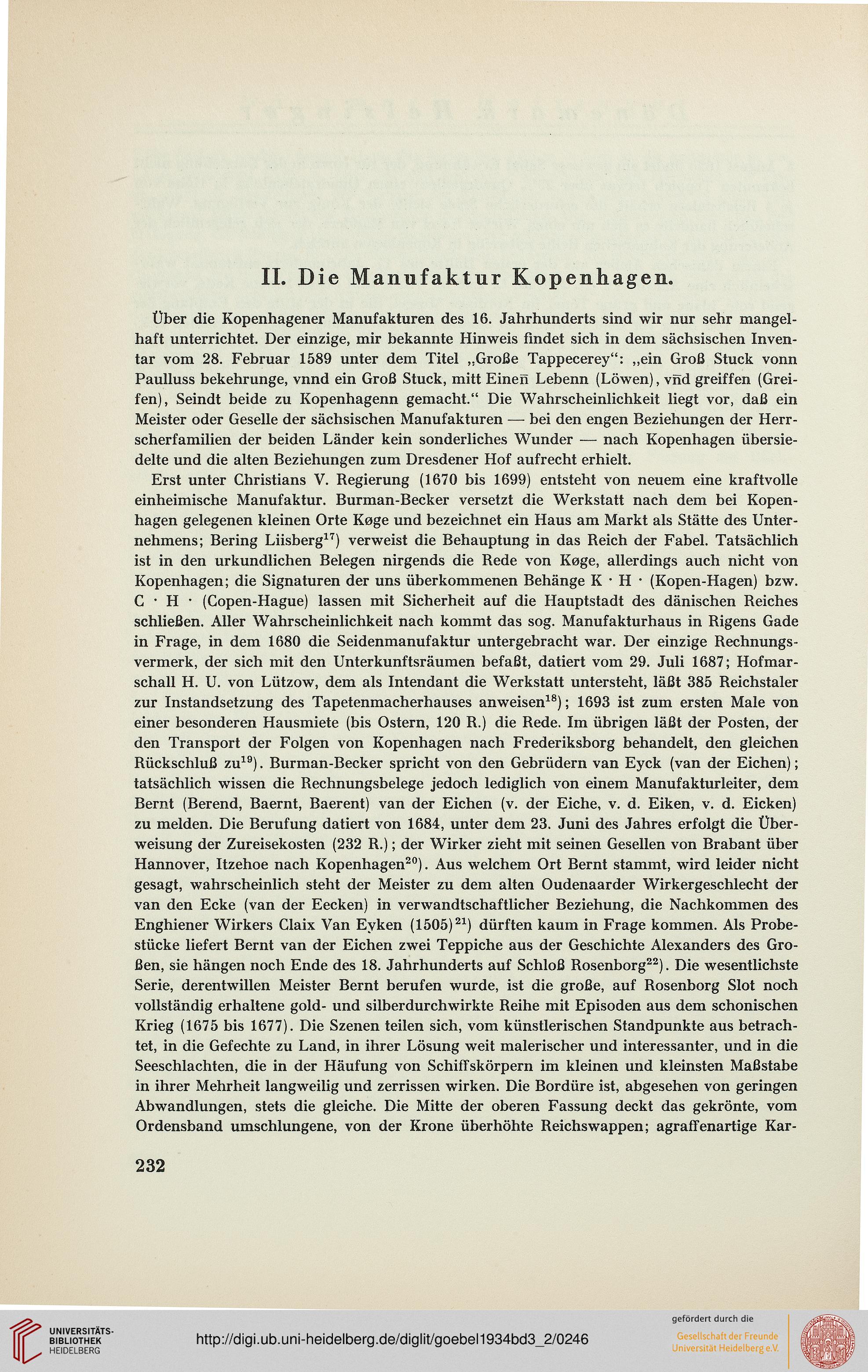II. Die Manufaktur Kopenhagen.
Über die Kopenhagener Manufakturen des 16. Jahrhunderts sind wir nur sehr mangel-
haft unterrichtet. Der einzige, mir bekannte Hinweis findet sich in dem sächsischen Inven-
tar vom 28. Februar 1589 unter dem Titel „Große Tappecerey": „ein Groß Stuck vonn
Paulluss bekehrunge, vnnd ein Groß Stuck, mitt Einen Lebenn (Löwen), vnd greiffen (Grei-
fen), Seindt beide zu Kopenhagenn gemacht." Die Wahrscheinlichkeit liegt vor, daß ein
Meister oder Geselle der sächsischen Manufakturen — bei den engen Beziehungen der Herr-
scherfamilien der beiden Länder kein sonderliches Wunder — nach Kopenhagen übersie-
delte und die alten Beziehungen zum Dresdener Hof aufrecht erhielt.
Erst unter Christians V. Regierung (1670 bis 1699) entsteht von neuem eine kraftvolle
einheimische Manufaktur. Burman-Becker versetzt die Werkstatt nach dem bei Kopen-
hagen gelegenen kleinen Orte Koge und bezeichnet ein Haus am Markt als Stätte des Unter-
nehmens; Bering Lüsberg17) verweist die Behauptung in das Reich der Fabel. Tatsächlich
ist in den urkundlichen Belegen nirgends die Rede von Koge, allerdings auch nicht von
Kopenhagen; die Signaturen der uns überkommenen Behänge K • H • (Kopen-Hagen) bzw.
C • H • (Copen-Hague) lassen mit Sicherheit auf die Hauptstadt des dänischen Reiches
schließen. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt das sog. Manufakturhaus in Rigens Gade
in Frage, in dem 1680 die Seidenmanufaktur untergebracht war. Der einzige Rechnungs-
vermerk, der sich mit den Unterkunftsräumen befaßt, datiert vom 29. Juli 1687; Hofmar-
schall H. U. von Lützow, dem als Intendant die Werkstatt untersteht, läßt 385 Reichstaler
zur Instandsetzung des Tapetenmacherhauses anweisen18); 1693 ist zum ersten Male von
einer besonderen Hausmiete (bis Ostern, 120 R.) die Rede. Im übrigen läßt der Posten, der
den Transport der Folgen von Kopenhagen nach Frederiksborg behandelt, den gleichen
Rückschluß zu19). Burman-Becker spricht von den Gebrüdern van Eyck (van der Eichen);
tatsächlich wissen die Rechnungsbelege jedoch lediglich von einem Manufakturleiter, dem
Bernt (Berend, Baernt, Baerent) van der Eichen (v. der Eiche, v. d. Eiken, v. d. Eicken)
zu melden. Die Berufung datiert von 1684, unter dem 23. Juni des Jahres erfolgt die Über-
weisung der Zureisekosten (232 R.); der Wirker zieht mit seinen Gesellen von Brabant über
Hannover, Itzehoe nach Kopenhagen20). Aus welchem Ort Bernt stammt, wird leider nicht
gesagt, wahrscheinlich steht der Meister zu dem alten Oudenaarder Wirkergeschlecht der
van den Ecke (van der Eecken) in verwandtschaftlicher Beziehung, die Nachkommen des
Enghiener Wirkers Claix Van Eyken (1505)21) dürften kaum in Frage kommen. Als Probe-
stücke liefert Bernt van der Eichen zwei Teppiche aus der Geschichte Alexanders des Gro-
ßen, sie hängen noch Ende des 18. Jahrhunderts auf Schloß Rosenborg22). Die wesentlichste
Serie, derentwillen Meister Bernt berufen wurde, ist die große, auf Rosenborg Slot noch
vollständig erhaltene gold- und silberdurchwirkte Reihe mit Episoden aus dem schonischen
Krieg (1675 bis 1677). Die Szenen teilen sich, vom künstlerischen Standpunkte aus betrach-
tet, in die Gefechte zu Land, in ihrer Lösung weit malerischer und interessanter, und in die
Seeschlachten, die in der Häufung von Schiffskörpern im kleinen und kleinsten Maßstabe
in ihrer Mehrheit langweilig und zerrissen wirken. Die Bordüre ist, abgesehen von geringen
Abwandlungen, stets die gleiche. Die Mitte der oberen Fassung deckt das gekrönte, vom
Ordensband umschlungene, von der Krone überhöhte Reichswappen; agraffenartige Kar-
232
Über die Kopenhagener Manufakturen des 16. Jahrhunderts sind wir nur sehr mangel-
haft unterrichtet. Der einzige, mir bekannte Hinweis findet sich in dem sächsischen Inven-
tar vom 28. Februar 1589 unter dem Titel „Große Tappecerey": „ein Groß Stuck vonn
Paulluss bekehrunge, vnnd ein Groß Stuck, mitt Einen Lebenn (Löwen), vnd greiffen (Grei-
fen), Seindt beide zu Kopenhagenn gemacht." Die Wahrscheinlichkeit liegt vor, daß ein
Meister oder Geselle der sächsischen Manufakturen — bei den engen Beziehungen der Herr-
scherfamilien der beiden Länder kein sonderliches Wunder — nach Kopenhagen übersie-
delte und die alten Beziehungen zum Dresdener Hof aufrecht erhielt.
Erst unter Christians V. Regierung (1670 bis 1699) entsteht von neuem eine kraftvolle
einheimische Manufaktur. Burman-Becker versetzt die Werkstatt nach dem bei Kopen-
hagen gelegenen kleinen Orte Koge und bezeichnet ein Haus am Markt als Stätte des Unter-
nehmens; Bering Lüsberg17) verweist die Behauptung in das Reich der Fabel. Tatsächlich
ist in den urkundlichen Belegen nirgends die Rede von Koge, allerdings auch nicht von
Kopenhagen; die Signaturen der uns überkommenen Behänge K • H • (Kopen-Hagen) bzw.
C • H • (Copen-Hague) lassen mit Sicherheit auf die Hauptstadt des dänischen Reiches
schließen. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt das sog. Manufakturhaus in Rigens Gade
in Frage, in dem 1680 die Seidenmanufaktur untergebracht war. Der einzige Rechnungs-
vermerk, der sich mit den Unterkunftsräumen befaßt, datiert vom 29. Juli 1687; Hofmar-
schall H. U. von Lützow, dem als Intendant die Werkstatt untersteht, läßt 385 Reichstaler
zur Instandsetzung des Tapetenmacherhauses anweisen18); 1693 ist zum ersten Male von
einer besonderen Hausmiete (bis Ostern, 120 R.) die Rede. Im übrigen läßt der Posten, der
den Transport der Folgen von Kopenhagen nach Frederiksborg behandelt, den gleichen
Rückschluß zu19). Burman-Becker spricht von den Gebrüdern van Eyck (van der Eichen);
tatsächlich wissen die Rechnungsbelege jedoch lediglich von einem Manufakturleiter, dem
Bernt (Berend, Baernt, Baerent) van der Eichen (v. der Eiche, v. d. Eiken, v. d. Eicken)
zu melden. Die Berufung datiert von 1684, unter dem 23. Juni des Jahres erfolgt die Über-
weisung der Zureisekosten (232 R.); der Wirker zieht mit seinen Gesellen von Brabant über
Hannover, Itzehoe nach Kopenhagen20). Aus welchem Ort Bernt stammt, wird leider nicht
gesagt, wahrscheinlich steht der Meister zu dem alten Oudenaarder Wirkergeschlecht der
van den Ecke (van der Eecken) in verwandtschaftlicher Beziehung, die Nachkommen des
Enghiener Wirkers Claix Van Eyken (1505)21) dürften kaum in Frage kommen. Als Probe-
stücke liefert Bernt van der Eichen zwei Teppiche aus der Geschichte Alexanders des Gro-
ßen, sie hängen noch Ende des 18. Jahrhunderts auf Schloß Rosenborg22). Die wesentlichste
Serie, derentwillen Meister Bernt berufen wurde, ist die große, auf Rosenborg Slot noch
vollständig erhaltene gold- und silberdurchwirkte Reihe mit Episoden aus dem schonischen
Krieg (1675 bis 1677). Die Szenen teilen sich, vom künstlerischen Standpunkte aus betrach-
tet, in die Gefechte zu Land, in ihrer Lösung weit malerischer und interessanter, und in die
Seeschlachten, die in der Häufung von Schiffskörpern im kleinen und kleinsten Maßstabe
in ihrer Mehrheit langweilig und zerrissen wirken. Die Bordüre ist, abgesehen von geringen
Abwandlungen, stets die gleiche. Die Mitte der oberen Fassung deckt das gekrönte, vom
Ordensband umschlungene, von der Krone überhöhte Reichswappen; agraffenartige Kar-
232