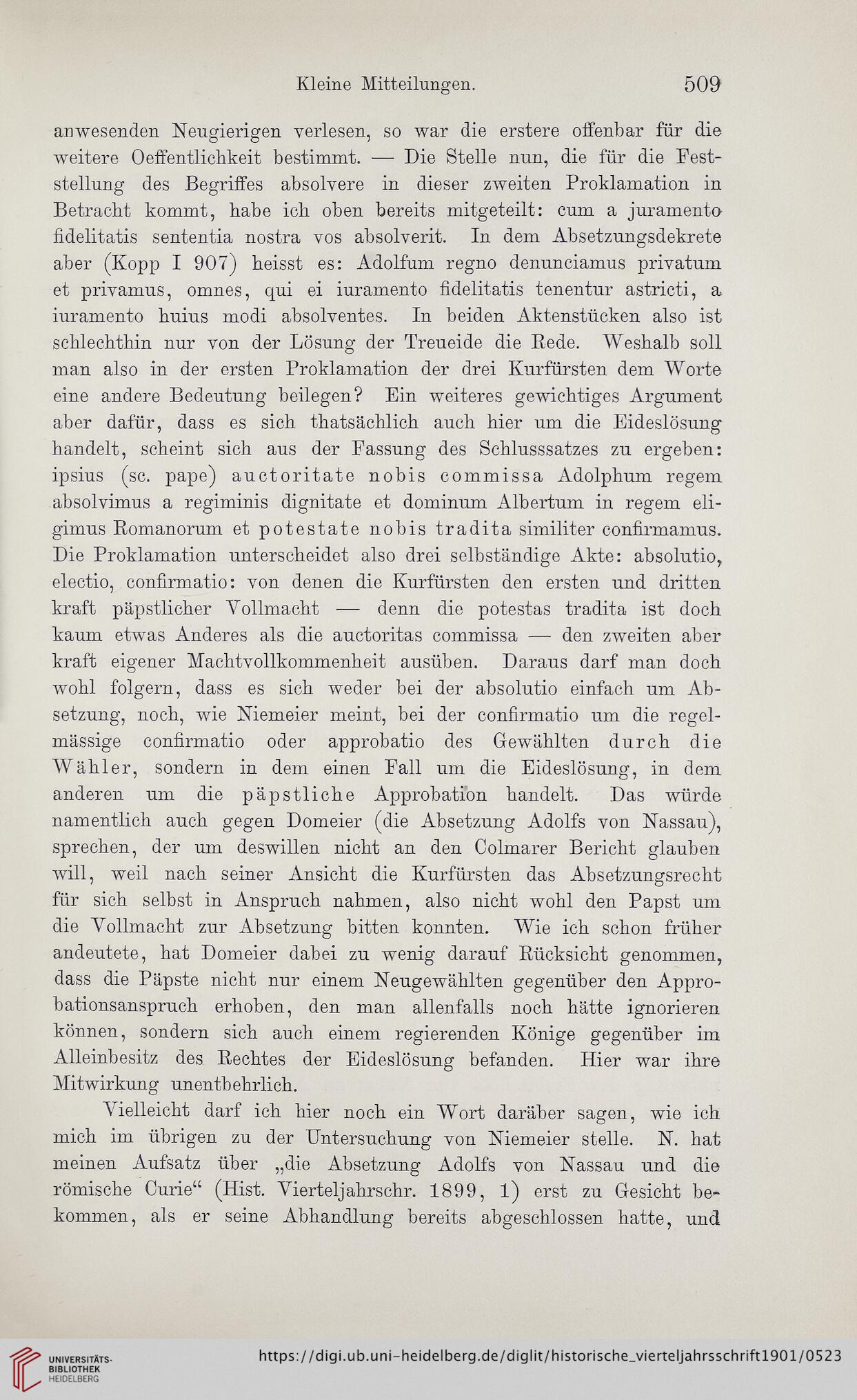Kleine Mitteilungen. 509
anwesenden Neugierigen verlesen, so war die erstere offenbar für die
weitere Oeffentlichkeit bestimmt. — Die Stelle nun, die für die Fest-
stellung des Begriffes absolvere in dieser zweiten Proklamation ın
Betracht kommt, habe ich oben bereits mitgeteilt: cum a juramento
fidelitatis sententia nostra vos absolverit. In dem Absetzungsdekrete
aber (Kopp I 907) heisst es: Adolfum regno denunciamus privatum
et privamus, omnes, qui ei iuramento fidelitatis tenentur astricti, a
ijuramento huius modi absolventes. In beiden Aktenstücken also ist
schlechthin nur von der Lösung der Treueide die Rede. Weshalb soll
man also in der ersten Proklamation der drei Kurfürsten dem Worte
eine andere Bedeutung beilegen? Ein weiteres gewichtiges Argument
aber dafür, dass es sich thatsächlich auch hier um die KEideslösung
handelt, scheint sich aus der Fassung des Schlusssatzes zu ergeben:
ipsius (sc. pape) auctoritate nobis commissa Adolphum regem
absolvimus a regiminiıs dignitate et dominum Albertum in regem eli-
gimus Romanorum et potestate nobis tradita similiter confirmamus.
Die Proklamation unterscheidet also drei selbständige Akte: absolutio,
electio, confirmatio: von denen die Kurfürsten den ersten und dritten
kraft päpstlicher Vollmacht — denn die potestas tradita ist doch
kaum etwas Anderes als die auctoritas commissa — den zweiten aber
kraft eigener Machtvollkommenheit ausüben. Daraus darf man doch
wohl folgern, dass es sich weder bei der absolutio einfach um Ab-
setzung, noch, wie Niemeier meint, bei der confirmatio um die regel-
mässige confirmatio oder approbatio des Gewählten durch die
Wähler, sondern in dem einen Fall um die Eideslösung, in dem
anderen um die päpstliche Approbation handelt. Das würde.
namentlich auch gegen Domeier (die Absetzung Adolfs von Nassau),
sprechen, der um deswillen nicht an den Colmarer Bericht glauben
will, weil nach seiner Ansicht die Kurfürsten das Absetzungsrecht
für sich selbst in Anspruch nahmen, also nicht wohl den Papst um
die Vollmacht zur Absetzung bitten konnten. Wie ich schon früher
andeutete, hat Domeier dabei zu wenig darauf Rücksicht genommen,
dass die Päpste nicht nur einem Neugewählten gegenüber den Appro-
bationsanspruch erhoben, den man allenfalls noch hätte ignorieren
können, sondern sich auch einem regierenden Könige gegenüber im
Alleinbesitz des Rechtes der Eideslösung befanden. Hier war ihre
Mitwirkung unentbehrlich.
Vielleicht darf ich hier noch ein Wort daräber sagen, wie ich
mich im übrigen zu der Untersuchung von Niemeier stelle. N. hat
meinen Aufsatz über „die Absetzung Adolfs von Nassau und die
römische Curie“ (Hist. Vierteljahrschr. 1899, 1) erst zu Gesicht be-
kommen, als er seine Abhandlung bereits abgeschlossen hatte, und
anwesenden Neugierigen verlesen, so war die erstere offenbar für die
weitere Oeffentlichkeit bestimmt. — Die Stelle nun, die für die Fest-
stellung des Begriffes absolvere in dieser zweiten Proklamation ın
Betracht kommt, habe ich oben bereits mitgeteilt: cum a juramento
fidelitatis sententia nostra vos absolverit. In dem Absetzungsdekrete
aber (Kopp I 907) heisst es: Adolfum regno denunciamus privatum
et privamus, omnes, qui ei iuramento fidelitatis tenentur astricti, a
ijuramento huius modi absolventes. In beiden Aktenstücken also ist
schlechthin nur von der Lösung der Treueide die Rede. Weshalb soll
man also in der ersten Proklamation der drei Kurfürsten dem Worte
eine andere Bedeutung beilegen? Ein weiteres gewichtiges Argument
aber dafür, dass es sich thatsächlich auch hier um die KEideslösung
handelt, scheint sich aus der Fassung des Schlusssatzes zu ergeben:
ipsius (sc. pape) auctoritate nobis commissa Adolphum regem
absolvimus a regiminiıs dignitate et dominum Albertum in regem eli-
gimus Romanorum et potestate nobis tradita similiter confirmamus.
Die Proklamation unterscheidet also drei selbständige Akte: absolutio,
electio, confirmatio: von denen die Kurfürsten den ersten und dritten
kraft päpstlicher Vollmacht — denn die potestas tradita ist doch
kaum etwas Anderes als die auctoritas commissa — den zweiten aber
kraft eigener Machtvollkommenheit ausüben. Daraus darf man doch
wohl folgern, dass es sich weder bei der absolutio einfach um Ab-
setzung, noch, wie Niemeier meint, bei der confirmatio um die regel-
mässige confirmatio oder approbatio des Gewählten durch die
Wähler, sondern in dem einen Fall um die Eideslösung, in dem
anderen um die päpstliche Approbation handelt. Das würde.
namentlich auch gegen Domeier (die Absetzung Adolfs von Nassau),
sprechen, der um deswillen nicht an den Colmarer Bericht glauben
will, weil nach seiner Ansicht die Kurfürsten das Absetzungsrecht
für sich selbst in Anspruch nahmen, also nicht wohl den Papst um
die Vollmacht zur Absetzung bitten konnten. Wie ich schon früher
andeutete, hat Domeier dabei zu wenig darauf Rücksicht genommen,
dass die Päpste nicht nur einem Neugewählten gegenüber den Appro-
bationsanspruch erhoben, den man allenfalls noch hätte ignorieren
können, sondern sich auch einem regierenden Könige gegenüber im
Alleinbesitz des Rechtes der Eideslösung befanden. Hier war ihre
Mitwirkung unentbehrlich.
Vielleicht darf ich hier noch ein Wort daräber sagen, wie ich
mich im übrigen zu der Untersuchung von Niemeier stelle. N. hat
meinen Aufsatz über „die Absetzung Adolfs von Nassau und die
römische Curie“ (Hist. Vierteljahrschr. 1899, 1) erst zu Gesicht be-
kommen, als er seine Abhandlung bereits abgeschlossen hatte, und