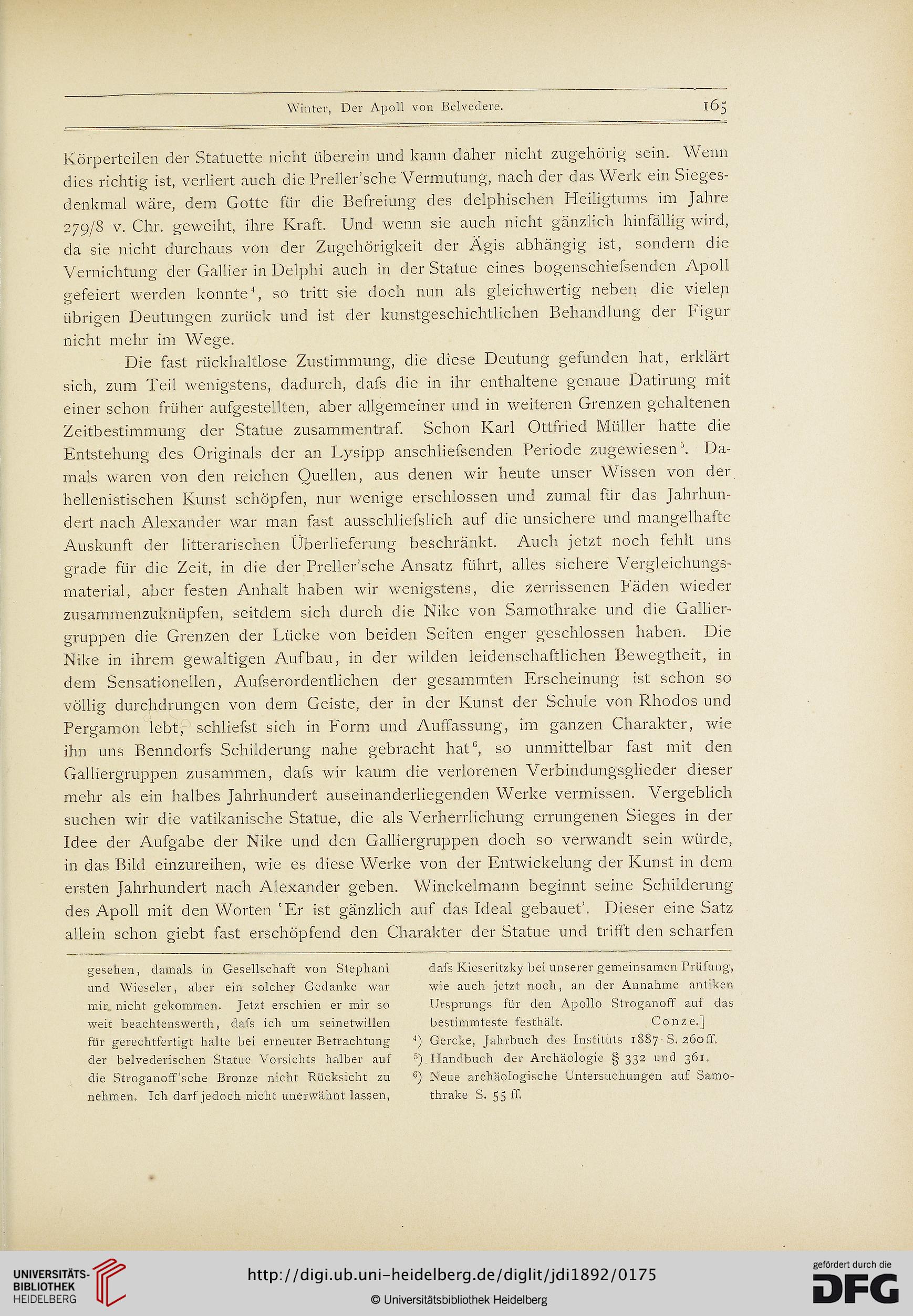Winter, Der Apoll von Belvedere.
i65
Körperteilen der Statuette nicht überein und kann daher nicht zugehörig sein. Wenn
dies richtig ist, verliert auch die Preller’sche Vermutung, nach der das Werk ein Sieges-
denkmal wäre, dem Gotte für die Befreiung des delphischen Heiligtums im Jahre
279/8 v. Chr. geweiht, ihre Kraft. Und wenn sie auch nicht gänzlich hinfällig wird,
da sie nicht durchaus von der Zugehörigkeit der Ägis abhängig ist, sondern die
Vernichtung der Gallier in Delphi auch in der Statue eines bogenschiefsenden Apoll
gefeiert werden konnte4, so tritt sie doch nun als gleichwertig neben die vielen
übrigen Deutungen zurück und ist der kunstgeschichtlichen Behandlung der Figur
nicht mehr im Wege.
Die fast rückhaltlose Zustimmung, die diese Deutung gefunden hat, erklärt
sich, zum Teil wenigstens, dadurch, dafs die in ihr enthaltene genaue Datirung mit
einer schon früher aufgestellten, aber allgemeiner und in weiteren Grenzen gehaltenen
Zeitbestimmung der Statue zusammentraf. Schon Karl Ottfried Müller hatte die
Entstehung des Originals der an Lysipp anschliefsenden Periode zugewiesen5. Da-
mals waren von den reichen Quellen, aus denen wir heute unser Wissen von der
hellenistischen Kunst schöpfen, nur wenige erschlossen und zumal für das Jahrhun-
dert nach Alexander war man fast ausschliefslich auf die unsichere und mangelhafte
Auskunft der litterarischen Überlieferung beschränkt. Auch jetzt noch fehlt uns
grade für die Zeit, in die der Preller’sche Ansatz führt, alles sichere Vergleichungs-
material, aber festen Anhalt haben wir wenigstens, die zerrissenen Fäden wieder
zusammenzuknüpfen, seitdem sich durch die Nike von Samothrake und die Gallier-
gruppen die Grenzen der Lücke von beiden Seiten enger geschlossen haben. Die
Nike in ihrem gewaltigen Aufbau, in der wilden leidenschaftlichen Bewegtheit, in
dem Sensationellen, Aufserordentlichen der gesammten Erscheinung ist schon so
völlig durchdrungen von dem Geiste, der in der Kunst der Schule von Rhodos und
Pergamon lebt, schliefst sich in Form und Auffassung, im ganzen Charakter, wie
ihn uns Benndorfs Schilderung nahe gebracht hat6, so unmittelbar fast mit den
Galliergruppen zusammen, dafs wir kaum die verlorenen Verbindungsglieder dieser
mehr als ein halbes Jahrhundert auseinanderliegenden Werke vermissen. Vergeblich
suchen wir die vatikanische Statue, die als Verherrlichung errungenen Sieges in der
Idee der Aufgabe der Nike und den Galliergruppen doch so verwandt sein würde,
in das Bild einzureihen, wie es diese Werke von der Entwickelung der Kunst in dem
ersten Jahrhundert nach Alexander geben. Winckelmann beginnt seine Schilderung
des Apoll mit den Worten 'Er ist gänzlich auf das Ideal gebauet’. Dieser eine Satz
allein schon giebt fast erschöpfend den Charakter der Statue und trifft den scharfen
gesehen, damals in Gesellschaft von Stephani
und Wieseler, aber ein solcher Gedanke war
mir, nicht gekommen. Jetzt erschien er mir so
weit beachtenswert]!, dafs ich um seinetwillen
für gerechtfertigt halte bei erneuter Betrachtung
der belvederischen Statue Vorsichts halber auf
die Stroganoff'sche Bronze nicht Rücksicht zu
nehmen. Ich darf jedoch nicht unerwähnt lassen,
dafs Kieseritzky bei unserer gemeinsamen Prüfung,
wie auch jetzt noch, an der Annahme antiken
Ursprungs für den Apollo Stroganoff auf das
bestimmteste festhält. Conze.]
4) Gercke, Jahrbuch des Instituts 1887 S. 26off.
5) „ Handbuch der Archäologie § 332 und 361.
6) Neue archäologische Untersuchungen auf Samo-
thrake S. 55 ff.
i65
Körperteilen der Statuette nicht überein und kann daher nicht zugehörig sein. Wenn
dies richtig ist, verliert auch die Preller’sche Vermutung, nach der das Werk ein Sieges-
denkmal wäre, dem Gotte für die Befreiung des delphischen Heiligtums im Jahre
279/8 v. Chr. geweiht, ihre Kraft. Und wenn sie auch nicht gänzlich hinfällig wird,
da sie nicht durchaus von der Zugehörigkeit der Ägis abhängig ist, sondern die
Vernichtung der Gallier in Delphi auch in der Statue eines bogenschiefsenden Apoll
gefeiert werden konnte4, so tritt sie doch nun als gleichwertig neben die vielen
übrigen Deutungen zurück und ist der kunstgeschichtlichen Behandlung der Figur
nicht mehr im Wege.
Die fast rückhaltlose Zustimmung, die diese Deutung gefunden hat, erklärt
sich, zum Teil wenigstens, dadurch, dafs die in ihr enthaltene genaue Datirung mit
einer schon früher aufgestellten, aber allgemeiner und in weiteren Grenzen gehaltenen
Zeitbestimmung der Statue zusammentraf. Schon Karl Ottfried Müller hatte die
Entstehung des Originals der an Lysipp anschliefsenden Periode zugewiesen5. Da-
mals waren von den reichen Quellen, aus denen wir heute unser Wissen von der
hellenistischen Kunst schöpfen, nur wenige erschlossen und zumal für das Jahrhun-
dert nach Alexander war man fast ausschliefslich auf die unsichere und mangelhafte
Auskunft der litterarischen Überlieferung beschränkt. Auch jetzt noch fehlt uns
grade für die Zeit, in die der Preller’sche Ansatz führt, alles sichere Vergleichungs-
material, aber festen Anhalt haben wir wenigstens, die zerrissenen Fäden wieder
zusammenzuknüpfen, seitdem sich durch die Nike von Samothrake und die Gallier-
gruppen die Grenzen der Lücke von beiden Seiten enger geschlossen haben. Die
Nike in ihrem gewaltigen Aufbau, in der wilden leidenschaftlichen Bewegtheit, in
dem Sensationellen, Aufserordentlichen der gesammten Erscheinung ist schon so
völlig durchdrungen von dem Geiste, der in der Kunst der Schule von Rhodos und
Pergamon lebt, schliefst sich in Form und Auffassung, im ganzen Charakter, wie
ihn uns Benndorfs Schilderung nahe gebracht hat6, so unmittelbar fast mit den
Galliergruppen zusammen, dafs wir kaum die verlorenen Verbindungsglieder dieser
mehr als ein halbes Jahrhundert auseinanderliegenden Werke vermissen. Vergeblich
suchen wir die vatikanische Statue, die als Verherrlichung errungenen Sieges in der
Idee der Aufgabe der Nike und den Galliergruppen doch so verwandt sein würde,
in das Bild einzureihen, wie es diese Werke von der Entwickelung der Kunst in dem
ersten Jahrhundert nach Alexander geben. Winckelmann beginnt seine Schilderung
des Apoll mit den Worten 'Er ist gänzlich auf das Ideal gebauet’. Dieser eine Satz
allein schon giebt fast erschöpfend den Charakter der Statue und trifft den scharfen
gesehen, damals in Gesellschaft von Stephani
und Wieseler, aber ein solcher Gedanke war
mir, nicht gekommen. Jetzt erschien er mir so
weit beachtenswert]!, dafs ich um seinetwillen
für gerechtfertigt halte bei erneuter Betrachtung
der belvederischen Statue Vorsichts halber auf
die Stroganoff'sche Bronze nicht Rücksicht zu
nehmen. Ich darf jedoch nicht unerwähnt lassen,
dafs Kieseritzky bei unserer gemeinsamen Prüfung,
wie auch jetzt noch, an der Annahme antiken
Ursprungs für den Apollo Stroganoff auf das
bestimmteste festhält. Conze.]
4) Gercke, Jahrbuch des Instituts 1887 S. 26off.
5) „ Handbuch der Archäologie § 332 und 361.
6) Neue archäologische Untersuchungen auf Samo-
thrake S. 55 ff.