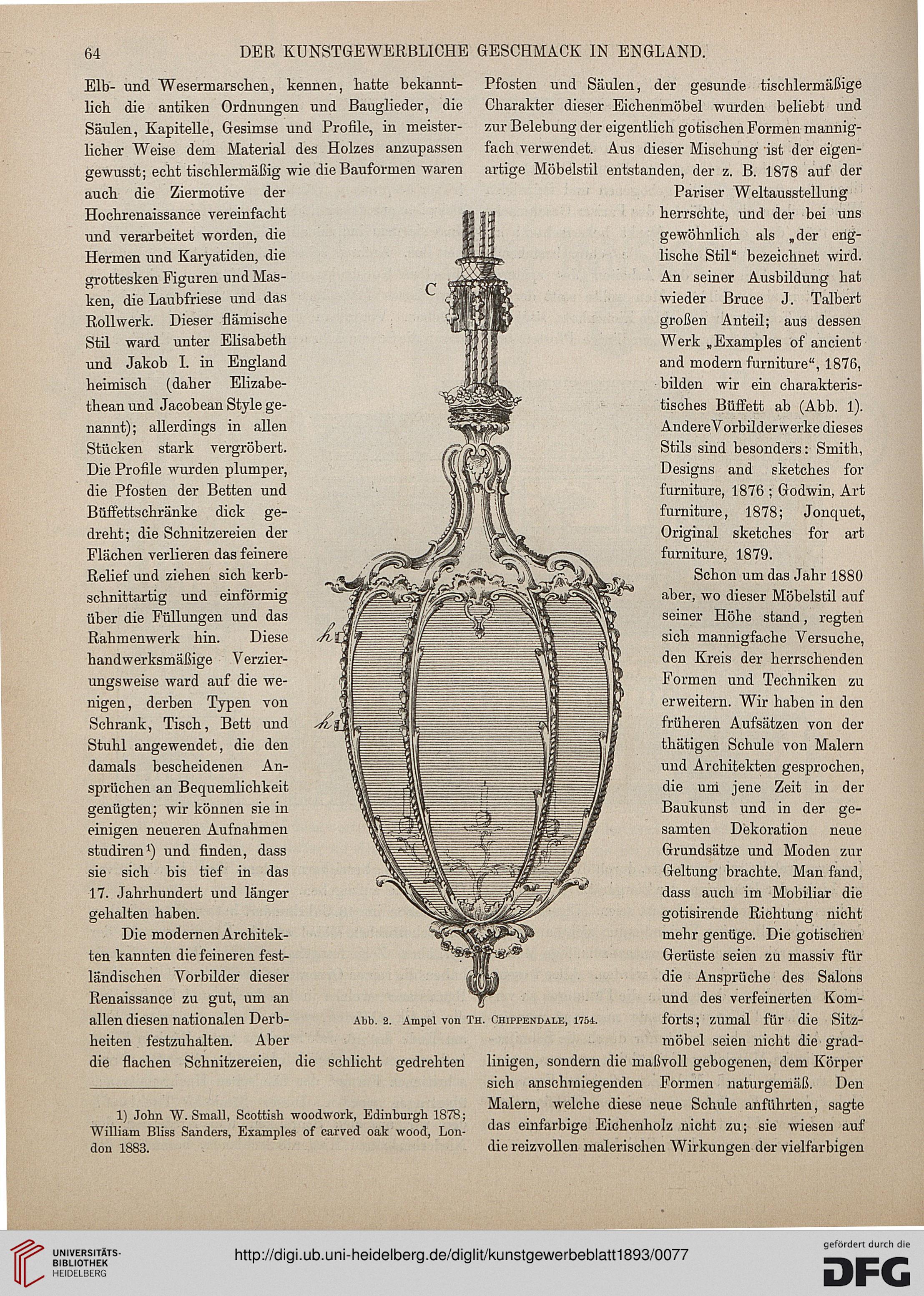64
DER KUNSTGEWERBLICHE GESCHMACK IN ENGLAND.
Elb- und Wesermarschen, kennen, hatte bekannt-
lich die antiken Ordnungen und ßauglieder, die
Säulen, Kapitelle, Gesimse und Profile, in meister-
licher Weise dem Material des Holzes anzupassen
gewusst; echt tischlermäßig wie die Bauformen waren
auch die Ziermotive der
Hochrenaissance vereinfacht
und verarbeitet worden, die
Hermen und Karyatiden, die
crrottesken Figuren und Mas-
ken, die Laubfriese und das
Rollwerk. Dieser flämische
Stil ward unter Elisabeth
und Jakob I. in England
heimisch (daher Elizabe-
thean und Jacobean Style ge-
nannt); allerdings in allen
Stücken stark vergröbert.
Die Profile wurden plumper,
die Pfosten der Betten und
Büffettschränke dick ge-
dreht; die Schnitzereien der
Flächen verlieren das feinere
Relief und ziehen sich kerb-
schnittartig und einförmig
über die Füllungen und das
Rahmenwerk hin. Diese
handwerksmäßige Verzier-
ungsweise ward auf die we-
nigen, derben Typen von
Schrank, Tisch, Bett und
Stuhl angewendet, die den
damals bescheidenen An-
sprüchen an Bequemlichkeit
genügten; wir können sie in
einigen neueren Aufnahmen
studiren1) und finden, dass
sie sich bis tief in das
17. Jahrhundert und länger
gehalten haben.
Die modernen Architek-
ten kannten die feineren fest-
ländischen Vorbilder dieser
Renaissance zu gut, um an
allen diesen nationalen Derb-
heiten festzuhalten. Aber
die flachen Schnitzereien, die schlicht gedrehten
Abb. 2. Ampel von Th. Chippendale, 1754.
1) John W. Small, Scottish woodwork, Edinburgh 1878;
William Bliss Sanders, Examples of carved oak wood, Lon-
don 1883.
Pfosten und Säulen, der gesunde tischlermäßige
Charakter dieser Eichenmöbel wurden beliebt und
zur Belebung der eigentlich gotischen Formen mannig-
fach verwendet. Aus dieser Mischung ist der eigen-
artige Möbelstil entstanden, der z. B. 1878 auf der
Pariser Weltausstellung
herrschte, und der bei uns
gewöhnlich als „der eng-
lische Stil" bezeichnet wird.
An seiner Ausbildung hat
wieder Bruce J. Talbert
großen Anteil; aus dessen
Werk „Examples of ancient
and modern furniture", 1876,
bilden wir ein charakteris-
tisches Buffett ab (Abb. 1).
Andere Vorbilderwerke dieses
Stils sind besonders: Smith,
Designs and sketches for
furniture, 1876 ; Godwin, Art
furniture, 1878; Jonquet,
Original sketches for art
furniture, 1879.
Schon um das Jahr 1880
aber, wo dieser Möbelstil auf
seiner Höhe stand, regten
sich mannigfache Versuche,
den Kreis der herrschenden
Formen und Techniken zu
erweitern. Wir haben in den
früheren Aufsätzen von der
thätigen Schule von Malern
und Architekten gesprochen,
die um jene Zeit in der
Baukunst und in der ge-
samten Dekoration neue
Grundsätze und Moden zur
Geltung brachte. Man fand,
dass auch im Mobiliar die
gotisirende Richtung nicht
mehr genüge. Die gotischen
Gerüste seien zu massiv für
die Ansprüche des Salons
und des verfeinerten Kom-
forts ; zumal für die Sitz-
möbel seien nicht die grad-
linigen, sondern die maßvoll gebogenen, dem Körper
sich anschmiegenden Formen naturgemäß. Den
Malern, welche diese neue Schule anführten, sagte
das einfarbige Eichenholz nicht zu; sie wiesen auf
die reizvollen malerischen Wirkungen der vielfarbigen
DER KUNSTGEWERBLICHE GESCHMACK IN ENGLAND.
Elb- und Wesermarschen, kennen, hatte bekannt-
lich die antiken Ordnungen und ßauglieder, die
Säulen, Kapitelle, Gesimse und Profile, in meister-
licher Weise dem Material des Holzes anzupassen
gewusst; echt tischlermäßig wie die Bauformen waren
auch die Ziermotive der
Hochrenaissance vereinfacht
und verarbeitet worden, die
Hermen und Karyatiden, die
crrottesken Figuren und Mas-
ken, die Laubfriese und das
Rollwerk. Dieser flämische
Stil ward unter Elisabeth
und Jakob I. in England
heimisch (daher Elizabe-
thean und Jacobean Style ge-
nannt); allerdings in allen
Stücken stark vergröbert.
Die Profile wurden plumper,
die Pfosten der Betten und
Büffettschränke dick ge-
dreht; die Schnitzereien der
Flächen verlieren das feinere
Relief und ziehen sich kerb-
schnittartig und einförmig
über die Füllungen und das
Rahmenwerk hin. Diese
handwerksmäßige Verzier-
ungsweise ward auf die we-
nigen, derben Typen von
Schrank, Tisch, Bett und
Stuhl angewendet, die den
damals bescheidenen An-
sprüchen an Bequemlichkeit
genügten; wir können sie in
einigen neueren Aufnahmen
studiren1) und finden, dass
sie sich bis tief in das
17. Jahrhundert und länger
gehalten haben.
Die modernen Architek-
ten kannten die feineren fest-
ländischen Vorbilder dieser
Renaissance zu gut, um an
allen diesen nationalen Derb-
heiten festzuhalten. Aber
die flachen Schnitzereien, die schlicht gedrehten
Abb. 2. Ampel von Th. Chippendale, 1754.
1) John W. Small, Scottish woodwork, Edinburgh 1878;
William Bliss Sanders, Examples of carved oak wood, Lon-
don 1883.
Pfosten und Säulen, der gesunde tischlermäßige
Charakter dieser Eichenmöbel wurden beliebt und
zur Belebung der eigentlich gotischen Formen mannig-
fach verwendet. Aus dieser Mischung ist der eigen-
artige Möbelstil entstanden, der z. B. 1878 auf der
Pariser Weltausstellung
herrschte, und der bei uns
gewöhnlich als „der eng-
lische Stil" bezeichnet wird.
An seiner Ausbildung hat
wieder Bruce J. Talbert
großen Anteil; aus dessen
Werk „Examples of ancient
and modern furniture", 1876,
bilden wir ein charakteris-
tisches Buffett ab (Abb. 1).
Andere Vorbilderwerke dieses
Stils sind besonders: Smith,
Designs and sketches for
furniture, 1876 ; Godwin, Art
furniture, 1878; Jonquet,
Original sketches for art
furniture, 1879.
Schon um das Jahr 1880
aber, wo dieser Möbelstil auf
seiner Höhe stand, regten
sich mannigfache Versuche,
den Kreis der herrschenden
Formen und Techniken zu
erweitern. Wir haben in den
früheren Aufsätzen von der
thätigen Schule von Malern
und Architekten gesprochen,
die um jene Zeit in der
Baukunst und in der ge-
samten Dekoration neue
Grundsätze und Moden zur
Geltung brachte. Man fand,
dass auch im Mobiliar die
gotisirende Richtung nicht
mehr genüge. Die gotischen
Gerüste seien zu massiv für
die Ansprüche des Salons
und des verfeinerten Kom-
forts ; zumal für die Sitz-
möbel seien nicht die grad-
linigen, sondern die maßvoll gebogenen, dem Körper
sich anschmiegenden Formen naturgemäß. Den
Malern, welche diese neue Schule anführten, sagte
das einfarbige Eichenholz nicht zu; sie wiesen auf
die reizvollen malerischen Wirkungen der vielfarbigen