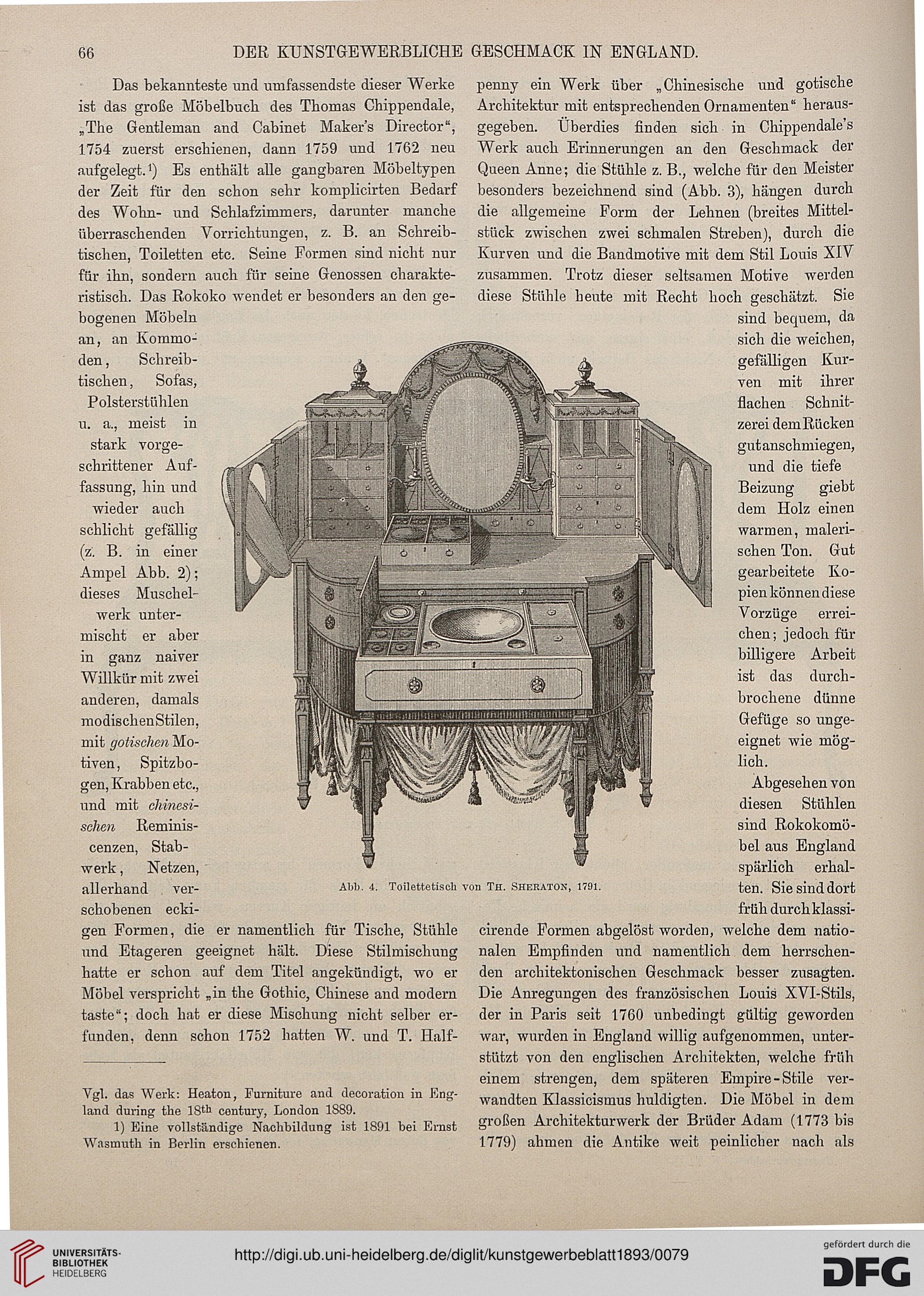66
DER KUNSTGEWERBLICHE GESCHMACK IN ENGLAND.
Das bekannteste und umfassendste dieser Werke
ist das große Möbelbuch des Thomas Chippendale,
„The Gentleman and Cabinet Maker's Director",
1754 zuerst erschienen, dann 1759 und 1762 neu
aufgelegt.1) Es enthält alle gangbaren Möbeltypen
penny ein Werk über „Chinesische und gotische
Architektur mit entsprechenden Ornamenten" heraus-
gegeben. Überdies finden sich in Chippendale's
Werk auch Erinnerungen an den Geschmack der
Queen Anne; die Stühle z. B., welche für den Meister
der Zeit für den schon sehr komplicirten Bedarf besonders bezeichnend sind (Abb. 3), hängen durch
die allgemeine Form der Lehnen (breites Mittel-
stück zwischen zwei schmalen Streben), durch die
Kurven und die Bandmotive mit dem Stil Louis XIV
zusammen. Trotz dieser seltsamen Motive werden
diese Stühle beute mit Recht hoch geschätzt. Sie
sind bequem, da
sich die weichen,
gefälligen Kur-
ven mit ihrer
flachen Schnit-
zerei dem Rücken
gut anschmiegen,
und die tiefe
Beizung giebt
dem Holz einen
warmen, maleri-
schen Ton. Gut
gearbeitete Ko-
pien können diese
Vorzüge errei-
chen; jedoch für
billigere Arbeit
ist das durch-
brochene dünne
Gefüge so unge-
eignet wie mög-
lich.
Abgesehen von
diesen Stühlen
sind Rokokomö-
bel aus England
spärlich erhal-
ten. Sie sind dort
früh durch klassi-
erende Formen abgelöst worden, welche dem natio-
nalen Empfinden und namentlich dem herrschen-
den architektonischen Geschmack besser zusagten.
Die Anregungen des französischen Louis XVI-Stils,
der in Paris seit 1760 unbedingt gültig geworden
war, wurden in England willig aufgenommen, unter-
stützt von den englischen Architekten, welche früh
einem strengen, dem späteren Empire-Stile ver-
wandten Klassicismus huldigten. Die Möbel in dem
großen Architekturwerk der Brüder Adam (1773 bis
1779) ahmen die Antike weit peinlicber nach als
des Wohn- und Schlafzimmers, darunter manche
überraschenden Vorrichtungen, z. B. an Schreib-
tischen, Toiletten etc. Seine Formen sind nicht nur
für ihn, sondern auch für seine Genossen charakte-
ristisch. Das Rokoko wendet er besonders an den ge-
bogenen Möbeln
an, an Kommo-
den , Schreib-
tischen , Sofas,
Polsterstühlen
u. a., meist in
stark vorge-
schrittener Auf-
fassung, hin und
wieder auch
schlicht gefällig
(z. B. in einer
Ampel Abb. 2);
dieses Muschel-
werk unter-
mischt er aber
in ganz naiver
Willkür mit zwei
anderen, damals
modischenStilen,
mit gotischen Mo-
tiven, Spitzbo-
gen, Krabben etc.,
und mit chinesi-
sclien Reminis-
cenzen, Stab-
werk, Netzen,
allerhand ver-
schobenen ecki-
gen Formen, die er namentlich für Tische, Stühle
und Etageren geeignet hält. Diese Stilmischung
hatte er schon auf dem Titel angekündigt, wo er
Möbel verspricht „in the Gothic, Chinese and modern
taste"; doch hat er diese Mischung nicht selber er-
funden, denn schon 1752 hatten W. und T. Half-
AM). 4. Toilettetisch von Th. Sheraton, 1791.
Vgl. das Werk: Heaton, Furniture and decoration in Eng-
land during the 18th Century, London 1889.
1) Eine vollständige Nachbildung ist 1891 bei Ernst
Wasmuth in Berlin erschienen.
DER KUNSTGEWERBLICHE GESCHMACK IN ENGLAND.
Das bekannteste und umfassendste dieser Werke
ist das große Möbelbuch des Thomas Chippendale,
„The Gentleman and Cabinet Maker's Director",
1754 zuerst erschienen, dann 1759 und 1762 neu
aufgelegt.1) Es enthält alle gangbaren Möbeltypen
penny ein Werk über „Chinesische und gotische
Architektur mit entsprechenden Ornamenten" heraus-
gegeben. Überdies finden sich in Chippendale's
Werk auch Erinnerungen an den Geschmack der
Queen Anne; die Stühle z. B., welche für den Meister
der Zeit für den schon sehr komplicirten Bedarf besonders bezeichnend sind (Abb. 3), hängen durch
die allgemeine Form der Lehnen (breites Mittel-
stück zwischen zwei schmalen Streben), durch die
Kurven und die Bandmotive mit dem Stil Louis XIV
zusammen. Trotz dieser seltsamen Motive werden
diese Stühle beute mit Recht hoch geschätzt. Sie
sind bequem, da
sich die weichen,
gefälligen Kur-
ven mit ihrer
flachen Schnit-
zerei dem Rücken
gut anschmiegen,
und die tiefe
Beizung giebt
dem Holz einen
warmen, maleri-
schen Ton. Gut
gearbeitete Ko-
pien können diese
Vorzüge errei-
chen; jedoch für
billigere Arbeit
ist das durch-
brochene dünne
Gefüge so unge-
eignet wie mög-
lich.
Abgesehen von
diesen Stühlen
sind Rokokomö-
bel aus England
spärlich erhal-
ten. Sie sind dort
früh durch klassi-
erende Formen abgelöst worden, welche dem natio-
nalen Empfinden und namentlich dem herrschen-
den architektonischen Geschmack besser zusagten.
Die Anregungen des französischen Louis XVI-Stils,
der in Paris seit 1760 unbedingt gültig geworden
war, wurden in England willig aufgenommen, unter-
stützt von den englischen Architekten, welche früh
einem strengen, dem späteren Empire-Stile ver-
wandten Klassicismus huldigten. Die Möbel in dem
großen Architekturwerk der Brüder Adam (1773 bis
1779) ahmen die Antike weit peinlicber nach als
des Wohn- und Schlafzimmers, darunter manche
überraschenden Vorrichtungen, z. B. an Schreib-
tischen, Toiletten etc. Seine Formen sind nicht nur
für ihn, sondern auch für seine Genossen charakte-
ristisch. Das Rokoko wendet er besonders an den ge-
bogenen Möbeln
an, an Kommo-
den , Schreib-
tischen , Sofas,
Polsterstühlen
u. a., meist in
stark vorge-
schrittener Auf-
fassung, hin und
wieder auch
schlicht gefällig
(z. B. in einer
Ampel Abb. 2);
dieses Muschel-
werk unter-
mischt er aber
in ganz naiver
Willkür mit zwei
anderen, damals
modischenStilen,
mit gotischen Mo-
tiven, Spitzbo-
gen, Krabben etc.,
und mit chinesi-
sclien Reminis-
cenzen, Stab-
werk, Netzen,
allerhand ver-
schobenen ecki-
gen Formen, die er namentlich für Tische, Stühle
und Etageren geeignet hält. Diese Stilmischung
hatte er schon auf dem Titel angekündigt, wo er
Möbel verspricht „in the Gothic, Chinese and modern
taste"; doch hat er diese Mischung nicht selber er-
funden, denn schon 1752 hatten W. und T. Half-
AM). 4. Toilettetisch von Th. Sheraton, 1791.
Vgl. das Werk: Heaton, Furniture and decoration in Eng-
land during the 18th Century, London 1889.
1) Eine vollständige Nachbildung ist 1891 bei Ernst
Wasmuth in Berlin erschienen.