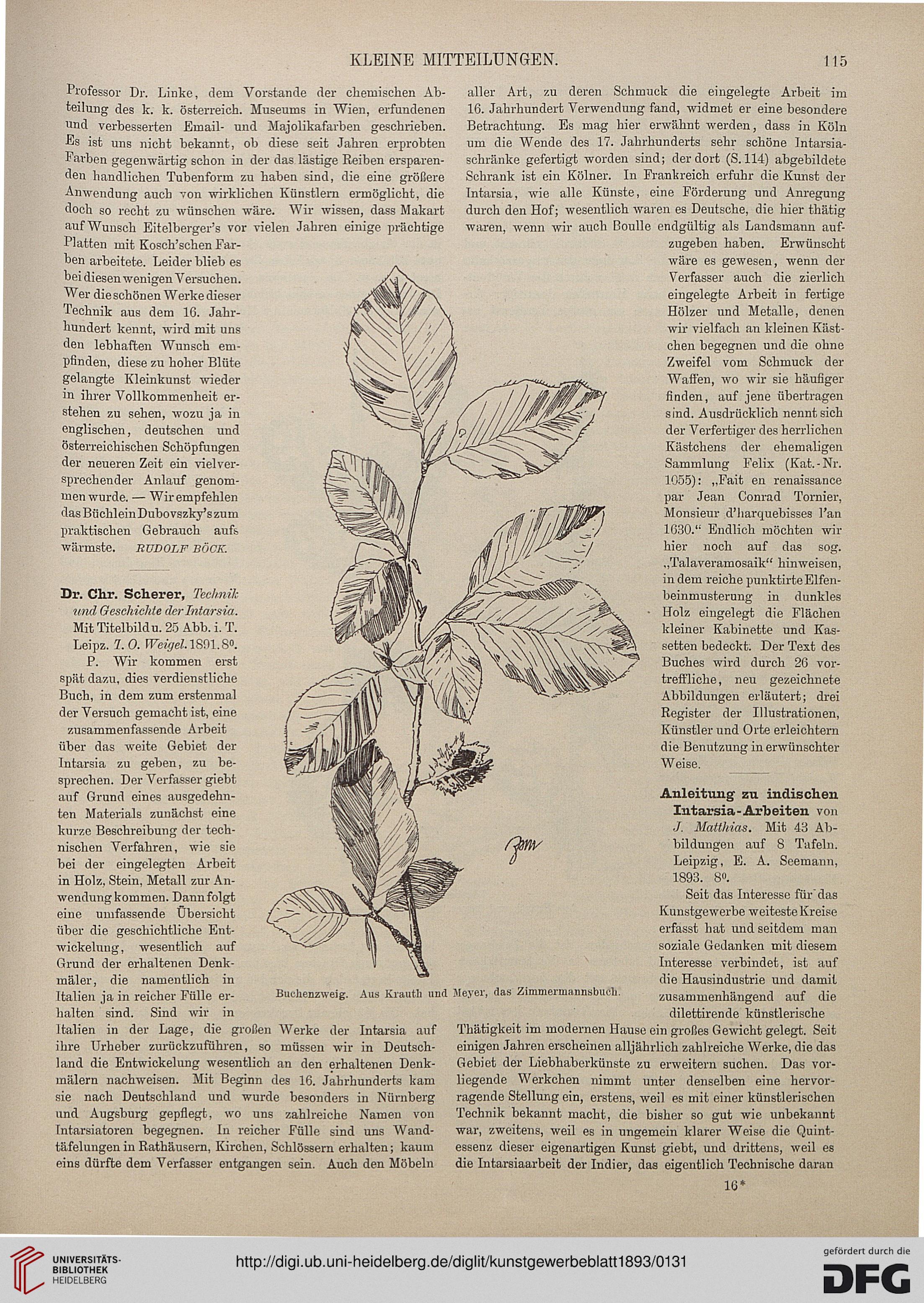KLEINE MITTEILUNGEN.
115
Professor Dr. Linke, dem Vorstände der chemischen Ab-
teilung des k. k. Österreich. Museums in Wien, erfundenen
und verbesserten Email- und Majolikafarben geschrieben.
Es ist uns nicht bekannt, ob diese seit Jahren erprobten
Farben gegenwärtig schon in der das lästige Reiben ersparen-
den handlichen Tubenform zu haben sind, die eine größere
Anwendung auch von wirklichen Künstlern ermöglicht, die
doch so recht zu wünschen wäre. Wir wissen, dass Makart
auf Wunsch Eitelberger's vor vielen Jahren einige prächtige
Platten mit Kosch'schen Far-
ben arbeitete. Leider blieb es
bei diesen wenigen Versuchen.
Wer die schönen Werke dieser
Technik aus dem 16. Jahr-
hundert kennt, wird mit uns
den lebhaften Wunsch em-
pfinden, diese zu hoher Blüte
gelangte Kleinkunst wieder
in ihrer Vollkommenheit er-
stehen zu sehen, wozu ja in
englischen, deutschen und
österreichischen Schöpfungen
der neueren Zeit ein vielver-
sprechender Anlauf genom-
men wurde. — Wir empfehlen
das Büchlein Dubovszkys zum
praktischen Gebrauch aufs
wärmste. RUDOLF BOCK.
Dr. Chr. Scherer, Technik
und Geschichte der Intarsia.
Mit Titelbildu. 25 Abb. i. T.
Leipz. 1.0. Weigd.l$&l.&.
P. Wir kommen erst
spät dazu, dies verdienstliche
Buch, in dem zum erstenmal
der Versuch gemacht ist, eine
zusammenfassende Arbeit
über das weite Gebiet der
Intarsia zu geben, zu be-
sprechen. Der Verfasser giebt
auf Grund eines ausgedehn-
ten Materials zunächst eine
kurze Beschreibung der tech-
nischen Verfahren, wie sie
bei der eingelegten Arbeit
in Holz, Stein, Metall zur An-
wendung kommen. Dann folgt
eine umfassende Übersicht
über die geschichtliche Ent-
wickelung, wesentlich auf
Grund der erhaltenen Denk-
mäler, die namentlich in
Italien ja in reicher Fülle er-
halten sind. Sind wir in
Italien in der Lage, die großen Werke der Intarsia auf
ihre Urheber zurückzuführen, so müssen wir in Deutsch-
land die Entwickelung wesentlich an den erhaltenen Denk-
mälern nachweisen. Mit Beginn des 16. Jahrhunderts kam
sie nach Deutschland und wurde besonders in Nürnberg
und Augsburg gepflegt, wo uns zahlreiche Namen von
Intarsiatoren begegnen. In reicher Fülle sind uns Wand-
täfelungen in Rathäusern, Kirchen, Schlössern erhalten; kaum
eins dürfte dem Verfasser entgangen sein. Auch den Möbeln
Buchenzweig. Aus Krauth und Meyer, das Zimmerina nnsbueli.
aller Art, zu deren Schmuck die eingelegte Arbeit im
16. Jahrhundert Verwendung fand, widmet er eine besondere
Betrachtung. Es mag hier erwähnt werden, dass in Köln
um die Wende des 17. Jahrhunderts sehr schöne Intarsia-
schränke gefertigt worden sind; der dort (S. 114) abgebildete
Schrank ist ein Kölner. In Frankreich erfuhr die Kunst der
Intarsia, wie alle Künste, eine Förderung und Anregung
durch den Hof; wesentlich waren es Deutsche, die hier thätig
waren, wenn wir auch Boulle endgültig als Landsmann auf-
zugeben haben. Erwünscht
wäre es gewesen, wenn der
Verfasser auch die zierlich
eingelegte Arbeit in fertige
Hölzer und Metalle, denen
wir vielfach an kleinen Käst-
chen begegnen und die ohne
Zweifel vom Schmuck der
Waffen, wo wir sie häufiger
finden, auf jene übertragen
sind. Ausdrücklich nennt sich
der Verfertiger des herrlichen
Kästchens der ehemaligen
Sammlung Felix (Kat.-Nr.
1055): „Fait en renaissance
par Jean Conrad Tornier,
Monsieur d'harquebisses l'an
1030." Endlich möchten wir
hier noch auf das sog.
„Talaveramosaik" hinweisen,
in dem reiche punktirte Elfen-
beinmusterung in dunkles
Holz eingelegt die Flächen
kleiner Kabinette und Kas-
setten bedeckt. Der Text des
Buches wird durch 26 vor-
treffliche, neu gezeichnete
Abbildungen erläutert; drei
Register der Illustrationen,
Künstler und Orte erleichtern
die Benutzung in erwünschter
Weise.
Anleitung zu indischen
Intarsia-Arbeiten von
J. Matthias. Mit 43 Ab-
bildungen auf 8 Tafeln.
Leipzig, E. A. Seemann,
1893. 8«.
Seit das Interesse für" das
Kunstgewerbe weiteste Kreise
erfasst hat und seitdem man
soziale Gedanken mit diesem
Interesse verbindet, ist auf
die Hausindustrie und damit
zusammenhängend auf die
dilettirende künstlerische
Thätigkeit im modernen Hause ein großes Gewicht gelegt. Seit
einigen Jahren erscheinen alljährlich zahlreiche Werke, die das
Gebiet der Liebhaberkünste zu erweitern suchen. Das vor-
liegende Werkchen nimmt unter denselben eine hervor-
ragende Stellung ein, erstens, weil es mit einer künstlerischen
Technik bekannt macht, die bisher so gut wie unbekannt
war, zweitens, weil es in ungemein klarer Weise die Quint-
essenz dieser eigenartigen Kunst giebt, und drittens, weil es
die Intarsiaarbeit der Indier, das eigentlich Technische daran
16*
/QfflV
115
Professor Dr. Linke, dem Vorstände der chemischen Ab-
teilung des k. k. Österreich. Museums in Wien, erfundenen
und verbesserten Email- und Majolikafarben geschrieben.
Es ist uns nicht bekannt, ob diese seit Jahren erprobten
Farben gegenwärtig schon in der das lästige Reiben ersparen-
den handlichen Tubenform zu haben sind, die eine größere
Anwendung auch von wirklichen Künstlern ermöglicht, die
doch so recht zu wünschen wäre. Wir wissen, dass Makart
auf Wunsch Eitelberger's vor vielen Jahren einige prächtige
Platten mit Kosch'schen Far-
ben arbeitete. Leider blieb es
bei diesen wenigen Versuchen.
Wer die schönen Werke dieser
Technik aus dem 16. Jahr-
hundert kennt, wird mit uns
den lebhaften Wunsch em-
pfinden, diese zu hoher Blüte
gelangte Kleinkunst wieder
in ihrer Vollkommenheit er-
stehen zu sehen, wozu ja in
englischen, deutschen und
österreichischen Schöpfungen
der neueren Zeit ein vielver-
sprechender Anlauf genom-
men wurde. — Wir empfehlen
das Büchlein Dubovszkys zum
praktischen Gebrauch aufs
wärmste. RUDOLF BOCK.
Dr. Chr. Scherer, Technik
und Geschichte der Intarsia.
Mit Titelbildu. 25 Abb. i. T.
Leipz. 1.0. Weigd.l$&l.&.
P. Wir kommen erst
spät dazu, dies verdienstliche
Buch, in dem zum erstenmal
der Versuch gemacht ist, eine
zusammenfassende Arbeit
über das weite Gebiet der
Intarsia zu geben, zu be-
sprechen. Der Verfasser giebt
auf Grund eines ausgedehn-
ten Materials zunächst eine
kurze Beschreibung der tech-
nischen Verfahren, wie sie
bei der eingelegten Arbeit
in Holz, Stein, Metall zur An-
wendung kommen. Dann folgt
eine umfassende Übersicht
über die geschichtliche Ent-
wickelung, wesentlich auf
Grund der erhaltenen Denk-
mäler, die namentlich in
Italien ja in reicher Fülle er-
halten sind. Sind wir in
Italien in der Lage, die großen Werke der Intarsia auf
ihre Urheber zurückzuführen, so müssen wir in Deutsch-
land die Entwickelung wesentlich an den erhaltenen Denk-
mälern nachweisen. Mit Beginn des 16. Jahrhunderts kam
sie nach Deutschland und wurde besonders in Nürnberg
und Augsburg gepflegt, wo uns zahlreiche Namen von
Intarsiatoren begegnen. In reicher Fülle sind uns Wand-
täfelungen in Rathäusern, Kirchen, Schlössern erhalten; kaum
eins dürfte dem Verfasser entgangen sein. Auch den Möbeln
Buchenzweig. Aus Krauth und Meyer, das Zimmerina nnsbueli.
aller Art, zu deren Schmuck die eingelegte Arbeit im
16. Jahrhundert Verwendung fand, widmet er eine besondere
Betrachtung. Es mag hier erwähnt werden, dass in Köln
um die Wende des 17. Jahrhunderts sehr schöne Intarsia-
schränke gefertigt worden sind; der dort (S. 114) abgebildete
Schrank ist ein Kölner. In Frankreich erfuhr die Kunst der
Intarsia, wie alle Künste, eine Förderung und Anregung
durch den Hof; wesentlich waren es Deutsche, die hier thätig
waren, wenn wir auch Boulle endgültig als Landsmann auf-
zugeben haben. Erwünscht
wäre es gewesen, wenn der
Verfasser auch die zierlich
eingelegte Arbeit in fertige
Hölzer und Metalle, denen
wir vielfach an kleinen Käst-
chen begegnen und die ohne
Zweifel vom Schmuck der
Waffen, wo wir sie häufiger
finden, auf jene übertragen
sind. Ausdrücklich nennt sich
der Verfertiger des herrlichen
Kästchens der ehemaligen
Sammlung Felix (Kat.-Nr.
1055): „Fait en renaissance
par Jean Conrad Tornier,
Monsieur d'harquebisses l'an
1030." Endlich möchten wir
hier noch auf das sog.
„Talaveramosaik" hinweisen,
in dem reiche punktirte Elfen-
beinmusterung in dunkles
Holz eingelegt die Flächen
kleiner Kabinette und Kas-
setten bedeckt. Der Text des
Buches wird durch 26 vor-
treffliche, neu gezeichnete
Abbildungen erläutert; drei
Register der Illustrationen,
Künstler und Orte erleichtern
die Benutzung in erwünschter
Weise.
Anleitung zu indischen
Intarsia-Arbeiten von
J. Matthias. Mit 43 Ab-
bildungen auf 8 Tafeln.
Leipzig, E. A. Seemann,
1893. 8«.
Seit das Interesse für" das
Kunstgewerbe weiteste Kreise
erfasst hat und seitdem man
soziale Gedanken mit diesem
Interesse verbindet, ist auf
die Hausindustrie und damit
zusammenhängend auf die
dilettirende künstlerische
Thätigkeit im modernen Hause ein großes Gewicht gelegt. Seit
einigen Jahren erscheinen alljährlich zahlreiche Werke, die das
Gebiet der Liebhaberkünste zu erweitern suchen. Das vor-
liegende Werkchen nimmt unter denselben eine hervor-
ragende Stellung ein, erstens, weil es mit einer künstlerischen
Technik bekannt macht, die bisher so gut wie unbekannt
war, zweitens, weil es in ungemein klarer Weise die Quint-
essenz dieser eigenartigen Kunst giebt, und drittens, weil es
die Intarsiaarbeit der Indier, das eigentlich Technische daran
16*
/QfflV