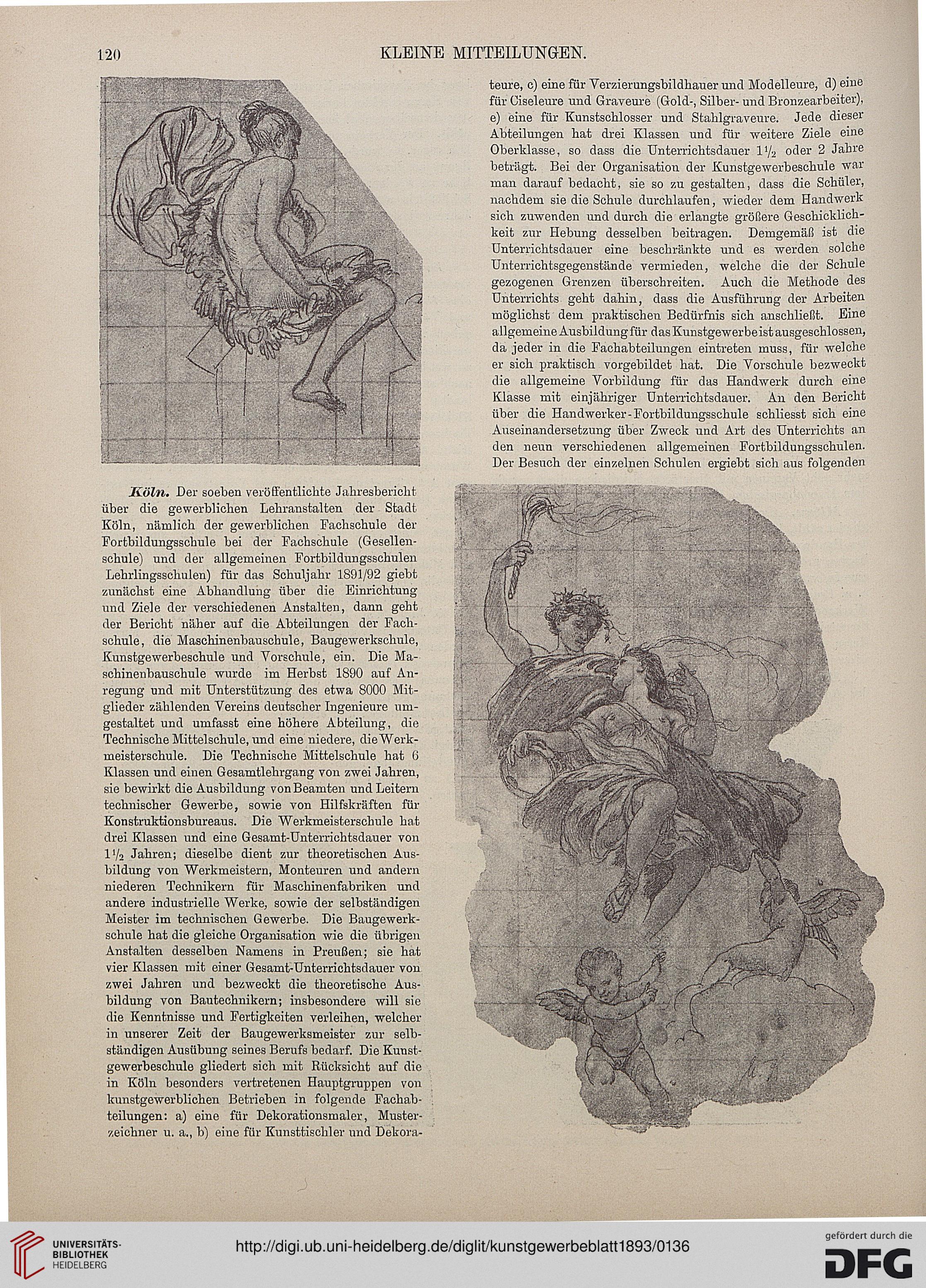120
KLEINE MITTEILUNGEN.
Köln. Der soeben veröffentlichte Jahresbericht
über die gewerblichen Lehranstalten der Stadt
Köln, nämlich der gewerblichen Fachschule der
Fortbildungsschule bei der Fachschule (Gesellen-
schule) und der allgemeinen Fortbildungsschulen
Lehrlingsschulen) für das Schuljahr 1891/92 giebt
zunächst eine Abhandlung über die Einrichtung
und Ziele der verschiedenen Anstalten, dann geht
der Bericht näher auf die Abteilungen der Fach-
schule, die Maschinenbauschule, Baugewei'kschule,
Kunstgewerbeschule und Vorschule, ein. Die Ma-
schinenbauschule wurde im Herbst 1890 auf An-
regung und mit Unterstützung des etwa 8000 Mit-
glieder zählenden Vereins deutscher Ingenieure um-
gestaltet und umfasst eine höhere Abteilung, die
Technische Mittelschule, und eine niedere, die Werk-
meisterschule. Die Technische Mittelschule hat 6
Klassen und einen Gesamtlehrgang von zwei Jahren,
sie bewirkt die Ausbildung von Beamten und Leitern
technischer Gewerbe, sowie von Hilfskräften für
Konstruktionsbureaus. Die Werkmeisterschule hat
drei Klassen und eine Gesamt-Unterrichtsdauer von
l'/a Jahren; dieselbe dient zur theoretischen Aus-
bildung von Werkmeistern, Monteuren und andern
niederen Technikern für Maschinenfabriken und
andere industrielle Werke, sowie der selbständigen
Meister im technischen Gewerbe. Die Baugewerk-
schule hat die gleiche Organisation wie die übrigen
Anstalten desselben Namens in Preußen; sie hat
vier Klassen mit einer Gesamt-Unterrichtsdauer von
zwei Jahren und bezweckt die theoretische Aus-
bildung von Bautechnikern; insbesondere will sie
die Kenntnisse und Fertigkeiten verleihen, welcher
in unserer Zeit der Baugewerksmeister zur selb-
ständigen Ausübung seines Berufs bedarf. Die Kunst-
gewerbeschule gliedert sich mit Rücksicht auf die
in Köln besonders vertretenen Hauptgruppen von
kunstgewerblichen Betrieben in folgende Fachab-
teilungen: a) eine für Dekorationsmaler, Muster-
zeichner u. a., b) eine für Kunsttischler und Dekora-
teure, c) eine für Verzierungsbildhauer und Modelleure, d) eine
für Ciseleure und Graveure (Gold-, Silber- und Bronzearbeiter),
e) eine für Kunstschlosser und Stahlgraveure. Jede dieser
Abteilungen hat drei Klassen und für weitere Ziele eine
Oberklasse, so dass die Unterrichtsdauer l]/2 oder 2 Jahre
beträgt. Bei der Organisation der Kunstgewerbeschule war
man darauf bedacht, sie so zu gestalten, dass die Schüler,
nachdem sie die Schule durchlaufen, wieder dem Handwerk
sich zuwenden und durch die erlangte größere Geschicklich-
keit zur Hebung desselben beitragen. Demgemäß ist die
Unterrichtsdauer eine beschränkte und es werden solche
Unterrichtsgegenstände vermieden, welche die der Schule
gezogenen Grenzen überschreiten. Auch die Methode des
Unterrichts geht dahin, dass die Ausführung der Arbeiten
möglichst dem praktischen Bedürfnis sich ansehließt. Eine
allgemeine Ausbildung für das Kunstgewerbeist ausgeschlossen,
da jeder in die Fachabteilungen eintreten muss, für welche
er sich praktisch vorgebildet hat. Die Vorschule bezweckt
die allgemeine Vorbildung für das Handwerk durch eine
Klasse mit einjähriger Unterrichtsdauer. An den Bericht
über die Handwerker-Fortbildungsschule schliesst sich eine
Auseinandersetzung über Zweck und Art des Unterrichts an
den neun verschiedenen allgemeinen Fortbildungsschulen.
Der Besuch der einzelnen Schulen ergiebt sich aus folgenden
f ?M \
KLEINE MITTEILUNGEN.
Köln. Der soeben veröffentlichte Jahresbericht
über die gewerblichen Lehranstalten der Stadt
Köln, nämlich der gewerblichen Fachschule der
Fortbildungsschule bei der Fachschule (Gesellen-
schule) und der allgemeinen Fortbildungsschulen
Lehrlingsschulen) für das Schuljahr 1891/92 giebt
zunächst eine Abhandlung über die Einrichtung
und Ziele der verschiedenen Anstalten, dann geht
der Bericht näher auf die Abteilungen der Fach-
schule, die Maschinenbauschule, Baugewei'kschule,
Kunstgewerbeschule und Vorschule, ein. Die Ma-
schinenbauschule wurde im Herbst 1890 auf An-
regung und mit Unterstützung des etwa 8000 Mit-
glieder zählenden Vereins deutscher Ingenieure um-
gestaltet und umfasst eine höhere Abteilung, die
Technische Mittelschule, und eine niedere, die Werk-
meisterschule. Die Technische Mittelschule hat 6
Klassen und einen Gesamtlehrgang von zwei Jahren,
sie bewirkt die Ausbildung von Beamten und Leitern
technischer Gewerbe, sowie von Hilfskräften für
Konstruktionsbureaus. Die Werkmeisterschule hat
drei Klassen und eine Gesamt-Unterrichtsdauer von
l'/a Jahren; dieselbe dient zur theoretischen Aus-
bildung von Werkmeistern, Monteuren und andern
niederen Technikern für Maschinenfabriken und
andere industrielle Werke, sowie der selbständigen
Meister im technischen Gewerbe. Die Baugewerk-
schule hat die gleiche Organisation wie die übrigen
Anstalten desselben Namens in Preußen; sie hat
vier Klassen mit einer Gesamt-Unterrichtsdauer von
zwei Jahren und bezweckt die theoretische Aus-
bildung von Bautechnikern; insbesondere will sie
die Kenntnisse und Fertigkeiten verleihen, welcher
in unserer Zeit der Baugewerksmeister zur selb-
ständigen Ausübung seines Berufs bedarf. Die Kunst-
gewerbeschule gliedert sich mit Rücksicht auf die
in Köln besonders vertretenen Hauptgruppen von
kunstgewerblichen Betrieben in folgende Fachab-
teilungen: a) eine für Dekorationsmaler, Muster-
zeichner u. a., b) eine für Kunsttischler und Dekora-
teure, c) eine für Verzierungsbildhauer und Modelleure, d) eine
für Ciseleure und Graveure (Gold-, Silber- und Bronzearbeiter),
e) eine für Kunstschlosser und Stahlgraveure. Jede dieser
Abteilungen hat drei Klassen und für weitere Ziele eine
Oberklasse, so dass die Unterrichtsdauer l]/2 oder 2 Jahre
beträgt. Bei der Organisation der Kunstgewerbeschule war
man darauf bedacht, sie so zu gestalten, dass die Schüler,
nachdem sie die Schule durchlaufen, wieder dem Handwerk
sich zuwenden und durch die erlangte größere Geschicklich-
keit zur Hebung desselben beitragen. Demgemäß ist die
Unterrichtsdauer eine beschränkte und es werden solche
Unterrichtsgegenstände vermieden, welche die der Schule
gezogenen Grenzen überschreiten. Auch die Methode des
Unterrichts geht dahin, dass die Ausführung der Arbeiten
möglichst dem praktischen Bedürfnis sich ansehließt. Eine
allgemeine Ausbildung für das Kunstgewerbeist ausgeschlossen,
da jeder in die Fachabteilungen eintreten muss, für welche
er sich praktisch vorgebildet hat. Die Vorschule bezweckt
die allgemeine Vorbildung für das Handwerk durch eine
Klasse mit einjähriger Unterrichtsdauer. An den Bericht
über die Handwerker-Fortbildungsschule schliesst sich eine
Auseinandersetzung über Zweck und Art des Unterrichts an
den neun verschiedenen allgemeinen Fortbildungsschulen.
Der Besuch der einzelnen Schulen ergiebt sich aus folgenden
f ?M \