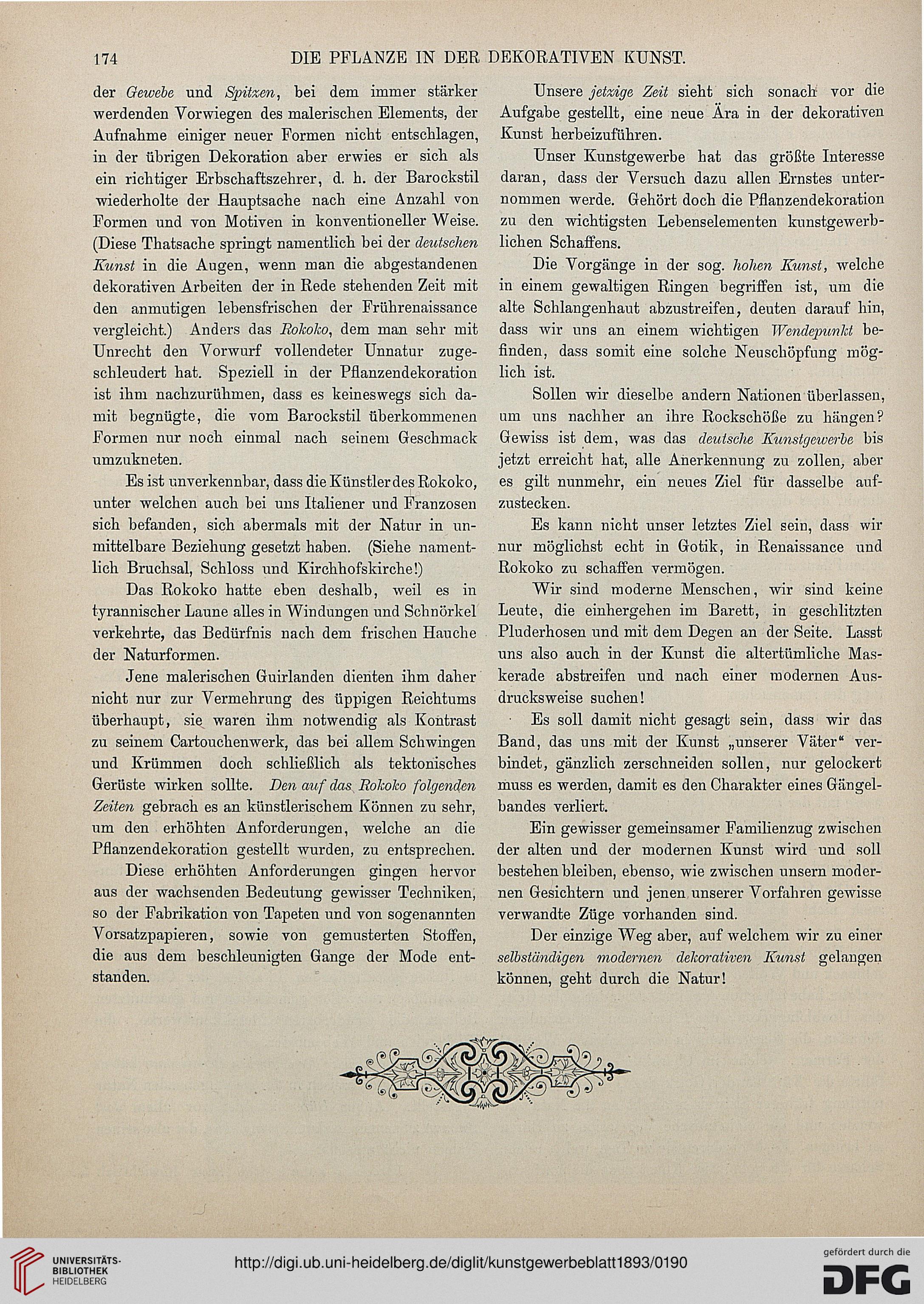174
DIE PFLANZE IN DER DEKORATIVEN KUNST.
der Gewebe und Spitzen, bei dem immer stärker
werdenden Vorwiegen des malerischen Elements, der
Aufnahme einiger neuer Formen nicht entschlagen,
in der übrigen Dekoration aber erwies er sich als
ein richtiger Erbschaftszehrer, d. h. der Barockstil
wiederholte der Hauptsache nach eine Anzahl von
Formen und von Motiven in konventioneller Weise.
(Diese Thatsache springt namentlich bei der deutschen
Kunst in die Augen, wenn man die abgestandenen
dekorativen Arbeiten der in Rede stehenden Zeit mit
den anmutigen lebensfrischen der Frührenaissance
vergleicht.) Anders das Rokoko, dem man sehr mit
Unrecht den Vorwurf vollendeter Unnatur zuge-
schleudert hat. Speziell in der Pflanzendekoration
ist ihm nachzurühmen, dass es keineswegs sich da-
mit begnügte, die vom Barockstil überkommenen
Formen nur noch einmal nach seinem Geschmack
umzukneten.
Es ist unverkennbar, dass die Künstler des Rokoko,
unter welchen auch bei uns Italiener und Franzosen
sich befanden, sich abermals mit der Natur in un-
mittelbare Beziehung gesetzt haben. (Siehe nament-
lich Bruchsal, Schloss und Kirchhofskirche!)
Das Rokoko hatte eben deshalb, weil es in
tyrannischer Laune alles in Windungen und Schnörkel
verkehrte, das Bedürfnis nach dem frischen Hauche
der Naturformen.
Jene malerischen Guirlanden dienten ihm daher
nicht nur zur Vermehrung des üppigen Reichtums
überhaupt, sie waren ihm notwendig als Kontrast
zu seinem Cartouchenwerk, das bei allem Schwingen
und Krümmen doch schließlich als tektonisches
Gerüste wirken sollte. Den auf das Rokoko folgenden
Zeiten gebrach es an künstlerischem Können zu sehr,
um den erhöhten Anforderungen, welche an die
Pflanzendekoration gestellt wurden, zu entsprechen.
Diese erhöhten Anforderungen gingen hervor
aus der wachsenden Bedeutung gewisser Techniken,
so der Fabrikation von Tapeten und von sogenannten
Vorsatzpapieren, sowie von gemusterten Stoffen,
die aus dem beschleunigten Gange der Mode ent-
standen.
Unsere jetzige Zeit sieht sich sonach vor die
Aufgabe gestellt, eine neue Ära in der dekorativen
Kunst herbeizuführen.
Unser Kunstgewerbe hat das größte Interesse
daran, dass der Versuch dazu allen Ernstes unter-
nommen werde. Gehört doch die Pflanzendekoration
zu den wichtigsten Lebenselementen kunstgewerb-
lichen Schaffens.
Die Vorgänge in der sog. hohen Kunst, welche
in einem gewaltigen Ringen begriffen ist, um die
alte Schlangenhaut abzustreifen, deuten darauf hin,
dass wir uns an einem wichtigen Wendepunkt be-
finden, dass somit eine solche Neuschöpfung mög-
lich ist.
Sollen wir dieselbe andern Nationen überlassen,
um uns nachher an ihre Rockschöße zu hängen?
Gewiss ist dem, was das deutsche Kunstgewerbe bis
jetzt erreicht hat, alle Anerkennung zu zollen, aber
es gilt nunmehr, ein neues Ziel für dasselbe auf-
zustecken.
Es kann nicht unser letztes Ziel sein, dass wir
nur möglichst echt in Gotik, in Renaissance und
Rokoko zu schaffen vermögen.
Wir sind moderne Menschen, wir sind keine
Leute, die einhergehen im Barett, in geschlitzten
Pluderhosen und mit dem Degen an der Seite. Lasst
uns also auch in der Kunst die altertümliche Mas-
kerade abstreifen und nach einer modernen Aus-
drucksweise suchen!
• Es soll damit nicht gesagt sein, dass wir das
Band, das uns mit der Kunst „unserer Väter" ver-
bindet, gänzlich zerschneiden sollen, nur gelockert
muss es werden, damit es den Charakter eines Gängel-
bandes verliert.
Ein gewisser gemeinsamer Familienzug zwischen
der alten und der modernen Kunst wird und soll
bestehenbleiben, ebenso, wie zwischen unsern moder-
nen Gesichtern und jenen unserer Vorfahren gewisse
verwandte Züge vorhanden sind.
Der einzige Weg aber, auf welchem wir zu einer
selbständigen modernen dekorativen Kunst gelangen
können, geht durch die Natur!
DIE PFLANZE IN DER DEKORATIVEN KUNST.
der Gewebe und Spitzen, bei dem immer stärker
werdenden Vorwiegen des malerischen Elements, der
Aufnahme einiger neuer Formen nicht entschlagen,
in der übrigen Dekoration aber erwies er sich als
ein richtiger Erbschaftszehrer, d. h. der Barockstil
wiederholte der Hauptsache nach eine Anzahl von
Formen und von Motiven in konventioneller Weise.
(Diese Thatsache springt namentlich bei der deutschen
Kunst in die Augen, wenn man die abgestandenen
dekorativen Arbeiten der in Rede stehenden Zeit mit
den anmutigen lebensfrischen der Frührenaissance
vergleicht.) Anders das Rokoko, dem man sehr mit
Unrecht den Vorwurf vollendeter Unnatur zuge-
schleudert hat. Speziell in der Pflanzendekoration
ist ihm nachzurühmen, dass es keineswegs sich da-
mit begnügte, die vom Barockstil überkommenen
Formen nur noch einmal nach seinem Geschmack
umzukneten.
Es ist unverkennbar, dass die Künstler des Rokoko,
unter welchen auch bei uns Italiener und Franzosen
sich befanden, sich abermals mit der Natur in un-
mittelbare Beziehung gesetzt haben. (Siehe nament-
lich Bruchsal, Schloss und Kirchhofskirche!)
Das Rokoko hatte eben deshalb, weil es in
tyrannischer Laune alles in Windungen und Schnörkel
verkehrte, das Bedürfnis nach dem frischen Hauche
der Naturformen.
Jene malerischen Guirlanden dienten ihm daher
nicht nur zur Vermehrung des üppigen Reichtums
überhaupt, sie waren ihm notwendig als Kontrast
zu seinem Cartouchenwerk, das bei allem Schwingen
und Krümmen doch schließlich als tektonisches
Gerüste wirken sollte. Den auf das Rokoko folgenden
Zeiten gebrach es an künstlerischem Können zu sehr,
um den erhöhten Anforderungen, welche an die
Pflanzendekoration gestellt wurden, zu entsprechen.
Diese erhöhten Anforderungen gingen hervor
aus der wachsenden Bedeutung gewisser Techniken,
so der Fabrikation von Tapeten und von sogenannten
Vorsatzpapieren, sowie von gemusterten Stoffen,
die aus dem beschleunigten Gange der Mode ent-
standen.
Unsere jetzige Zeit sieht sich sonach vor die
Aufgabe gestellt, eine neue Ära in der dekorativen
Kunst herbeizuführen.
Unser Kunstgewerbe hat das größte Interesse
daran, dass der Versuch dazu allen Ernstes unter-
nommen werde. Gehört doch die Pflanzendekoration
zu den wichtigsten Lebenselementen kunstgewerb-
lichen Schaffens.
Die Vorgänge in der sog. hohen Kunst, welche
in einem gewaltigen Ringen begriffen ist, um die
alte Schlangenhaut abzustreifen, deuten darauf hin,
dass wir uns an einem wichtigen Wendepunkt be-
finden, dass somit eine solche Neuschöpfung mög-
lich ist.
Sollen wir dieselbe andern Nationen überlassen,
um uns nachher an ihre Rockschöße zu hängen?
Gewiss ist dem, was das deutsche Kunstgewerbe bis
jetzt erreicht hat, alle Anerkennung zu zollen, aber
es gilt nunmehr, ein neues Ziel für dasselbe auf-
zustecken.
Es kann nicht unser letztes Ziel sein, dass wir
nur möglichst echt in Gotik, in Renaissance und
Rokoko zu schaffen vermögen.
Wir sind moderne Menschen, wir sind keine
Leute, die einhergehen im Barett, in geschlitzten
Pluderhosen und mit dem Degen an der Seite. Lasst
uns also auch in der Kunst die altertümliche Mas-
kerade abstreifen und nach einer modernen Aus-
drucksweise suchen!
• Es soll damit nicht gesagt sein, dass wir das
Band, das uns mit der Kunst „unserer Väter" ver-
bindet, gänzlich zerschneiden sollen, nur gelockert
muss es werden, damit es den Charakter eines Gängel-
bandes verliert.
Ein gewisser gemeinsamer Familienzug zwischen
der alten und der modernen Kunst wird und soll
bestehenbleiben, ebenso, wie zwischen unsern moder-
nen Gesichtern und jenen unserer Vorfahren gewisse
verwandte Züge vorhanden sind.
Der einzige Weg aber, auf welchem wir zu einer
selbständigen modernen dekorativen Kunst gelangen
können, geht durch die Natur!