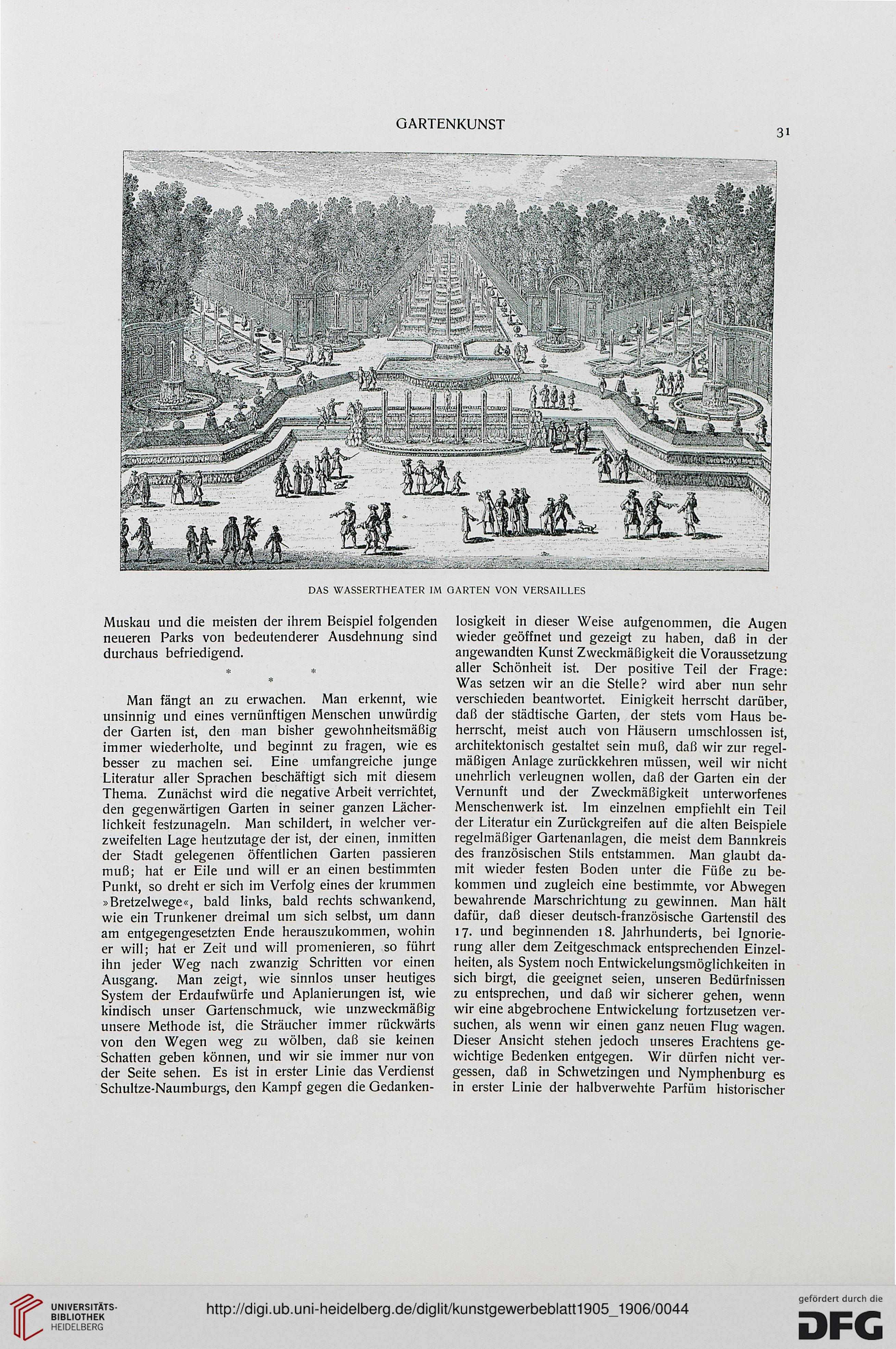GARTENKUNST
31
DAS WASSERTHEATER IM GARTEN VON VERSAILLES
Muskau und die meisten der ihrem Beispiel folgenden
neueren Parks von bedeutenderer Ausdehnung sind
durchaus befriedigend.
Man fängt an zu erwachen. Man erkennt, wie
unsinnig und eines vernünftigen Menschen unwürdig
der Garten ist, den man bisher gewohnheitsmäßig
immer wiederholte, und beginnt zu fragen, wie es
besser zu machen sei. Eine umfangreiche junge
Literatur aller Sprachen beschäftigt sich mit diesem
Thema. Zunächst wird die negative Arbeit verrichtet,
den gegenwärtigen Garten in seiner ganzen Lächer-
lichkeit festzunageln. Man schildert, in welcher ver-
zweifelten Lage heutzutage der ist, der einen, inmitten
der Stadt gelegenen öffentlichen Garten passieren
muß; hat er Eile und will er an einen bestimmten
Punkt, so dreht er sich im Verfolg eines der krummen
»Bretzelwege«, bald links, bald rechts schwankend,
wie ein Trunkener dreimal um sich selbst, um dann
am entgegengesetzten Ende herauszukommen, wohin
er will; hat er Zeit und will promenieren, so führt
ihn jeder Weg nach zwanzig Schritten vor einen
Ausgang. Man zeigt, wie sinnlos unser heutiges
System der Erdaufwürfe und Aplanierungen ist, wie
kindisch unser Gartenschmuck, wie unzweckmäßig
unsere Methode ist, die Sträucher immer rückwärts
von den Wegen weg zu wölben, daß sie keinen
Schatten geben können, und wir sie immer nur von
der Seite sehen. Es ist in erster Linie das Verdienst
Schultze-Naumburgs, den Kampf gegen die Gedanken-
losigkeit in dieser Weise aufgenommen, die Augen
wieder geöffnet und gezeigt zu haben, daß in der
angewandten Kunst Zweckmäßigkeit die Voraussetzung
aller Schönheit ist. Der positive Teil der Frage:
Was setzen wir an die Stelle? wird aber nun sehr
verschieden beantwortet. Einigkeit herrscht darüber,
daß der städtische Garten, der stets vom Haus be-
herrscht, meist auch von Häusern umschlossen ist,
architektonisch gestaltet sein muß, daß wir zur regel-
mäßigen Anlage zurückkehren müssen, weil wir nicht
unehrlich verleugnen wollen, daß der Garten ein der
Vernunft und der Zweckmäßigkeit unterworfenes
Menschenwerk ist. Im einzelnen empfiehlt ein Teil
der Literatur ein Zurückgreifen auf die alten Beispiele
regelmäßiger Gartenanlagen, die meist dem Bannkreis
des französischen Stils entstammen. Man glaubt da-
mit wieder festen Boden unter die Füße zu be-
kommen und zugleich eine bestimmte, vor Abwegen
bewahrende Marschrichtung zu gewinnen. Man hält
dafür, daß dieser deutsch-französische Gartenstil des
17. und beginnenden 18. Jahrhunderts, bei Ignorie-
rung aller dem Zeitgeschmack entsprechenden Einzel-
heiten, als System noch Entwickelungsmöglichkeiten in
sich birgt, die geeignet seien, unseren Bedürfnissen
zu entsprechen, und daß wir sicherer gehen, wenn
wir eine abgebrochene Entwicklung fortzusetzen ver-
suchen, als wenn wir einen ganz neuen Flug wagen.
Dieser Ansicht stehen jedoch unseres Erachtens ge-
wichtige Bedenken entgegen. Wir dürfen nicht ver-
gessen, daß in Schwetzingen und Nymphenburg es
in erster Linie der halbverwehte Parfüm historischer
31
DAS WASSERTHEATER IM GARTEN VON VERSAILLES
Muskau und die meisten der ihrem Beispiel folgenden
neueren Parks von bedeutenderer Ausdehnung sind
durchaus befriedigend.
Man fängt an zu erwachen. Man erkennt, wie
unsinnig und eines vernünftigen Menschen unwürdig
der Garten ist, den man bisher gewohnheitsmäßig
immer wiederholte, und beginnt zu fragen, wie es
besser zu machen sei. Eine umfangreiche junge
Literatur aller Sprachen beschäftigt sich mit diesem
Thema. Zunächst wird die negative Arbeit verrichtet,
den gegenwärtigen Garten in seiner ganzen Lächer-
lichkeit festzunageln. Man schildert, in welcher ver-
zweifelten Lage heutzutage der ist, der einen, inmitten
der Stadt gelegenen öffentlichen Garten passieren
muß; hat er Eile und will er an einen bestimmten
Punkt, so dreht er sich im Verfolg eines der krummen
»Bretzelwege«, bald links, bald rechts schwankend,
wie ein Trunkener dreimal um sich selbst, um dann
am entgegengesetzten Ende herauszukommen, wohin
er will; hat er Zeit und will promenieren, so führt
ihn jeder Weg nach zwanzig Schritten vor einen
Ausgang. Man zeigt, wie sinnlos unser heutiges
System der Erdaufwürfe und Aplanierungen ist, wie
kindisch unser Gartenschmuck, wie unzweckmäßig
unsere Methode ist, die Sträucher immer rückwärts
von den Wegen weg zu wölben, daß sie keinen
Schatten geben können, und wir sie immer nur von
der Seite sehen. Es ist in erster Linie das Verdienst
Schultze-Naumburgs, den Kampf gegen die Gedanken-
losigkeit in dieser Weise aufgenommen, die Augen
wieder geöffnet und gezeigt zu haben, daß in der
angewandten Kunst Zweckmäßigkeit die Voraussetzung
aller Schönheit ist. Der positive Teil der Frage:
Was setzen wir an die Stelle? wird aber nun sehr
verschieden beantwortet. Einigkeit herrscht darüber,
daß der städtische Garten, der stets vom Haus be-
herrscht, meist auch von Häusern umschlossen ist,
architektonisch gestaltet sein muß, daß wir zur regel-
mäßigen Anlage zurückkehren müssen, weil wir nicht
unehrlich verleugnen wollen, daß der Garten ein der
Vernunft und der Zweckmäßigkeit unterworfenes
Menschenwerk ist. Im einzelnen empfiehlt ein Teil
der Literatur ein Zurückgreifen auf die alten Beispiele
regelmäßiger Gartenanlagen, die meist dem Bannkreis
des französischen Stils entstammen. Man glaubt da-
mit wieder festen Boden unter die Füße zu be-
kommen und zugleich eine bestimmte, vor Abwegen
bewahrende Marschrichtung zu gewinnen. Man hält
dafür, daß dieser deutsch-französische Gartenstil des
17. und beginnenden 18. Jahrhunderts, bei Ignorie-
rung aller dem Zeitgeschmack entsprechenden Einzel-
heiten, als System noch Entwickelungsmöglichkeiten in
sich birgt, die geeignet seien, unseren Bedürfnissen
zu entsprechen, und daß wir sicherer gehen, wenn
wir eine abgebrochene Entwicklung fortzusetzen ver-
suchen, als wenn wir einen ganz neuen Flug wagen.
Dieser Ansicht stehen jedoch unseres Erachtens ge-
wichtige Bedenken entgegen. Wir dürfen nicht ver-
gessen, daß in Schwetzingen und Nymphenburg es
in erster Linie der halbverwehte Parfüm historischer