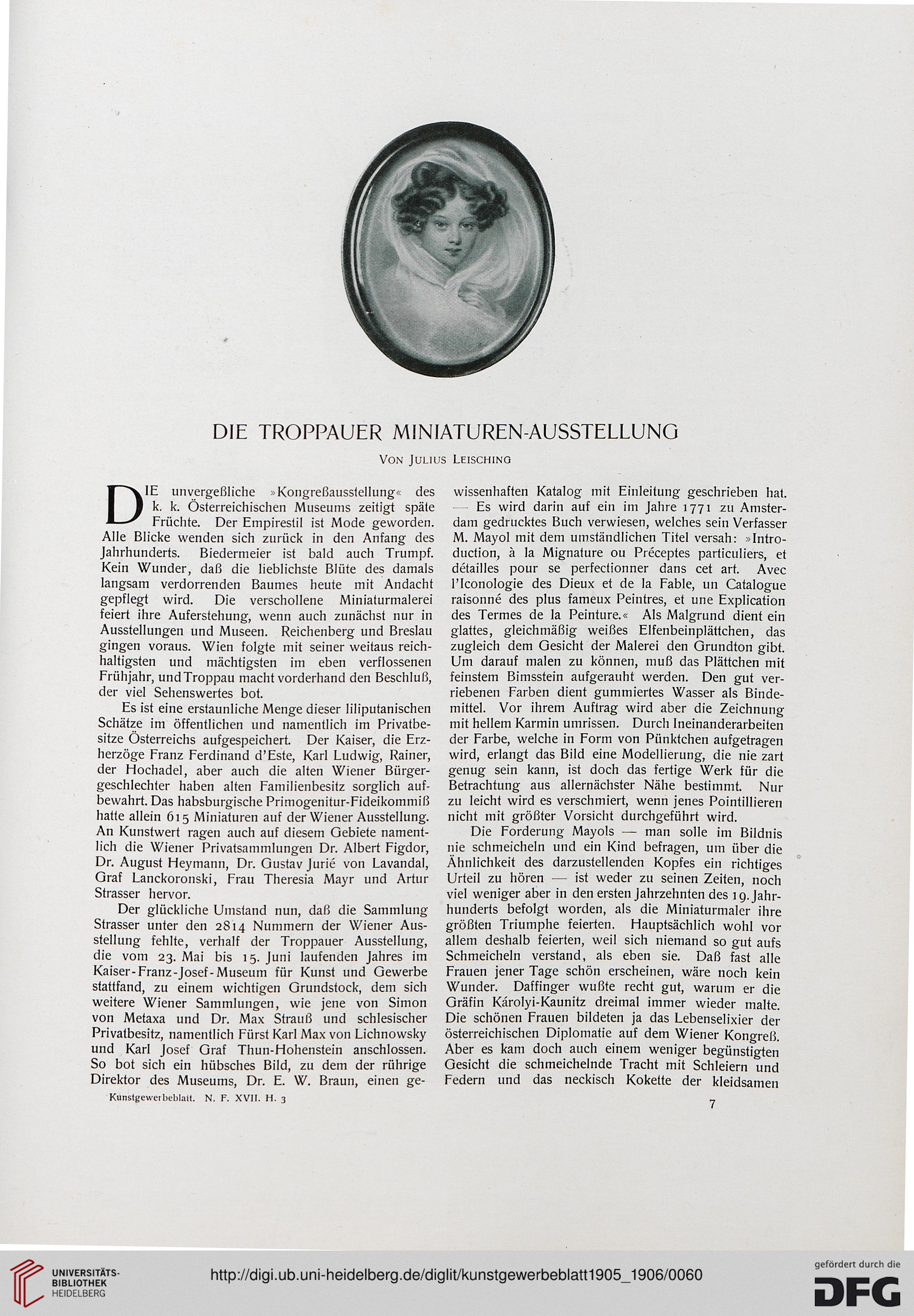DIE TROPPAUER MINIATUREN-AUSSTELLUNG
Von Julius Leischino
DIE unvergeßliche »Kongreßaussfellung« des
k. k. Österreichischen Museums zeitigt späte
Früchte. Der Empirestil ist Mode geworden.
Alle Blicke wenden sich zurück in den Anfang des
Jahrhunderts. Biedermeier ist bald auch Trumpf.
Kein Wunder, daß die lieblichste Blüte des damals
langsam verdorrenden Baumes heute mit Andacht
gepflegt wird. Die verschollene Miniaturmalerei
feiert ihre Auferstehung, wenn auch zunächst nur in
Ausstellungen und Museen. Reichenberg und Breslau
gingen voraus. Wien folgte mit seiner weitaus reich-
haltigsten und mächtigsten im eben verflossenen
Frühjahr, undTroppau macht vorderhand den Beschluß,
der viel Sehenswertes bot.
Es ist eine erstaunliche Menge dieser liliputanischen
Schätze im öffentlichen und namentlich im Privatbe-
sitze Österreichs aufgespeichert. Der Kaiser, die Erz-
herzöge Franz Ferdinand d'Este, Karl Ludwig, Rainer,
der Hochadel, aber auch die alten Wiener Bürger-
geschlechter haben alten Familienbesitz sorglich auf-
bewahrt. Das habsburgische Primogenitur-Fideikommiß
hatte allein 615 Miniaturen auf der Wiener Ausstellung.
An Kunstwert ragen auch auf diesem Gebiete nament-
lich die Wiener Privatsammlungen Dr. Albert Figdor,
Dr. August Heymann, Dr. Gustav Jurie von Lavandal,
Graf Lanckoronski, Frau Theresia Mayr und Artur
Strasser hervor.
Der glückliche Umstand nun, daß die Sammlung
Strasser unter den 2814 Nummern der Wiener Aus-
stellung fehlte, verhalf der Troppauer Ausstellung,
die vom 23. Mai bis 15. Juni laufenden Jahres im
Kaiser-Franz-Josef-Museum für Kunst und Gewerbe
stattfand, zu einem wichtigen Grundstock, dem sich
weitere Wiener Sammlungen, wie jene von Simon
von Metaxa und Dr. Max Strauß und schlesischer
Privatbesitz, namentlich Fürst Karl Max von Lichnowsky
und Karl Josef Graf Thun-Hohenstein anschlössen.
So bot sich ein hübsches Bild, zu dem der rührige
Direktor des Museums, Dr. E. W. Braun, einen ge-
Kunstgewerbeblait. N. F. XVII. H. 3
wissenhaften Katalog mit Einleitung geschrieben hat.
Es wird darin auf ein im Jahre 1771 zu Amster-
dam gedrucktes Buch verwiesen, welches sein Verfasser
M. Mayol mit dem umständlichen Titel versah: »Intro-
duction, ä la Mignature ou Preceptes particuliers, et
detailles pour se perfectionner dans cet art. Avec
l'Iconologie des Dieux et de la Fable, un Catalogue
raisonne des plus fameux Peintres, et une Explication
des Termes de la Peinture.« Als Malgrund dient ein
glattes, gleichmäßig weißes Elfenbeinplättchen, das
zugleich dem Gesicht der Malerei den Grundton gibt.
Um darauf malen zu können, muß das Plättchen mit
feinstem Bimsstein aufgerauht werden. Den gut ver-
riebenen Farben dient gummiertes Wasser als Binde-
mittel. Vor ihrem Auftrag wird aber die Zeichnung
mit hellem Karmin umrissen. Durch Ineinanderarbeiten
der Farbe, welche in Form von Pünktchen aufgetragen
wird, erlangt das Bild eine Modellierung, die nie zart
genug sein kann, ist doch das fertige Werk für die
Betrachtung aus allernächster Nähe bestimmt. Nur
zu leicht wird es verschmiert, wenn jenes Pointillieren
nicht mit größter Vorsicht durchgeführt wird.
Die Forderung Mayols — man solle im Bildnis
nie schmeicheln und ein Kind befragen, um über die
Ähnlichkeit des darzustellenden Kopfes ein richtiges
Urteil zu hören — ist weder zu seinen Zeiten, noch
viel weniger aber in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts befolgt worden, als die Miniaturmaler ihre
größten Triumphe feierten. Hauptsächlich wohl vor
allem deshalb feierten, weil sich niemand so gut aufs
Schmeicheln verstand, als eben sie. Daß fast alle
Frauen jener Tage schön erscheinen, wäre noch kein
Wunder. Daffinger wußte recht gut, warum er die
Gräfin Kärolyi-Kaunitz dreimal immer wieder malte.
Die schönen Frauen bildeten ja das Lebenselixier der
österreichischen Diplomatie auf dem Wiener Kongreß.
Aber es kam doch auch einem weniger begünstigten
Gesicht die schmeichelnde Tracht mit Schleiern und
Federn und das neckisch Kokette der kleidsamen
Von Julius Leischino
DIE unvergeßliche »Kongreßaussfellung« des
k. k. Österreichischen Museums zeitigt späte
Früchte. Der Empirestil ist Mode geworden.
Alle Blicke wenden sich zurück in den Anfang des
Jahrhunderts. Biedermeier ist bald auch Trumpf.
Kein Wunder, daß die lieblichste Blüte des damals
langsam verdorrenden Baumes heute mit Andacht
gepflegt wird. Die verschollene Miniaturmalerei
feiert ihre Auferstehung, wenn auch zunächst nur in
Ausstellungen und Museen. Reichenberg und Breslau
gingen voraus. Wien folgte mit seiner weitaus reich-
haltigsten und mächtigsten im eben verflossenen
Frühjahr, undTroppau macht vorderhand den Beschluß,
der viel Sehenswertes bot.
Es ist eine erstaunliche Menge dieser liliputanischen
Schätze im öffentlichen und namentlich im Privatbe-
sitze Österreichs aufgespeichert. Der Kaiser, die Erz-
herzöge Franz Ferdinand d'Este, Karl Ludwig, Rainer,
der Hochadel, aber auch die alten Wiener Bürger-
geschlechter haben alten Familienbesitz sorglich auf-
bewahrt. Das habsburgische Primogenitur-Fideikommiß
hatte allein 615 Miniaturen auf der Wiener Ausstellung.
An Kunstwert ragen auch auf diesem Gebiete nament-
lich die Wiener Privatsammlungen Dr. Albert Figdor,
Dr. August Heymann, Dr. Gustav Jurie von Lavandal,
Graf Lanckoronski, Frau Theresia Mayr und Artur
Strasser hervor.
Der glückliche Umstand nun, daß die Sammlung
Strasser unter den 2814 Nummern der Wiener Aus-
stellung fehlte, verhalf der Troppauer Ausstellung,
die vom 23. Mai bis 15. Juni laufenden Jahres im
Kaiser-Franz-Josef-Museum für Kunst und Gewerbe
stattfand, zu einem wichtigen Grundstock, dem sich
weitere Wiener Sammlungen, wie jene von Simon
von Metaxa und Dr. Max Strauß und schlesischer
Privatbesitz, namentlich Fürst Karl Max von Lichnowsky
und Karl Josef Graf Thun-Hohenstein anschlössen.
So bot sich ein hübsches Bild, zu dem der rührige
Direktor des Museums, Dr. E. W. Braun, einen ge-
Kunstgewerbeblait. N. F. XVII. H. 3
wissenhaften Katalog mit Einleitung geschrieben hat.
Es wird darin auf ein im Jahre 1771 zu Amster-
dam gedrucktes Buch verwiesen, welches sein Verfasser
M. Mayol mit dem umständlichen Titel versah: »Intro-
duction, ä la Mignature ou Preceptes particuliers, et
detailles pour se perfectionner dans cet art. Avec
l'Iconologie des Dieux et de la Fable, un Catalogue
raisonne des plus fameux Peintres, et une Explication
des Termes de la Peinture.« Als Malgrund dient ein
glattes, gleichmäßig weißes Elfenbeinplättchen, das
zugleich dem Gesicht der Malerei den Grundton gibt.
Um darauf malen zu können, muß das Plättchen mit
feinstem Bimsstein aufgerauht werden. Den gut ver-
riebenen Farben dient gummiertes Wasser als Binde-
mittel. Vor ihrem Auftrag wird aber die Zeichnung
mit hellem Karmin umrissen. Durch Ineinanderarbeiten
der Farbe, welche in Form von Pünktchen aufgetragen
wird, erlangt das Bild eine Modellierung, die nie zart
genug sein kann, ist doch das fertige Werk für die
Betrachtung aus allernächster Nähe bestimmt. Nur
zu leicht wird es verschmiert, wenn jenes Pointillieren
nicht mit größter Vorsicht durchgeführt wird.
Die Forderung Mayols — man solle im Bildnis
nie schmeicheln und ein Kind befragen, um über die
Ähnlichkeit des darzustellenden Kopfes ein richtiges
Urteil zu hören — ist weder zu seinen Zeiten, noch
viel weniger aber in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts befolgt worden, als die Miniaturmaler ihre
größten Triumphe feierten. Hauptsächlich wohl vor
allem deshalb feierten, weil sich niemand so gut aufs
Schmeicheln verstand, als eben sie. Daß fast alle
Frauen jener Tage schön erscheinen, wäre noch kein
Wunder. Daffinger wußte recht gut, warum er die
Gräfin Kärolyi-Kaunitz dreimal immer wieder malte.
Die schönen Frauen bildeten ja das Lebenselixier der
österreichischen Diplomatie auf dem Wiener Kongreß.
Aber es kam doch auch einem weniger begünstigten
Gesicht die schmeichelnde Tracht mit Schleiern und
Federn und das neckisch Kokette der kleidsamen