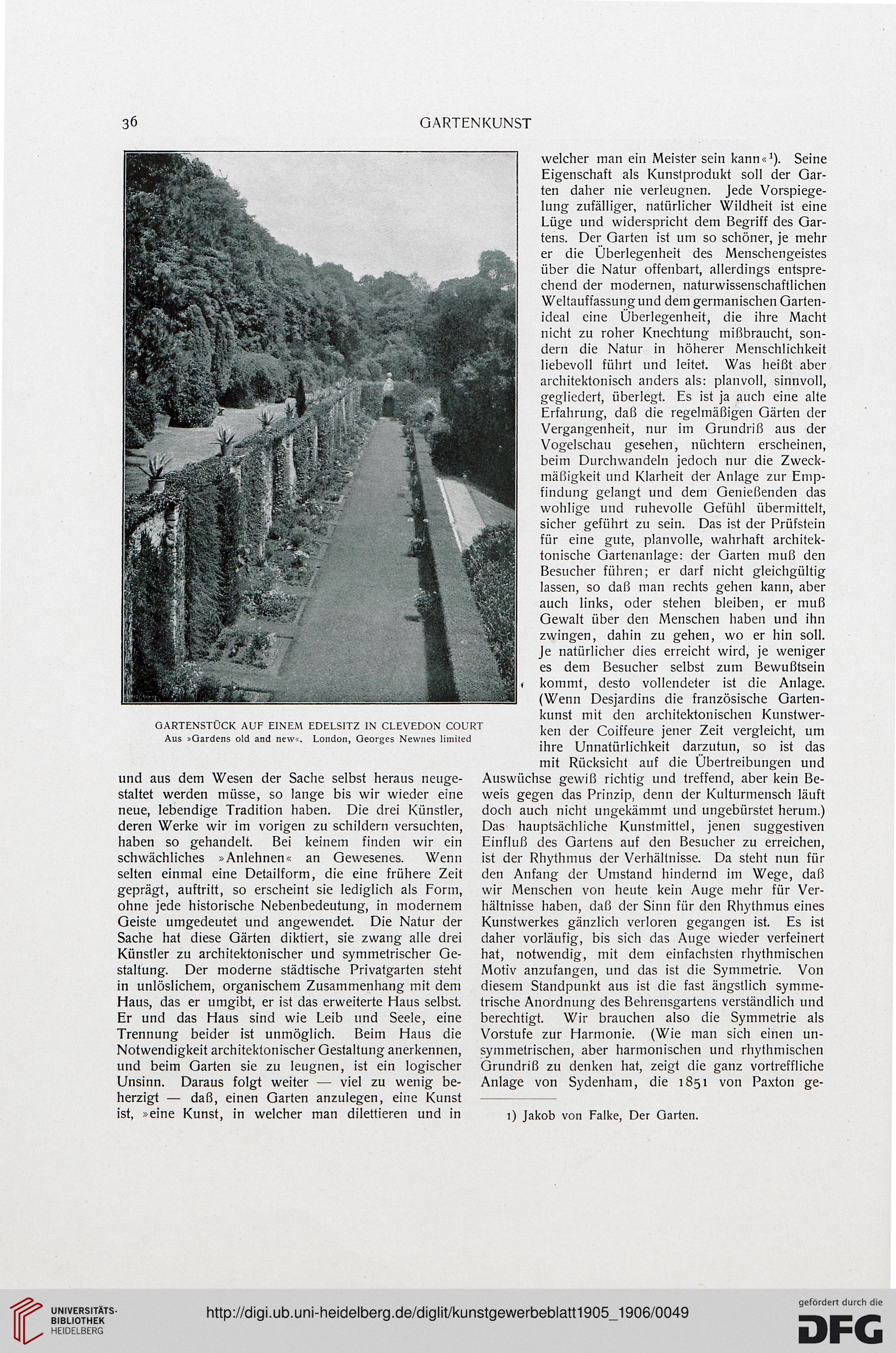36
GARTENKUNST
GARTENSTUCK AUF EINEM EDELSITZ IN CLEVEDON COURT
Aus »Gardens old and new«. London, Georges Newnes limited
und aus dem Wesen der Sache selbst heraus neuge-
staltet werden müsse, so lange bis wir wieder eine
neue, lebendige Tradition haben. Die drei Künstler,
deren Werke wir im vorigen zu schildern versuchten,
haben so gehandelt. Bei keinem finden wir ein
schwächliches »Anlehnen« an Gewesenes. Wenn
selten einmal eine Detailform, die eine frühere Zeit
geprägt, auftritt, so erscheint sie lediglich als Form,
ohne jede historische Nebenbedeutung, in modernem
Geiste umgedeutet und angewendet. Die Natur der
Sache hat diese Gärten diktiert, sie zwang alle drei
Künstler zu architektonischer und symmetrischer Ge-
staltung. Der moderne städtische Privatgarten steht
in unlöslichem, organischem Zusammenhang mit dem
Haus, das er umgibt, er ist das erweiterte Haus selbst.
Er und das Haus sind wie Leib und Seele, eine
Trennung beider ist unmöglich. Beim Haus die
Notwendigkeit architektonischer Gestaltung anerkennen,
und beim Garten sie zu leugnen, ist ein logischer
Unsinn. Daraus folgt weiter — viel zu wenig be-
herzigt — daß, einen Garten anzulegen, eine Kunst
ist, »eine Kunst, in welcher man dilettieren und in
welcher man ein Meister sein kann«1). Seine
Eigenschaft als Kunstprodukt soll der Gar-
ten daher nie verleugnen. Jede Vorspiege-
lung zufälliger, natürlicher Wildheit ist eine
Lüge und widerspricht dem Begriff des Gar-
tens. Der Garten ist um so schöner, je mehr
er die Überlegenheit des Menschengeistes
über die Natur offenbart, allerdings entspre-
chend der modernen, naturwissenschaftlichen
Weltauffassung und dem germanischen Garten-
ideal eine Überlegenheit, die ihre Macht
nicht zu roher Knechtung mißbraucht, son-
dern die Natur in höherer Menschlichkeit
liebevoll führt und leitet. Was heißt aber
architektonisch anders als: planvoll, sinnvoll,
gegliedert, überlegt. Es ist ja auch eine alte
Erfahrung, daß die regelmäßigen Gärten der
Vergangenheit, nur im Grundriß aus der
Vogelschau gesehen, nüchtern erscheinen,
beim Durchwandeln jedoch nur die Zweck-
mäßigkeit und Klarheit der Anlage zur Emp-
findung gelangt und dem Genießenden das
wohlige und ruhevolle Gefühl übermittelt,
sicher geführt zu sein. Das ist der Prüfstein
für eine gute, planvolle, wahrhaft architek-
tonische Gartenanlage: der Garten muß den
Besucher führen; er darf nicht gleichgültig
lassen, so daß man rechts gehen kann, aber
auch links, oder stehen bleiben, er muß
Gewalt über den Menschen haben und ihn
zwingen, dahin zu gehen, wo er hin soll.
Je natürlicher dies erreicht wird, je weniger
es dem Besucher selbst zum Bewußtsein
kommt, desto vollendeter ist die Anlage.
(Wenn Desjardins die französische Garten-
kunst mit den architektonischen Kunstwer-
ken der Coiffeure jener Zeit vergleicht, um
ihre Unnatürlichkeit darzutun, so ist das
mit Rücksicht auf die Übertreibungen und
Auswüchse gewiß richtig und treffend, aber kein Be-
weis gegen das Prinzip, denn der Kulturmensch läuft
doch auch nicht ungekämmt und ungebürstet herum.)
Das hauptsächliche Kunstmittel, jenen suggestiven
Einfluß des Gartens auf den Besucher zu erreichen,
ist der Rhythmus der Verhältnisse. Da steht nun für
den Anfang der Umstand hindernd im Wege, daß
wir Menschen von heute kein Auge mehr für Ver-
hältnisse haben, daß der Sinn für den Rhythmus eines
Kunstwerkes gänzlich verloren gegangen ist. Es ist
daher vorläufig, bis sich das Auge wieder verfeinert
hat, notwendig, mit dem einfachsten rhythmischen
Motiv anzufangen, und das ist die Symmetrie. Von
diesem Standpunkt aus ist die fast ängstlich symme-
trische Anordnung des Behrensgartens verständlich und
berechtigt. Wir brauchen also die Symmetrie als
Vorstufe zur Harmonie. (Wie man sich einen un-
symmetrischen, aber harmonischen und rhythmischen
Grundriß zu denken hat, zeigt die ganz vortreffliche
Anlage von Sydenham, die 1851 von Paxton ge-
1) Jakob von Falke, Der Garten.
GARTENKUNST
GARTENSTUCK AUF EINEM EDELSITZ IN CLEVEDON COURT
Aus »Gardens old and new«. London, Georges Newnes limited
und aus dem Wesen der Sache selbst heraus neuge-
staltet werden müsse, so lange bis wir wieder eine
neue, lebendige Tradition haben. Die drei Künstler,
deren Werke wir im vorigen zu schildern versuchten,
haben so gehandelt. Bei keinem finden wir ein
schwächliches »Anlehnen« an Gewesenes. Wenn
selten einmal eine Detailform, die eine frühere Zeit
geprägt, auftritt, so erscheint sie lediglich als Form,
ohne jede historische Nebenbedeutung, in modernem
Geiste umgedeutet und angewendet. Die Natur der
Sache hat diese Gärten diktiert, sie zwang alle drei
Künstler zu architektonischer und symmetrischer Ge-
staltung. Der moderne städtische Privatgarten steht
in unlöslichem, organischem Zusammenhang mit dem
Haus, das er umgibt, er ist das erweiterte Haus selbst.
Er und das Haus sind wie Leib und Seele, eine
Trennung beider ist unmöglich. Beim Haus die
Notwendigkeit architektonischer Gestaltung anerkennen,
und beim Garten sie zu leugnen, ist ein logischer
Unsinn. Daraus folgt weiter — viel zu wenig be-
herzigt — daß, einen Garten anzulegen, eine Kunst
ist, »eine Kunst, in welcher man dilettieren und in
welcher man ein Meister sein kann«1). Seine
Eigenschaft als Kunstprodukt soll der Gar-
ten daher nie verleugnen. Jede Vorspiege-
lung zufälliger, natürlicher Wildheit ist eine
Lüge und widerspricht dem Begriff des Gar-
tens. Der Garten ist um so schöner, je mehr
er die Überlegenheit des Menschengeistes
über die Natur offenbart, allerdings entspre-
chend der modernen, naturwissenschaftlichen
Weltauffassung und dem germanischen Garten-
ideal eine Überlegenheit, die ihre Macht
nicht zu roher Knechtung mißbraucht, son-
dern die Natur in höherer Menschlichkeit
liebevoll führt und leitet. Was heißt aber
architektonisch anders als: planvoll, sinnvoll,
gegliedert, überlegt. Es ist ja auch eine alte
Erfahrung, daß die regelmäßigen Gärten der
Vergangenheit, nur im Grundriß aus der
Vogelschau gesehen, nüchtern erscheinen,
beim Durchwandeln jedoch nur die Zweck-
mäßigkeit und Klarheit der Anlage zur Emp-
findung gelangt und dem Genießenden das
wohlige und ruhevolle Gefühl übermittelt,
sicher geführt zu sein. Das ist der Prüfstein
für eine gute, planvolle, wahrhaft architek-
tonische Gartenanlage: der Garten muß den
Besucher führen; er darf nicht gleichgültig
lassen, so daß man rechts gehen kann, aber
auch links, oder stehen bleiben, er muß
Gewalt über den Menschen haben und ihn
zwingen, dahin zu gehen, wo er hin soll.
Je natürlicher dies erreicht wird, je weniger
es dem Besucher selbst zum Bewußtsein
kommt, desto vollendeter ist die Anlage.
(Wenn Desjardins die französische Garten-
kunst mit den architektonischen Kunstwer-
ken der Coiffeure jener Zeit vergleicht, um
ihre Unnatürlichkeit darzutun, so ist das
mit Rücksicht auf die Übertreibungen und
Auswüchse gewiß richtig und treffend, aber kein Be-
weis gegen das Prinzip, denn der Kulturmensch läuft
doch auch nicht ungekämmt und ungebürstet herum.)
Das hauptsächliche Kunstmittel, jenen suggestiven
Einfluß des Gartens auf den Besucher zu erreichen,
ist der Rhythmus der Verhältnisse. Da steht nun für
den Anfang der Umstand hindernd im Wege, daß
wir Menschen von heute kein Auge mehr für Ver-
hältnisse haben, daß der Sinn für den Rhythmus eines
Kunstwerkes gänzlich verloren gegangen ist. Es ist
daher vorläufig, bis sich das Auge wieder verfeinert
hat, notwendig, mit dem einfachsten rhythmischen
Motiv anzufangen, und das ist die Symmetrie. Von
diesem Standpunkt aus ist die fast ängstlich symme-
trische Anordnung des Behrensgartens verständlich und
berechtigt. Wir brauchen also die Symmetrie als
Vorstufe zur Harmonie. (Wie man sich einen un-
symmetrischen, aber harmonischen und rhythmischen
Grundriß zu denken hat, zeigt die ganz vortreffliche
Anlage von Sydenham, die 1851 von Paxton ge-
1) Jakob von Falke, Der Garten.