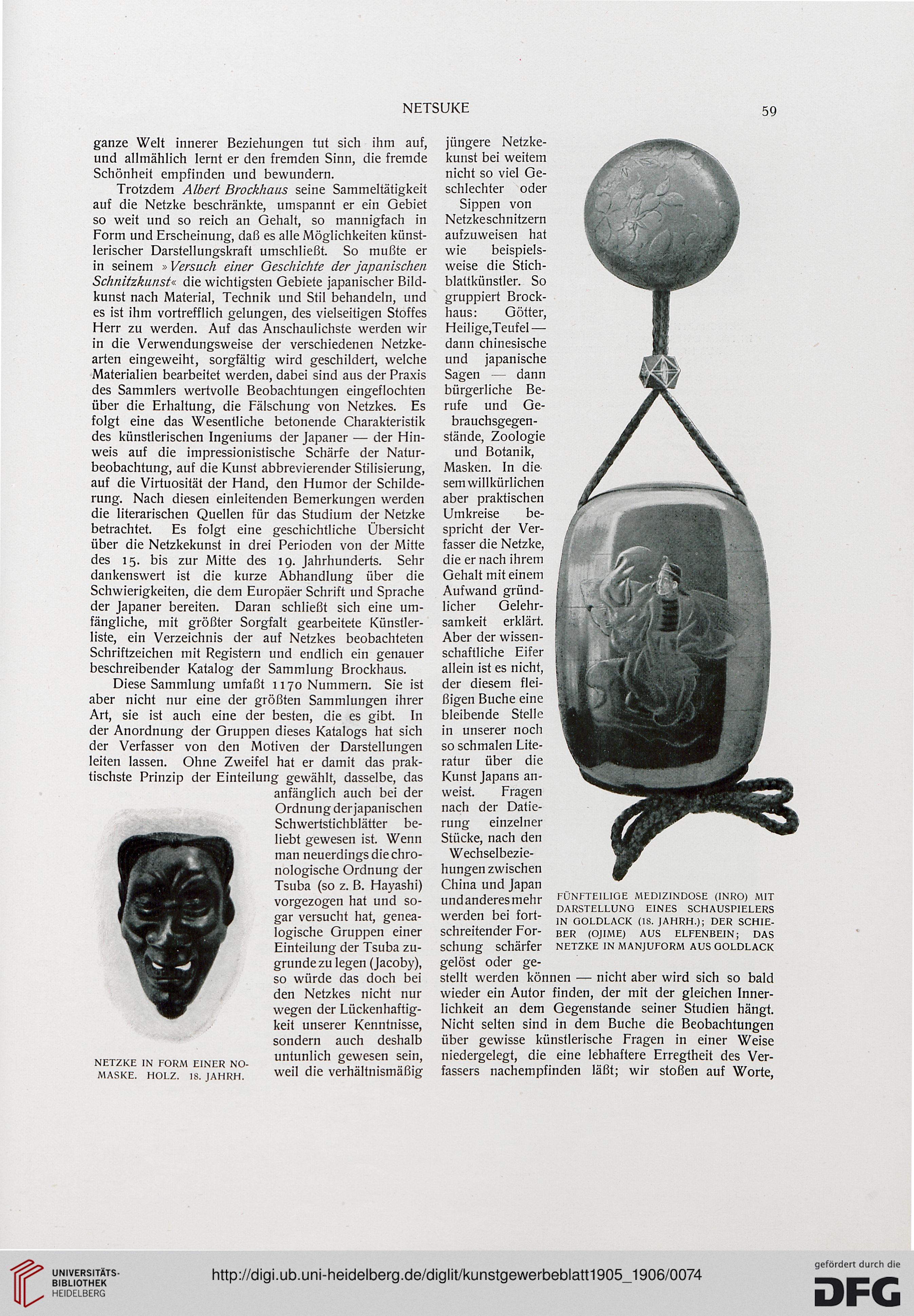NETSÜKE
59
ganze Welt innerer Beziehungen tut sich ihm auf,
und allmählich lernt er den fremden Sinn, die fremde
Schönheit empfinden und bewundern.
Trotzdem Albert Brockhaus seine Sammeltätigkeit
auf die Netzke beschränkte, umspannt er ein Gebiet
so weit und so reich an Gehalt, so mannigfach in
Form und Erscheinung, daß es alle Möglichkeiten künst-
lerischer Darstellungskraft umschließt. So mußte er
in seinem »Versuch einer Geschichte der japanischen
Schnitzkunst« die wichtigsten Gebiete japanischer Bild-
kunst nach Material, Technik und Stil behandeln, und
es ist ihm vortrefflich gelungen, des vielseitigen Stoffes
Herr zu werden. Auf das Anschaulichste werden wir
in die Verwendungsweise der verschiedenen Netzke-
arten eingeweiht, sorgfältig wird geschildert, welche
Materialien bearbeitet werden, dabei sind aus der Praxis
des Sammlers wertvolle Beobachtungen eingeflochten
über die Erhaltung, die Fälschung von Netzkes. Es
folgt eine das Wesentliche betonende Charakteristik
des künstlerischen Ingeniums der Japaner — der Hin-
weis auf die impressionistische Schärfe der Natur-
beobachtung, auf die Kunst abbrevierender Stilisierung,
auf die Virtuosität der Hand, den Humor der Schilde-
rung. Nach diesen einleitenden Bemerkungen werden
die literarischen Quellen für das Studium der Netzke
betrachtet. Es folgt eine geschichtliche Übersicht
über die Netzkekunst in drei Perioden von der Mitte
des 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Sehr
dankenswert ist die kurze Abhandlung über die
Schwierigkeiten, die dem Europäer Schrift und Sprache
der Japaner bereiten. Daran schließt sich eine um-
fängliche, mit größter Sorgfalt gearbeitete Künsller-
liste, ein Verzeichnis der auf Netzkes beobachteten
Schriftzeichen mit Registern und endlich ein genauer
beschreibender Katalog der Sammlung Brockhaus.
Diese Sammlung umfaßt 1170 Nummern. Sie ist
aber nicht nur eine der größten Sammlungen ihrer
Art, sie ist auch eine der besten, die es gibt. In
der Anordnung der Gruppen dieses Katalogs hat sich
der Verfasser von den Motiven der Darstellungen
leiten lassen. Ohne Zweifel hat er damit das prak-
tischste Prinzip der Einteilung gewählt, dasselbe, das
anfänglich auch bei der
Ordnung der japanischen
Schwertstichblätter be-
liebt gewesen ist. Wenn
man neuerdings die chro-
nologische Ordnung der
Tsuba (so z. B. Hayashi)
vorgezogen hat und so-
gar versucht hat, genea-
logische Gruppen einer
Einteilung der Tsuba zu-
grunde zu legen (Jacoby),
so würde das doch bei
den Netzkes nicht nur
wegen der Lückenhaftig-
keit unserer Kenntnisse,
sondern auch deshalb
NETZKE IN FORM E.NER NO- "ntunHch 8»«" S.dH,
maske. holz. i8. jAHRH. weil die verhältnismäßig
jüngere Netzke-
kunst bei weitem
nicht so viel Ge-
schlechter oder
Sippen von
Netzkeschnitzern
aufzuweisen hat
wie beispiels-
weise die Stich-
blattkünstler. So
gruppiert Brock-
haus: Götter,
Heilige,Teufel —
dann chinesische
und japanische
Sagen — dann
bürgerliche Be-
rufe und Ge-
brauchsgegen-
stände, Zoologie
und Botanik,
Masken. In die-
sem willkürlichen
aber praktischen
Umkreise be-
spricht der Ver-
fasser die Netzke,
die er nach ihrem
Gehalt mit einem
Aufwand gründ-
licher Gelehr-
samkeit erklärt.
Aber der wissen-
schaftliche Eifer
allein ist es nicht,
der diesem flei-
ßigen Buche eine
bleibende Stelle
in unserer noch
so schmalen Lite-
ratur über die
Kunst Japans an-
weist. Fragen
nach der Datie-
rung einzelner
Stücke, nach den
Wechselbezie-
hungen zwischen
China und Japan
undanderesmehr
werden bei fort-
schreitender For-
schung schärfer
gelöst oder ge-
stellt werden können — nicht aber wird sich so bald
wieder ein Autor finden, der mit der gleichen Inner-
lichkeit an dem Gegenstande seiner Studien hängt.
Nicht selten sind in dem Buche die Beobachtungen
über gewisse künstlerische Fragen in einer Weise
niedergelegt, die eine lebhaftere Erregtheit des Ver-
fassers nachempfinden läßt; wir stoßen auf Worte
FÜNFTEILIGE MEDIZINDOSE (INRO) MIT
DARSTELLUNO EINES SCHAUSPIELERS
IN GOLDLACK (18. JAHRH.); DER SCHIE-
BER (OJIME) AUS ELFENBEIN; DAS
NETZKE INMANJUFORM AUS GOLDLACK
59
ganze Welt innerer Beziehungen tut sich ihm auf,
und allmählich lernt er den fremden Sinn, die fremde
Schönheit empfinden und bewundern.
Trotzdem Albert Brockhaus seine Sammeltätigkeit
auf die Netzke beschränkte, umspannt er ein Gebiet
so weit und so reich an Gehalt, so mannigfach in
Form und Erscheinung, daß es alle Möglichkeiten künst-
lerischer Darstellungskraft umschließt. So mußte er
in seinem »Versuch einer Geschichte der japanischen
Schnitzkunst« die wichtigsten Gebiete japanischer Bild-
kunst nach Material, Technik und Stil behandeln, und
es ist ihm vortrefflich gelungen, des vielseitigen Stoffes
Herr zu werden. Auf das Anschaulichste werden wir
in die Verwendungsweise der verschiedenen Netzke-
arten eingeweiht, sorgfältig wird geschildert, welche
Materialien bearbeitet werden, dabei sind aus der Praxis
des Sammlers wertvolle Beobachtungen eingeflochten
über die Erhaltung, die Fälschung von Netzkes. Es
folgt eine das Wesentliche betonende Charakteristik
des künstlerischen Ingeniums der Japaner — der Hin-
weis auf die impressionistische Schärfe der Natur-
beobachtung, auf die Kunst abbrevierender Stilisierung,
auf die Virtuosität der Hand, den Humor der Schilde-
rung. Nach diesen einleitenden Bemerkungen werden
die literarischen Quellen für das Studium der Netzke
betrachtet. Es folgt eine geschichtliche Übersicht
über die Netzkekunst in drei Perioden von der Mitte
des 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Sehr
dankenswert ist die kurze Abhandlung über die
Schwierigkeiten, die dem Europäer Schrift und Sprache
der Japaner bereiten. Daran schließt sich eine um-
fängliche, mit größter Sorgfalt gearbeitete Künsller-
liste, ein Verzeichnis der auf Netzkes beobachteten
Schriftzeichen mit Registern und endlich ein genauer
beschreibender Katalog der Sammlung Brockhaus.
Diese Sammlung umfaßt 1170 Nummern. Sie ist
aber nicht nur eine der größten Sammlungen ihrer
Art, sie ist auch eine der besten, die es gibt. In
der Anordnung der Gruppen dieses Katalogs hat sich
der Verfasser von den Motiven der Darstellungen
leiten lassen. Ohne Zweifel hat er damit das prak-
tischste Prinzip der Einteilung gewählt, dasselbe, das
anfänglich auch bei der
Ordnung der japanischen
Schwertstichblätter be-
liebt gewesen ist. Wenn
man neuerdings die chro-
nologische Ordnung der
Tsuba (so z. B. Hayashi)
vorgezogen hat und so-
gar versucht hat, genea-
logische Gruppen einer
Einteilung der Tsuba zu-
grunde zu legen (Jacoby),
so würde das doch bei
den Netzkes nicht nur
wegen der Lückenhaftig-
keit unserer Kenntnisse,
sondern auch deshalb
NETZKE IN FORM E.NER NO- "ntunHch 8»«" S.dH,
maske. holz. i8. jAHRH. weil die verhältnismäßig
jüngere Netzke-
kunst bei weitem
nicht so viel Ge-
schlechter oder
Sippen von
Netzkeschnitzern
aufzuweisen hat
wie beispiels-
weise die Stich-
blattkünstler. So
gruppiert Brock-
haus: Götter,
Heilige,Teufel —
dann chinesische
und japanische
Sagen — dann
bürgerliche Be-
rufe und Ge-
brauchsgegen-
stände, Zoologie
und Botanik,
Masken. In die-
sem willkürlichen
aber praktischen
Umkreise be-
spricht der Ver-
fasser die Netzke,
die er nach ihrem
Gehalt mit einem
Aufwand gründ-
licher Gelehr-
samkeit erklärt.
Aber der wissen-
schaftliche Eifer
allein ist es nicht,
der diesem flei-
ßigen Buche eine
bleibende Stelle
in unserer noch
so schmalen Lite-
ratur über die
Kunst Japans an-
weist. Fragen
nach der Datie-
rung einzelner
Stücke, nach den
Wechselbezie-
hungen zwischen
China und Japan
undanderesmehr
werden bei fort-
schreitender For-
schung schärfer
gelöst oder ge-
stellt werden können — nicht aber wird sich so bald
wieder ein Autor finden, der mit der gleichen Inner-
lichkeit an dem Gegenstande seiner Studien hängt.
Nicht selten sind in dem Buche die Beobachtungen
über gewisse künstlerische Fragen in einer Weise
niedergelegt, die eine lebhaftere Erregtheit des Ver-
fassers nachempfinden läßt; wir stoßen auf Worte
FÜNFTEILIGE MEDIZINDOSE (INRO) MIT
DARSTELLUNO EINES SCHAUSPIELERS
IN GOLDLACK (18. JAHRH.); DER SCHIE-
BER (OJIME) AUS ELFENBEIN; DAS
NETZKE INMANJUFORM AUS GOLDLACK