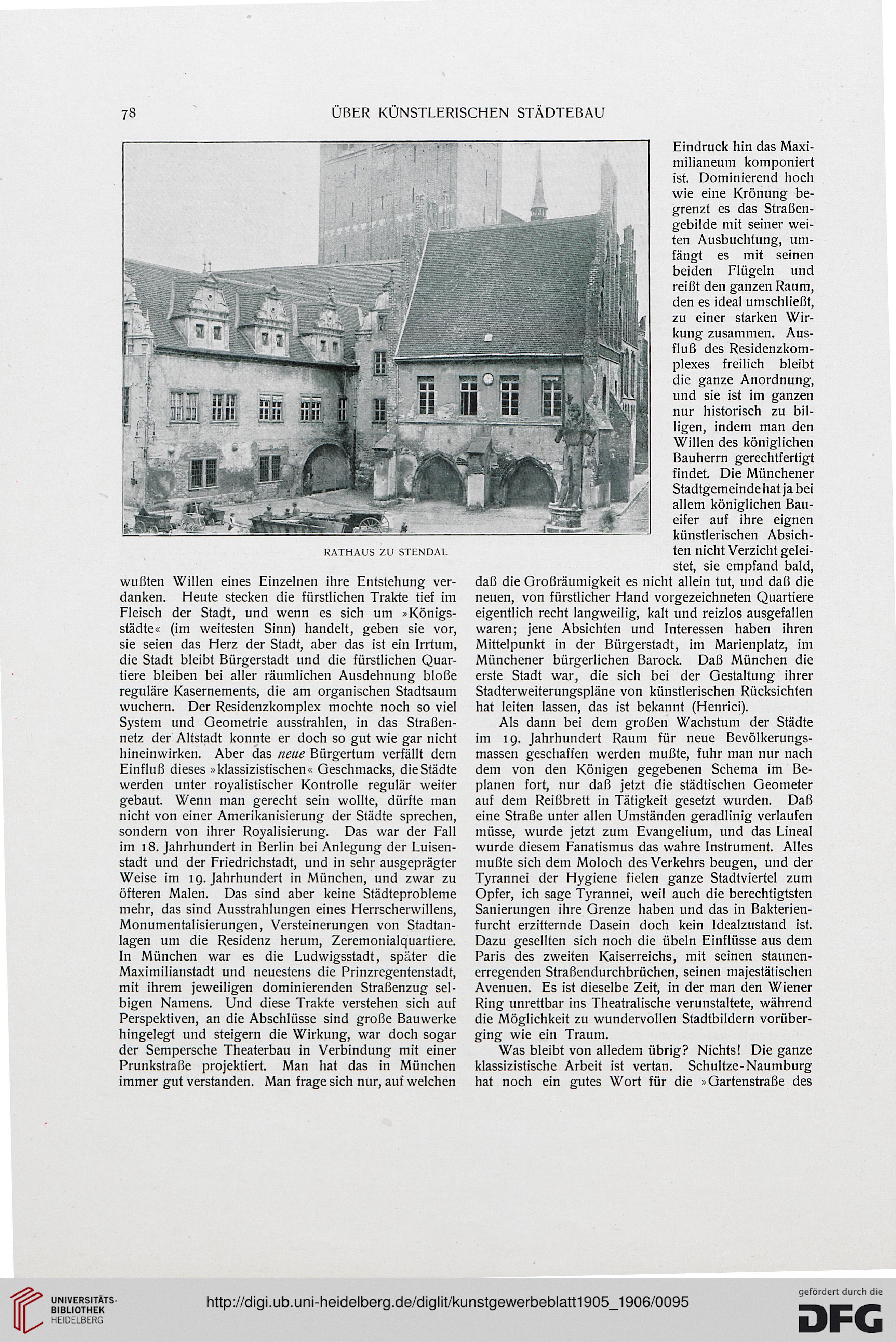78
ÜBER KUNSTLERISCHEN STÄDTEBAU
RATHAUS ZU STENDAL
wußten Willen eines Einzelnen ihre Entstehung ver-
danken. Heute stecken die fürstlichen Trakte tief im
Fleisch der Stadt, und wenn es sich um »Königs-
städte« (im weitesten Sinn) handelt, geben sie vor,
sie seien das Herz der Stadt, aber das ist ein Irrtum,
die Stadt bleibt Bürgerstadt und die fürstlichen Quar-
tiere bleiben bei aller räumlichen Ausdehnung bloße
reguläre Kasernements, die am organischen Stadtsaum
wuchern. Der Residenzkomplex mochte noch so viel
System und Geometrie ausstrahlen, in das Straßen-
netz der Altstadt konnte er doch so gut wie gar nicht
hineinwirken. Aber das neue Bürgertum verfällt dem
Einfluß dieses »klassizistischen« Geschmacks, die Städte
werden unter royalistischer Kontrolle regulär weiter
gebaut. Wenn man gerecht sein wollte, dürfte man
nicht von einer Amerikanisierung der Städte sprechen,
sondern von ihrer Royalisierung. Das war der Fall
im 18. Jahrhundert in Berlin bei Anlegung der Luisen-
stadt und der Friedrichstadt, und in sehr ausgeprägter
Weise im 19. Jahrhundert in München, und zwar zu
öfteren Malen. Das sind aber keine Städteprobleme
mehr, das sind Ausstrahlungen eines Herrscherwillens,
Monumentalisierungen, Versteinerungen von Stadtan-
lagen um die Residenz herum, Zeremonialquartiere.
In München war es die Ludwigsstadt, später die
Maximilianstadt und neuestens die Prinzregentenstadt,
mit ihrem jeweiligen dominierenden Straßenzug sel-
bigen Namens. Und diese Trakte verstehen sich auf
Perspektiven, an die Abschlüsse sind große Bauwerke
hingelegt und steigern die Wirkung, war doch sogar
der Sempersche Theaterbau in Verbindung mit einer
Prunkstraße projektiert. Man hat das in München
immer gut verstanden. Man frage sich nur, auf welchen
Eindruck hin das Maxi-
milianeum komponiert
ist. Dominierend hoch
wie eine Krönung be-
grenzt es das Straßen-
gebilde mit seiner wei-
ten Ausbuchtung, um-
fängt es mit seinen
beiden Flügeln und
reißt den ganzen Raum,
den es ideal umschließt,
zu einer starken Wir-
kung zusammen. Aus-
fluß des Residenzkom-
plexes freilich bleibt
die ganze Anordnung,
und sie ist im ganzen
nur historisch zu bil-
ligen, indem man den
Willen des königlichen
Bauherrn gerechtfertigt
findet. Die Münchener
Stadtgemeindehatjabei
allem königlichen Bau-
eifer auf ihre eignen
künstlerischen Absich-
ten nicht Verzicht gelei-
stet, sie empfand bald,
daß die Großräumigkeit es nicht allein tut, und daß die
neuen, von fürstlicher Hand vorgezeichneten Quartiere
eigentlich recht langweilig, kalt und reizlos ausgefallen
waren; jene Absichten und Interessen haben ihren
Mittelpunkt in der Bürgersfadt, im Marienplatz, im
Münchener bürgerlichen Barock. Daß München die
erste Stadt war, die sich bei der Gestaltung ihrer
Stadterweiterungspläne von künstlerischen Rücksichten
hat leiten lassen, das ist bekannt (Henrici).
Als dann bei dem großen Wachstum der Städte
im 19. Jahrhundert Raum für neue Bevölkerungs-
massen geschaffen werden mußte, fuhr man nur nach
dem von den Königen gegebenen Schema im Be-
planen fort, nur daß jetzt die städtischen Geometer
auf dem Reißbrett in Tätigkeit gesetzt wurden. Daß
eine Straße unter allen Umständen geradlinig verlaufen
müsse, wurde jetzt zum Evangelium, und das Lineal
wurde diesem Fanatismus das wahre Instrument. Alles
mußte sich dem Moloch des Verkehrs beugen, und der
Tyrannei der Hygiene fielen ganze Stadtviertel zum
Opfer, ich sage Tyrannei, weil auch die berechtigtsten
Sanierungen ihre Grenze haben und das in Bakterien-
furcht erzitternde Dasein doch kein Idealzustand ist.
Dazu gesellten sich noch die Übeln Einflüsse aus dem
Paris des zweiten Kaiserreichs, mit seinen staunen-
erregenden Straßendurchbrüchen, seinen majestätischen
Avenuen. Es ist dieselbe Zeit, in der man den Wiener
Ring unrettbar ins Theatralische verunstaltete, während
die Möglichkeit zu wundervollen Stadtbildern vorüber-
ging wie ein Traum.
Was bleibt von alledem übrig? Nichts! Die ganze
klassizistische Arbeit ist vertan. Schultze-Naumburg
hat noch ein gutes Wort für die »Gartenstraße des
ÜBER KUNSTLERISCHEN STÄDTEBAU
RATHAUS ZU STENDAL
wußten Willen eines Einzelnen ihre Entstehung ver-
danken. Heute stecken die fürstlichen Trakte tief im
Fleisch der Stadt, und wenn es sich um »Königs-
städte« (im weitesten Sinn) handelt, geben sie vor,
sie seien das Herz der Stadt, aber das ist ein Irrtum,
die Stadt bleibt Bürgerstadt und die fürstlichen Quar-
tiere bleiben bei aller räumlichen Ausdehnung bloße
reguläre Kasernements, die am organischen Stadtsaum
wuchern. Der Residenzkomplex mochte noch so viel
System und Geometrie ausstrahlen, in das Straßen-
netz der Altstadt konnte er doch so gut wie gar nicht
hineinwirken. Aber das neue Bürgertum verfällt dem
Einfluß dieses »klassizistischen« Geschmacks, die Städte
werden unter royalistischer Kontrolle regulär weiter
gebaut. Wenn man gerecht sein wollte, dürfte man
nicht von einer Amerikanisierung der Städte sprechen,
sondern von ihrer Royalisierung. Das war der Fall
im 18. Jahrhundert in Berlin bei Anlegung der Luisen-
stadt und der Friedrichstadt, und in sehr ausgeprägter
Weise im 19. Jahrhundert in München, und zwar zu
öfteren Malen. Das sind aber keine Städteprobleme
mehr, das sind Ausstrahlungen eines Herrscherwillens,
Monumentalisierungen, Versteinerungen von Stadtan-
lagen um die Residenz herum, Zeremonialquartiere.
In München war es die Ludwigsstadt, später die
Maximilianstadt und neuestens die Prinzregentenstadt,
mit ihrem jeweiligen dominierenden Straßenzug sel-
bigen Namens. Und diese Trakte verstehen sich auf
Perspektiven, an die Abschlüsse sind große Bauwerke
hingelegt und steigern die Wirkung, war doch sogar
der Sempersche Theaterbau in Verbindung mit einer
Prunkstraße projektiert. Man hat das in München
immer gut verstanden. Man frage sich nur, auf welchen
Eindruck hin das Maxi-
milianeum komponiert
ist. Dominierend hoch
wie eine Krönung be-
grenzt es das Straßen-
gebilde mit seiner wei-
ten Ausbuchtung, um-
fängt es mit seinen
beiden Flügeln und
reißt den ganzen Raum,
den es ideal umschließt,
zu einer starken Wir-
kung zusammen. Aus-
fluß des Residenzkom-
plexes freilich bleibt
die ganze Anordnung,
und sie ist im ganzen
nur historisch zu bil-
ligen, indem man den
Willen des königlichen
Bauherrn gerechtfertigt
findet. Die Münchener
Stadtgemeindehatjabei
allem königlichen Bau-
eifer auf ihre eignen
künstlerischen Absich-
ten nicht Verzicht gelei-
stet, sie empfand bald,
daß die Großräumigkeit es nicht allein tut, und daß die
neuen, von fürstlicher Hand vorgezeichneten Quartiere
eigentlich recht langweilig, kalt und reizlos ausgefallen
waren; jene Absichten und Interessen haben ihren
Mittelpunkt in der Bürgersfadt, im Marienplatz, im
Münchener bürgerlichen Barock. Daß München die
erste Stadt war, die sich bei der Gestaltung ihrer
Stadterweiterungspläne von künstlerischen Rücksichten
hat leiten lassen, das ist bekannt (Henrici).
Als dann bei dem großen Wachstum der Städte
im 19. Jahrhundert Raum für neue Bevölkerungs-
massen geschaffen werden mußte, fuhr man nur nach
dem von den Königen gegebenen Schema im Be-
planen fort, nur daß jetzt die städtischen Geometer
auf dem Reißbrett in Tätigkeit gesetzt wurden. Daß
eine Straße unter allen Umständen geradlinig verlaufen
müsse, wurde jetzt zum Evangelium, und das Lineal
wurde diesem Fanatismus das wahre Instrument. Alles
mußte sich dem Moloch des Verkehrs beugen, und der
Tyrannei der Hygiene fielen ganze Stadtviertel zum
Opfer, ich sage Tyrannei, weil auch die berechtigtsten
Sanierungen ihre Grenze haben und das in Bakterien-
furcht erzitternde Dasein doch kein Idealzustand ist.
Dazu gesellten sich noch die Übeln Einflüsse aus dem
Paris des zweiten Kaiserreichs, mit seinen staunen-
erregenden Straßendurchbrüchen, seinen majestätischen
Avenuen. Es ist dieselbe Zeit, in der man den Wiener
Ring unrettbar ins Theatralische verunstaltete, während
die Möglichkeit zu wundervollen Stadtbildern vorüber-
ging wie ein Traum.
Was bleibt von alledem übrig? Nichts! Die ganze
klassizistische Arbeit ist vertan. Schultze-Naumburg
hat noch ein gutes Wort für die »Gartenstraße des