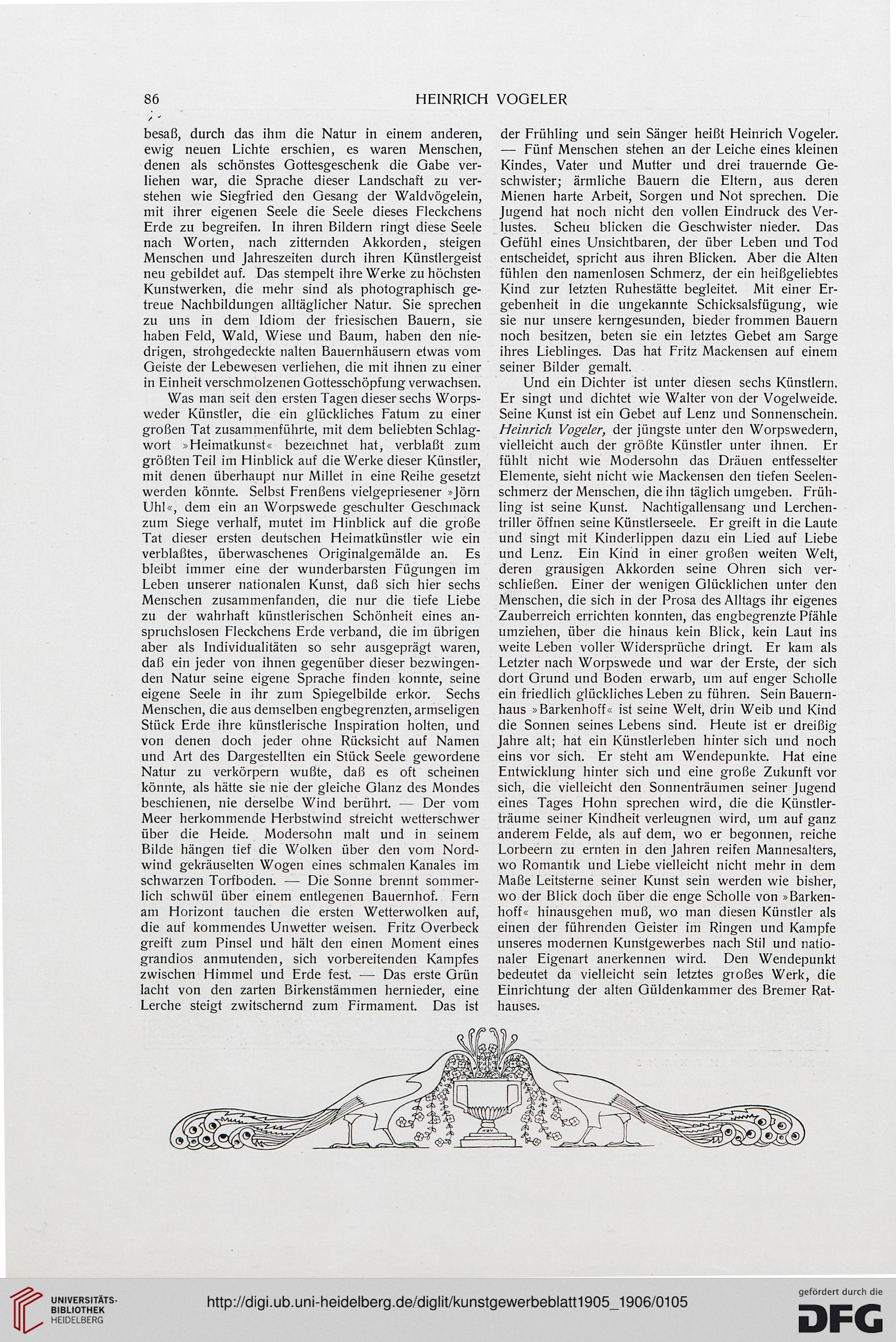86
HEINRICH VOGELER
besaß, durch das ihm die Natur in einem anderen,
ewig neuen Lichte erschien, es waren Menschen,
denen als schönstes Gottesgeschenk die Gabe ver-
liehen war, die Sprache dieser Landschaft zu ver-
stehen wie Siegfried den Gesang der Waldvögelein,
mit ihrer eigenen Seele die Seele dieses Fleckchens
Erde zu begreifen. In ihren Bildern ringt diese Seele
nach Worten, nach zitternden Akkorden, steigen
Menschen und Jahreszeiten durch ihren Künstlergeist
neu gebildet auf. Das stempelt ihre Werke zu höchsten
Kunstwerken, die mehr sind als photographisch ge-
treue Nachbildungen alltäglicher Natur. Sie sprechen
zu uns in dem Idiom der friesischen Bauern, sie
haben Feld, Wald, Wiese und Baum, haben den nie-
drigen, strohgedeckte nahen Bauernhäusern etwas vom
Geiste der Lebewesen verliehen, die mit ihnen zu einer
in Einheit verschmolzenen Gottesschöpfung verwachsen.
Was man seit den ersten Tagen dieser sechs Worps-
weder Künstler, die ein glückliches Fatum zu einer
großen Tat zusammenführte, mit dem beliebten Schlag-
wort »Heimatkunst« bezeichnet hat, verblaßt zum
größten Teil im Hinblick auf die Werke dieser Künstler,
mit denen überhaupt nur Millet in eine Reihe gesetzt
werden könnte. Selbst Frenßens vielgepriesener »Jörn
Uhl«, dem ein an Worpswede geschulter Geschmack
zum Siege verhalf, mutet im Hinblick auf die große
Tat dieser ersten deutschen Heimatkünstler wie ein
verblaßtes, überwaschenes Originalgemälde an. Es
bleibt immer eine der wunderbarsten Fügungen im
Leben unserer nationalen Kunst, daß sich hier sechs
Menschen zusammenfanden, die nur die tiefe Liebe
zu der wahrhaft künstlerischen Schönheit eines an-
spruchslosen Fleckchens Erde verband, die im übrigen
aber als Individualitäten so sehr ausgeprägt waren,
daß ein jeder von ihnen gegenüber dieser bezwingen-
den Natur seine eigene Sprache finden konnte, seine
eigene Seele in ihr zum Spiegelbilde erkor. Sechs
Menschen, die aus demselben engbegrenzten, armseligen
Stück Erde ihre künstlerische Inspiration holten, und
von denen doch jeder ohne Rücksicht auf Namen
und Art des Dargestellten ein Stück Seele gewordene
Natur zu verkörpern wußte, daß es oft scheinen
könnte, als hätte sie nie der gleiche Glanz des Mondes
beschienen, nie derselbe Wind berührt. — Der vom
Meer herkommende Herbstwind streicht wetterschwer
über die Heide. Modersohn malt und in seinem
Bilde hängen tief die Wolken über den vom Nord-
wind gekräuselten Wogen eines schmalen Kanales im
schwarzen Torfboden. — Die Sonne brennt sommer-
lich schwül über einem entlegenen Bauernhof. Fern
am Horizont tauchen die ersten Wetterwolken auf,
die auf kommendes Unwetter weisen. Fritz Overbeck
greift zum Pinsel und hält den einen Moment eines
grandios anmutenden, sich vorbereitenden Kampfes
zwischen Himmel und Erde fest. — Das erste Grün
lacht von den zarten Birkenstämmen hernieder, eine
Lerche steigt zwitschernd zum Firmament. Das ist
der Frühling und sein Sänger heißt Heinrich Vogeler.
— Fünf Menschen stehen an der Leiche eines kleinen
Kindes, Vater und Mutter und drei trauernde Ge-
schwister; ärmliche Bauern die Eltern, aus deren
Mienen harte Arbeit, Sorgen und Not sprechen. Die
Jugend hat noch nicht den vollen Eindruck des Ver-
lustes. Scheu blicken die Geschwister nieder. Das
Gefühl eines Unsichtbaren, der über Leben und Tod
entscheidet, spricht aus ihren Blicken. Aber die Alten
fühlen den namenlosen Schmerz, der ein heißgeliebtes
Kind zur letzten Ruhestätte begleitet. Mit einer Er-
gebenheit in die ungekannte Schicksalsfügung, wie
sie nur unsere kerngesunden, bieder frommen Bauern
noch besitzen, beten sie ein letztes Gebet am Sarge
ihres Lieblinges. Das hat Fritz Mackensen auf einem
seiner Bilder gemalt.
Und ein Dichter ist unter diesen sechs Künstlern.
Er singt und dichtet wie Walter von der Vogelweide.
Seine Kunst ist ein Gebet auf Lenz und Sonnenschein.
Heinrich Vogeler, der jüngste unter den Worpswedern,
vielleicht auch der größte Künstler unter ihnen. Er
fühlt nicht wie Modersohn das Dräuen entfesselter
Elemente, sieht nicht wie Mackensen den tiefen Seelen-
schmerz der Menschen, die ihn täglich umgeben. Früh-
ling ist seine Kunst. Nachtigallensang und Lerchen-
triller öffnen seine Künstlerseele. Er greift in die Laute
und singt mit Kinderlippen dazu ein Lied auf Liebe
und Lenz. Ein Kind in einer großen weiten Welt,
deren grausigen Akkorden seine Ohren sich ver-
schließen. Einer der wenigen Glücklichen unter den
Menschen, die sich in der Prosa des Alltags ihr eigenes
Zauberreich errichten konnten, das engbegrenzte Pfähle
umziehen, über die hinaus kein Blick, kein Laut ins
weite Leben voller Widersprüche dringt. Er kam als
Letzter nach Worpswede und war der Erste, der sich
dort Grund und Boden erwarb, um auf enger Scholle
ein friedlich glückliches Leben zu führen. Sein Bauern-
haus »Barkenhoff« ist seine Welt, drin Weib und Kind
die Sonnen seines Lebens sind. Heute ist er dreißig
Jahre alt; hat ein Künstlerleben hinter sich und noch
eins vor sich. Er steht am Wendepunkte. Hat eine
Entwicklung hinter sich und eine große Zukunft vor
sich, die vielleicht den Sonnenträumen seiner Jugend
eines Tages Hohn sprechen wird, die die Künstler-
träume seiner Kindheit verleugnen wird, um auf ganz
anderem Felde, als auf dem, wo er begonnen, reiche
Lorbeern zu ernten in den Jahren reifen Mannesalters,
wo Romantik und Liebe vielleicht nicht mehr in dem
Maße Leitsterne seiner Kunst sein werden wie bisher,
wo der Blick doch über die enge Scholle von »Barken-
hoff« hinausgehen muß, wo man diesen Künstler als
einen der führenden Geister im Ringen und Kampfe
unseres modernen Kunstgewerbes nach Stil und natio-
naler Eigenart anerkennen wird. Den Wendepunkt
bedeutet da vielleicht sein letztes großes Werk, die
Einrichtung der alten Güldenkammer des Bremer Rat-
hauses.
HEINRICH VOGELER
besaß, durch das ihm die Natur in einem anderen,
ewig neuen Lichte erschien, es waren Menschen,
denen als schönstes Gottesgeschenk die Gabe ver-
liehen war, die Sprache dieser Landschaft zu ver-
stehen wie Siegfried den Gesang der Waldvögelein,
mit ihrer eigenen Seele die Seele dieses Fleckchens
Erde zu begreifen. In ihren Bildern ringt diese Seele
nach Worten, nach zitternden Akkorden, steigen
Menschen und Jahreszeiten durch ihren Künstlergeist
neu gebildet auf. Das stempelt ihre Werke zu höchsten
Kunstwerken, die mehr sind als photographisch ge-
treue Nachbildungen alltäglicher Natur. Sie sprechen
zu uns in dem Idiom der friesischen Bauern, sie
haben Feld, Wald, Wiese und Baum, haben den nie-
drigen, strohgedeckte nahen Bauernhäusern etwas vom
Geiste der Lebewesen verliehen, die mit ihnen zu einer
in Einheit verschmolzenen Gottesschöpfung verwachsen.
Was man seit den ersten Tagen dieser sechs Worps-
weder Künstler, die ein glückliches Fatum zu einer
großen Tat zusammenführte, mit dem beliebten Schlag-
wort »Heimatkunst« bezeichnet hat, verblaßt zum
größten Teil im Hinblick auf die Werke dieser Künstler,
mit denen überhaupt nur Millet in eine Reihe gesetzt
werden könnte. Selbst Frenßens vielgepriesener »Jörn
Uhl«, dem ein an Worpswede geschulter Geschmack
zum Siege verhalf, mutet im Hinblick auf die große
Tat dieser ersten deutschen Heimatkünstler wie ein
verblaßtes, überwaschenes Originalgemälde an. Es
bleibt immer eine der wunderbarsten Fügungen im
Leben unserer nationalen Kunst, daß sich hier sechs
Menschen zusammenfanden, die nur die tiefe Liebe
zu der wahrhaft künstlerischen Schönheit eines an-
spruchslosen Fleckchens Erde verband, die im übrigen
aber als Individualitäten so sehr ausgeprägt waren,
daß ein jeder von ihnen gegenüber dieser bezwingen-
den Natur seine eigene Sprache finden konnte, seine
eigene Seele in ihr zum Spiegelbilde erkor. Sechs
Menschen, die aus demselben engbegrenzten, armseligen
Stück Erde ihre künstlerische Inspiration holten, und
von denen doch jeder ohne Rücksicht auf Namen
und Art des Dargestellten ein Stück Seele gewordene
Natur zu verkörpern wußte, daß es oft scheinen
könnte, als hätte sie nie der gleiche Glanz des Mondes
beschienen, nie derselbe Wind berührt. — Der vom
Meer herkommende Herbstwind streicht wetterschwer
über die Heide. Modersohn malt und in seinem
Bilde hängen tief die Wolken über den vom Nord-
wind gekräuselten Wogen eines schmalen Kanales im
schwarzen Torfboden. — Die Sonne brennt sommer-
lich schwül über einem entlegenen Bauernhof. Fern
am Horizont tauchen die ersten Wetterwolken auf,
die auf kommendes Unwetter weisen. Fritz Overbeck
greift zum Pinsel und hält den einen Moment eines
grandios anmutenden, sich vorbereitenden Kampfes
zwischen Himmel und Erde fest. — Das erste Grün
lacht von den zarten Birkenstämmen hernieder, eine
Lerche steigt zwitschernd zum Firmament. Das ist
der Frühling und sein Sänger heißt Heinrich Vogeler.
— Fünf Menschen stehen an der Leiche eines kleinen
Kindes, Vater und Mutter und drei trauernde Ge-
schwister; ärmliche Bauern die Eltern, aus deren
Mienen harte Arbeit, Sorgen und Not sprechen. Die
Jugend hat noch nicht den vollen Eindruck des Ver-
lustes. Scheu blicken die Geschwister nieder. Das
Gefühl eines Unsichtbaren, der über Leben und Tod
entscheidet, spricht aus ihren Blicken. Aber die Alten
fühlen den namenlosen Schmerz, der ein heißgeliebtes
Kind zur letzten Ruhestätte begleitet. Mit einer Er-
gebenheit in die ungekannte Schicksalsfügung, wie
sie nur unsere kerngesunden, bieder frommen Bauern
noch besitzen, beten sie ein letztes Gebet am Sarge
ihres Lieblinges. Das hat Fritz Mackensen auf einem
seiner Bilder gemalt.
Und ein Dichter ist unter diesen sechs Künstlern.
Er singt und dichtet wie Walter von der Vogelweide.
Seine Kunst ist ein Gebet auf Lenz und Sonnenschein.
Heinrich Vogeler, der jüngste unter den Worpswedern,
vielleicht auch der größte Künstler unter ihnen. Er
fühlt nicht wie Modersohn das Dräuen entfesselter
Elemente, sieht nicht wie Mackensen den tiefen Seelen-
schmerz der Menschen, die ihn täglich umgeben. Früh-
ling ist seine Kunst. Nachtigallensang und Lerchen-
triller öffnen seine Künstlerseele. Er greift in die Laute
und singt mit Kinderlippen dazu ein Lied auf Liebe
und Lenz. Ein Kind in einer großen weiten Welt,
deren grausigen Akkorden seine Ohren sich ver-
schließen. Einer der wenigen Glücklichen unter den
Menschen, die sich in der Prosa des Alltags ihr eigenes
Zauberreich errichten konnten, das engbegrenzte Pfähle
umziehen, über die hinaus kein Blick, kein Laut ins
weite Leben voller Widersprüche dringt. Er kam als
Letzter nach Worpswede und war der Erste, der sich
dort Grund und Boden erwarb, um auf enger Scholle
ein friedlich glückliches Leben zu führen. Sein Bauern-
haus »Barkenhoff« ist seine Welt, drin Weib und Kind
die Sonnen seines Lebens sind. Heute ist er dreißig
Jahre alt; hat ein Künstlerleben hinter sich und noch
eins vor sich. Er steht am Wendepunkte. Hat eine
Entwicklung hinter sich und eine große Zukunft vor
sich, die vielleicht den Sonnenträumen seiner Jugend
eines Tages Hohn sprechen wird, die die Künstler-
träume seiner Kindheit verleugnen wird, um auf ganz
anderem Felde, als auf dem, wo er begonnen, reiche
Lorbeern zu ernten in den Jahren reifen Mannesalters,
wo Romantik und Liebe vielleicht nicht mehr in dem
Maße Leitsterne seiner Kunst sein werden wie bisher,
wo der Blick doch über die enge Scholle von »Barken-
hoff« hinausgehen muß, wo man diesen Künstler als
einen der führenden Geister im Ringen und Kampfe
unseres modernen Kunstgewerbes nach Stil und natio-
naler Eigenart anerkennen wird. Den Wendepunkt
bedeutet da vielleicht sein letztes großes Werk, die
Einrichtung der alten Güldenkammer des Bremer Rat-
hauses.