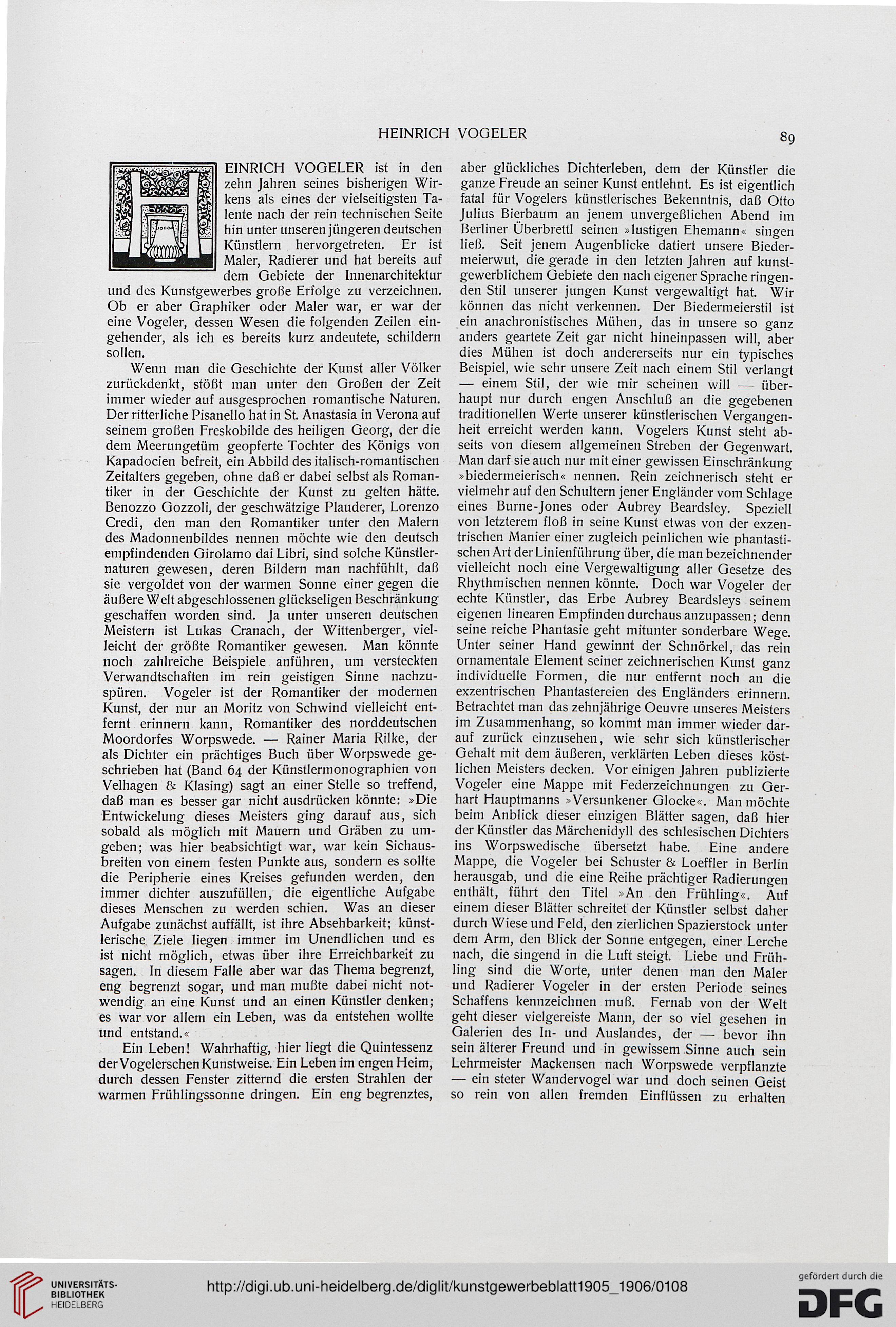HEINRICH VOQELER
89
EINRICH VOGELER ist in den
zehn Jahren seines bisherigen Wir-
kens als eines der vielseitigsten Ta-
lente nach der rein technischen Seite
hin unter unseren jüngeren deutschen
Künstlern hervorgetreten. Er ist
Maler, Radierer und hat bereits auf
dem Gebiete der Innenarchitektur
und des Kunstgewerbes große Erfolge zu verzeichnen.
Ob er aber Graphiker oder Maler war, er war der
eine Vogeler, dessen Wesen die folgenden Zeilen ein-
gehender, als ich es bereits kurz andeutete, schildern
sollen.
Wenn man die Geschichte der Kunst aller Völker
zurückdenkt, stößt man unter den Großen der Zeit
immer wieder auf ausgesprochen romantische Naturen.
Der ritterliche Pisanello hat in St. Anastasia in Verona auf
seinem großen Freskobilde des heiligen Georg, der die
dem Meerungetüm geopferte Tochter des Königs von
Kapadocien befreit, ein Abbild des italisch-romantischen
Zeitalters gegeben, ohne daß er dabei selbst als Roman-
tiker in der Geschichte der Kunst zu gelten hätte.
Benozzo Gozzoli, der geschwätzige Plauderer, Lorenzo
Credi, den man den Romantiker unter den Malern
des Madonnenbildes nennen möchte wie den deutsch
empfindenden Girolamo dai Libri, sind solche Künstler-
naturen gewesen, deren Bildern man nachfühlt, daß
sie vergoldet von der warmen Sonne einer gegen die
äußere Welt abgeschlossenen glückseligen Beschränkung
geschaffen worden sind. Ja unter unseren deutschen
Meistern ist Lukas Cranach, der Wittenberger, viel-
leicht der größte Romantiker gewesen. Man könnte
noch zahlreiche Beispiele anführen, um versteckten
Verwandtschaften im rein geistigen Sinne nachzu-
spüren. Vogeler ist der Romantiker der modernen
Kunst, der nur an Moritz von Schwind vielleicht ent-
fernt erinnern kann, Romantiker des norddeutschen
Moordorfes Worpswede. — Rainer Maria Rilke, der
als Dichter ein prächtiges Buch über Worpswede ge-
schrieben hat (Band 64 der Künstlermonographien von
Velhagen & Klasing) sagt an einer Stelle so treffend,
daß man es besser gar nicht ausdrücken könnte: »Die
Entwickelung dieses Meisters ging darauf aus, sich
sobald als möglich mit Mauern und Gräben zu um-
geben; was hier beabsichtigt war, war kein Sichaus-
breiten von einem festen Punkte aus, sondern es sollte
die Peripherie eines Kreises gefunden werden, den
immer dichter auszufüllen, die eigentliche Aufgabe
dieses Menschen zu werden schien. Was an dieser
Aufgabe zunächst auffällt, ist ihre Absehbarkeit; künst-
lerische Ziele liegen immer im Unendlichen und es
ist nicht möglich, etwas über ihre Erreichbarkeit zu
sagen. In diesem Falle aber war das Thema begrenzt,
eng begrenzt sogar, und man mußte dabei nicht not-
wendig an eine Kunst und an einen Künstler denken;
es war vor allem ein Leben, was da entstehen wollte
und entstand.«
Ein Leben! Wahrhaftig, hier liegt die Quintessenz
der Vogelerschen Kunstweise. Ein Leben im engen Heim,
durch dessen Fenster zitternd die ersten Strahlen der
warmen Frühlingssorme dringen. Ein eng begrenztes,
aber glückliches Dichterleben, dem der Künstler die
ganze Freude an seiner Kunst entlehnt. Es ist eigentlich
fatal für Vogelers künstlerisches Bekenntnis, daß Ofto
Julius Bierbaum an jenem unvergeßlichen Abend im
Berliner Überbrettl seinen »lustigen Ehemann« singen
ließ. Seit jenem Augenblicke datiert unsere Bieder-
meierwut, die gerade in den letzten Jahren auf kunst-
gewerblichem Gebiete den nach eigener Sprache ringen-
den Stil unserer jungen Kunst vergewaltigt hat. Wir
können das nicht verkennen. Der Biedermeierstil ist
ein anachronistisches Mühen, das in unsere so ganz
anders geartete Zeit gar nicht hineinpassen will, aber
dies Mühen ist doch andererseits nur ein typisches
Beispiel, wie sehr unsere Zeit nach einem Stil verlangt
— einem Stil, der wie mir scheinen will — über-
haupt nur durch engen Anschluß an die gegebenen
traditionellen Werte unserer künstlerischen Vergangen-
heit erreicht werden kann. Vogelers Kunst steht ab-
seits von diesem allgemeinen Streben der Gegenwart.
Man darf sie auch nur mit einer gewissen Einschränkung
»biedermeierisch« nennen. Rein zeichnerisch steht er
vielmehr auf den Schultern jener Engländer vom Schlage
eines Burne-Jones oder Aubrey Beardsley. Speziell
von letzterem floß in seine Kunst etwas von der exzen-
trischen Manier einer zugleich peinlichen wie phantasti-
schen Art der Linienführung über, die man bezeichnender
vielleicht noch eine Vergewaltigung aller Gesetze des
Rhythmischen nennen könnte. Doch war Vogeler der
echte Künstler, das Erbe Aubrey Beardsleys seinem
eigenen linearen Empfinden durchaus anzupassen; denn
seine reiche Phantasie geht mitunter sonderbare Wege.
Unter seiner Hand gewinnt der Schnörkel, das rein
ornamentale Element seiner zeichnerischen Kunst ganz
individuelle Formen, die nur entfernt noch an die
exzentrischen Phantastereien des Engländers erinnern.
Betrachtet man das zehnjährige Oeuvre unseres Meisters
im Zusammenhang, so kommt man immer wieder dar-
auf zurück einzusehen, wie sehr sich künstlerischer
Gehalt mit dem äußeren, verklärten Leben dieses köst-
lichen Meisters decken. Vor einigen Jahren publizierte
Vogeler eine Mappe mit Federzeichnungen zu Ger-
hart Hauptmanns »Versunkener Glocke«. Man möchte
beim Anblick dieser einzigen Blätter sagen, daß hier
der Künstler das Märchenidyll des schlesischen Dichters
ins Worpswedische übersetzt habe. Eine andere
Mappe, die Vogeler bei Schuster & Loeffler in Berlin
herausgab, und die eine Reihe prächtiger Radierungen
enthält, führt den Titel »An den Frühling«. Auf
einem dieser Blätter schreitet der Künstler selbst daher
durch Wiese und Feld, den zierlichen Spazierstock unter
dem Arm, den Blick der Sonne entgegen, einer Lerche
nach, die singend in die Luft steigt. Liebe und Früh-
ling sind die Worte, unter denen man den Maler
und Radierer Vogeler in der ersten Periode seines
Schaffens kennzeichnen muß. Fernab von der Welt
geht dieser vielgereiste Mann, der so viel gesehen in
Galerien des In- und Auslandes, der — bevor ihn
sein älterer Freund und in gewissem Sinne auch sein
Lehrmeister Mackensen nach Worpswede verpflanzte
— ein steter Wandervogel war und doch seinen Geist
so rein von allen fremden Einflüssen zu erhalten
89
EINRICH VOGELER ist in den
zehn Jahren seines bisherigen Wir-
kens als eines der vielseitigsten Ta-
lente nach der rein technischen Seite
hin unter unseren jüngeren deutschen
Künstlern hervorgetreten. Er ist
Maler, Radierer und hat bereits auf
dem Gebiete der Innenarchitektur
und des Kunstgewerbes große Erfolge zu verzeichnen.
Ob er aber Graphiker oder Maler war, er war der
eine Vogeler, dessen Wesen die folgenden Zeilen ein-
gehender, als ich es bereits kurz andeutete, schildern
sollen.
Wenn man die Geschichte der Kunst aller Völker
zurückdenkt, stößt man unter den Großen der Zeit
immer wieder auf ausgesprochen romantische Naturen.
Der ritterliche Pisanello hat in St. Anastasia in Verona auf
seinem großen Freskobilde des heiligen Georg, der die
dem Meerungetüm geopferte Tochter des Königs von
Kapadocien befreit, ein Abbild des italisch-romantischen
Zeitalters gegeben, ohne daß er dabei selbst als Roman-
tiker in der Geschichte der Kunst zu gelten hätte.
Benozzo Gozzoli, der geschwätzige Plauderer, Lorenzo
Credi, den man den Romantiker unter den Malern
des Madonnenbildes nennen möchte wie den deutsch
empfindenden Girolamo dai Libri, sind solche Künstler-
naturen gewesen, deren Bildern man nachfühlt, daß
sie vergoldet von der warmen Sonne einer gegen die
äußere Welt abgeschlossenen glückseligen Beschränkung
geschaffen worden sind. Ja unter unseren deutschen
Meistern ist Lukas Cranach, der Wittenberger, viel-
leicht der größte Romantiker gewesen. Man könnte
noch zahlreiche Beispiele anführen, um versteckten
Verwandtschaften im rein geistigen Sinne nachzu-
spüren. Vogeler ist der Romantiker der modernen
Kunst, der nur an Moritz von Schwind vielleicht ent-
fernt erinnern kann, Romantiker des norddeutschen
Moordorfes Worpswede. — Rainer Maria Rilke, der
als Dichter ein prächtiges Buch über Worpswede ge-
schrieben hat (Band 64 der Künstlermonographien von
Velhagen & Klasing) sagt an einer Stelle so treffend,
daß man es besser gar nicht ausdrücken könnte: »Die
Entwickelung dieses Meisters ging darauf aus, sich
sobald als möglich mit Mauern und Gräben zu um-
geben; was hier beabsichtigt war, war kein Sichaus-
breiten von einem festen Punkte aus, sondern es sollte
die Peripherie eines Kreises gefunden werden, den
immer dichter auszufüllen, die eigentliche Aufgabe
dieses Menschen zu werden schien. Was an dieser
Aufgabe zunächst auffällt, ist ihre Absehbarkeit; künst-
lerische Ziele liegen immer im Unendlichen und es
ist nicht möglich, etwas über ihre Erreichbarkeit zu
sagen. In diesem Falle aber war das Thema begrenzt,
eng begrenzt sogar, und man mußte dabei nicht not-
wendig an eine Kunst und an einen Künstler denken;
es war vor allem ein Leben, was da entstehen wollte
und entstand.«
Ein Leben! Wahrhaftig, hier liegt die Quintessenz
der Vogelerschen Kunstweise. Ein Leben im engen Heim,
durch dessen Fenster zitternd die ersten Strahlen der
warmen Frühlingssorme dringen. Ein eng begrenztes,
aber glückliches Dichterleben, dem der Künstler die
ganze Freude an seiner Kunst entlehnt. Es ist eigentlich
fatal für Vogelers künstlerisches Bekenntnis, daß Ofto
Julius Bierbaum an jenem unvergeßlichen Abend im
Berliner Überbrettl seinen »lustigen Ehemann« singen
ließ. Seit jenem Augenblicke datiert unsere Bieder-
meierwut, die gerade in den letzten Jahren auf kunst-
gewerblichem Gebiete den nach eigener Sprache ringen-
den Stil unserer jungen Kunst vergewaltigt hat. Wir
können das nicht verkennen. Der Biedermeierstil ist
ein anachronistisches Mühen, das in unsere so ganz
anders geartete Zeit gar nicht hineinpassen will, aber
dies Mühen ist doch andererseits nur ein typisches
Beispiel, wie sehr unsere Zeit nach einem Stil verlangt
— einem Stil, der wie mir scheinen will — über-
haupt nur durch engen Anschluß an die gegebenen
traditionellen Werte unserer künstlerischen Vergangen-
heit erreicht werden kann. Vogelers Kunst steht ab-
seits von diesem allgemeinen Streben der Gegenwart.
Man darf sie auch nur mit einer gewissen Einschränkung
»biedermeierisch« nennen. Rein zeichnerisch steht er
vielmehr auf den Schultern jener Engländer vom Schlage
eines Burne-Jones oder Aubrey Beardsley. Speziell
von letzterem floß in seine Kunst etwas von der exzen-
trischen Manier einer zugleich peinlichen wie phantasti-
schen Art der Linienführung über, die man bezeichnender
vielleicht noch eine Vergewaltigung aller Gesetze des
Rhythmischen nennen könnte. Doch war Vogeler der
echte Künstler, das Erbe Aubrey Beardsleys seinem
eigenen linearen Empfinden durchaus anzupassen; denn
seine reiche Phantasie geht mitunter sonderbare Wege.
Unter seiner Hand gewinnt der Schnörkel, das rein
ornamentale Element seiner zeichnerischen Kunst ganz
individuelle Formen, die nur entfernt noch an die
exzentrischen Phantastereien des Engländers erinnern.
Betrachtet man das zehnjährige Oeuvre unseres Meisters
im Zusammenhang, so kommt man immer wieder dar-
auf zurück einzusehen, wie sehr sich künstlerischer
Gehalt mit dem äußeren, verklärten Leben dieses köst-
lichen Meisters decken. Vor einigen Jahren publizierte
Vogeler eine Mappe mit Federzeichnungen zu Ger-
hart Hauptmanns »Versunkener Glocke«. Man möchte
beim Anblick dieser einzigen Blätter sagen, daß hier
der Künstler das Märchenidyll des schlesischen Dichters
ins Worpswedische übersetzt habe. Eine andere
Mappe, die Vogeler bei Schuster & Loeffler in Berlin
herausgab, und die eine Reihe prächtiger Radierungen
enthält, führt den Titel »An den Frühling«. Auf
einem dieser Blätter schreitet der Künstler selbst daher
durch Wiese und Feld, den zierlichen Spazierstock unter
dem Arm, den Blick der Sonne entgegen, einer Lerche
nach, die singend in die Luft steigt. Liebe und Früh-
ling sind die Worte, unter denen man den Maler
und Radierer Vogeler in der ersten Periode seines
Schaffens kennzeichnen muß. Fernab von der Welt
geht dieser vielgereiste Mann, der so viel gesehen in
Galerien des In- und Auslandes, der — bevor ihn
sein älterer Freund und in gewissem Sinne auch sein
Lehrmeister Mackensen nach Worpswede verpflanzte
— ein steter Wandervogel war und doch seinen Geist
so rein von allen fremden Einflüssen zu erhalten