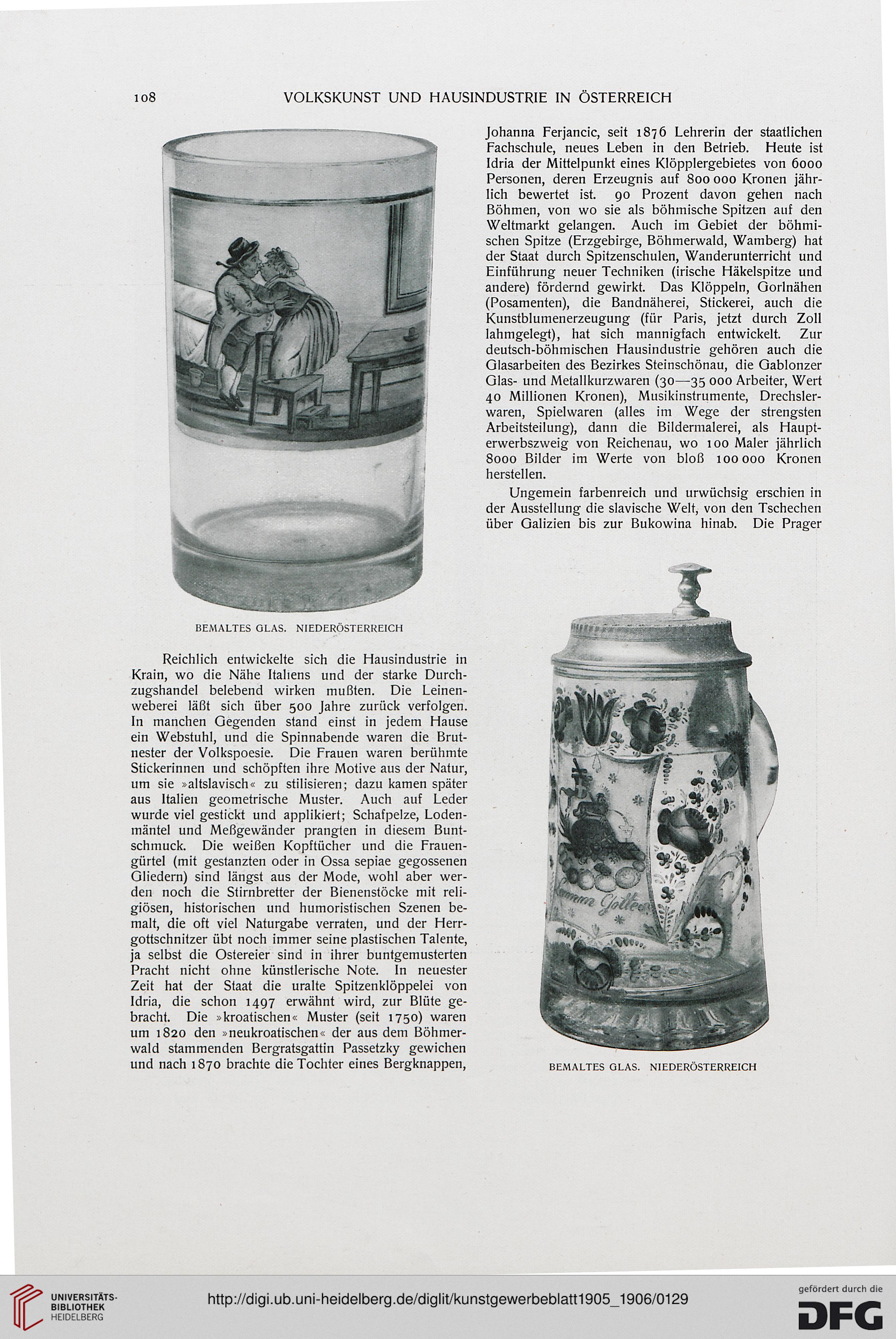io8
VOLKSKUNST UND HAUSINDUSTRIE IN ÖSTERREICH
BEMALTES GLAS. NIEDERÖSTERREICH
Reichlich entwickelte sich die Hausindustrie in
Krain, wo die Nähe Italiens und der starke Durch-
zugshandel belebend wirken mußten. Die Leinen-
weberei läßt sich über 500 Jahre zurück verfolgen.
In manchen Gegenden stand einst in jedem Hause
ein Webstuhl, und die Spinnabende waren die Brut-
nester der Volkspoesie. Die Frauen waren berühmte
Stickerinnen und schöpften ihre Motive aus der Natur,
um sie »altslavisch« zu stilisieren; dazu kamen später
aus Italien geometrische Muster. Auch auf Leder
wurde viel gestickt und applikiert; Schafpelze, Loden-
mäntel und Meßgewänder prangten in diesem Bunt-
schmuck. Die weißen Kopftücher und die Frauen-
gürtel (mit gestanzten oder in Ossa sepiae gegossenen
Gliedern) sind längst aus der Mode, wohl aber wer-
den noch die Stirnbretter der Bienenstöcke mit reli-
giösen, historischen und humoristischen Szenen be-
malt, die oft viel Naturgabe verraten, und der Herr-
gottschnifzer übt noch immer seine plastischen Talente,
ja selbst die Ostereier sind in ihrer buntgemusterten
Pracht nicht ohne künstlerische Note. In neuester
Zeit hat der Staat die uralte Spitzenklöppelei von
Idria, die schon 1497 erwähnt wird, zur Blüte ge-
bracht. Die »kroatischen« Muster (seit 1750) waren
um 1820 den »neukroatischen« der aus dem Böhmer-
wald stammenden Bergratsgattin Passetzky gewichen
und nach 1870 brachte die Tochter eines Bergknappen,
Johanna Ferjancic, seit 1876 Lehrerin der staatlichen
Fachschule, neues Leben in den Betrieb. Heute ist
Idria der Mittelpunkt eines Klöpplergebietes von 6000
Personen, deren Erzeugnis auf 800 000 Kronen jähr-
lich bewertet ist. 90 Prozent davon gehen nach
Böhmen, von wo sie als böhmische Spitzen auf den
Weltmarkt gelangen. Auch im Gebiet der böhmi-
schen Spitze (Erzgebirge, Böhmerwald, Wamberg) hat
der Staat durch Spitzenschulen, Wanderunterricht und
Einführung neuer Techniken (irische Häkelspitze und
andere) fördernd gewirkt. Das Klöppeln, Gorlnähen
(Posamenten), die Bandnäherei, Stickerei, auch die
Kunstblumenerzeugung (für Paris, jetzt durch Zoll
lahmgelegt), hat sich mannigfach entwickelt. Zur
deutsch-böhmischen Hausindustrie gehören auch die
Glasarbeiten des Bezirkes Steinschönau, die Gablonzer
Glas- und Metall kurz waren (30—35 000 Arbeiter, Wert
40 Millionen Kronen), Musikinstrumente, Drechsler-
waren, Spielwaren (alles im Wege der strengsten
Arbeitsteilung), dann die Bildermalerei, als Haupt-
erwerbszweig von Reichenau, wo 100 Maler jährlich
8000 Bilder im Werte von bloß 100000 Kronen
herstellen.
Ungemein farbenreich und urwüchsig erschien in
der Ausstellung die slavische Welt, von den Tschechen
über Galizien bis zur Bukowina hinab. Die Prager
BEMALTES GLAS. NIEDEROSTERREICH
VOLKSKUNST UND HAUSINDUSTRIE IN ÖSTERREICH
BEMALTES GLAS. NIEDERÖSTERREICH
Reichlich entwickelte sich die Hausindustrie in
Krain, wo die Nähe Italiens und der starke Durch-
zugshandel belebend wirken mußten. Die Leinen-
weberei läßt sich über 500 Jahre zurück verfolgen.
In manchen Gegenden stand einst in jedem Hause
ein Webstuhl, und die Spinnabende waren die Brut-
nester der Volkspoesie. Die Frauen waren berühmte
Stickerinnen und schöpften ihre Motive aus der Natur,
um sie »altslavisch« zu stilisieren; dazu kamen später
aus Italien geometrische Muster. Auch auf Leder
wurde viel gestickt und applikiert; Schafpelze, Loden-
mäntel und Meßgewänder prangten in diesem Bunt-
schmuck. Die weißen Kopftücher und die Frauen-
gürtel (mit gestanzten oder in Ossa sepiae gegossenen
Gliedern) sind längst aus der Mode, wohl aber wer-
den noch die Stirnbretter der Bienenstöcke mit reli-
giösen, historischen und humoristischen Szenen be-
malt, die oft viel Naturgabe verraten, und der Herr-
gottschnifzer übt noch immer seine plastischen Talente,
ja selbst die Ostereier sind in ihrer buntgemusterten
Pracht nicht ohne künstlerische Note. In neuester
Zeit hat der Staat die uralte Spitzenklöppelei von
Idria, die schon 1497 erwähnt wird, zur Blüte ge-
bracht. Die »kroatischen« Muster (seit 1750) waren
um 1820 den »neukroatischen« der aus dem Böhmer-
wald stammenden Bergratsgattin Passetzky gewichen
und nach 1870 brachte die Tochter eines Bergknappen,
Johanna Ferjancic, seit 1876 Lehrerin der staatlichen
Fachschule, neues Leben in den Betrieb. Heute ist
Idria der Mittelpunkt eines Klöpplergebietes von 6000
Personen, deren Erzeugnis auf 800 000 Kronen jähr-
lich bewertet ist. 90 Prozent davon gehen nach
Böhmen, von wo sie als böhmische Spitzen auf den
Weltmarkt gelangen. Auch im Gebiet der böhmi-
schen Spitze (Erzgebirge, Böhmerwald, Wamberg) hat
der Staat durch Spitzenschulen, Wanderunterricht und
Einführung neuer Techniken (irische Häkelspitze und
andere) fördernd gewirkt. Das Klöppeln, Gorlnähen
(Posamenten), die Bandnäherei, Stickerei, auch die
Kunstblumenerzeugung (für Paris, jetzt durch Zoll
lahmgelegt), hat sich mannigfach entwickelt. Zur
deutsch-böhmischen Hausindustrie gehören auch die
Glasarbeiten des Bezirkes Steinschönau, die Gablonzer
Glas- und Metall kurz waren (30—35 000 Arbeiter, Wert
40 Millionen Kronen), Musikinstrumente, Drechsler-
waren, Spielwaren (alles im Wege der strengsten
Arbeitsteilung), dann die Bildermalerei, als Haupt-
erwerbszweig von Reichenau, wo 100 Maler jährlich
8000 Bilder im Werte von bloß 100000 Kronen
herstellen.
Ungemein farbenreich und urwüchsig erschien in
der Ausstellung die slavische Welt, von den Tschechen
über Galizien bis zur Bukowina hinab. Die Prager
BEMALTES GLAS. NIEDEROSTERREICH