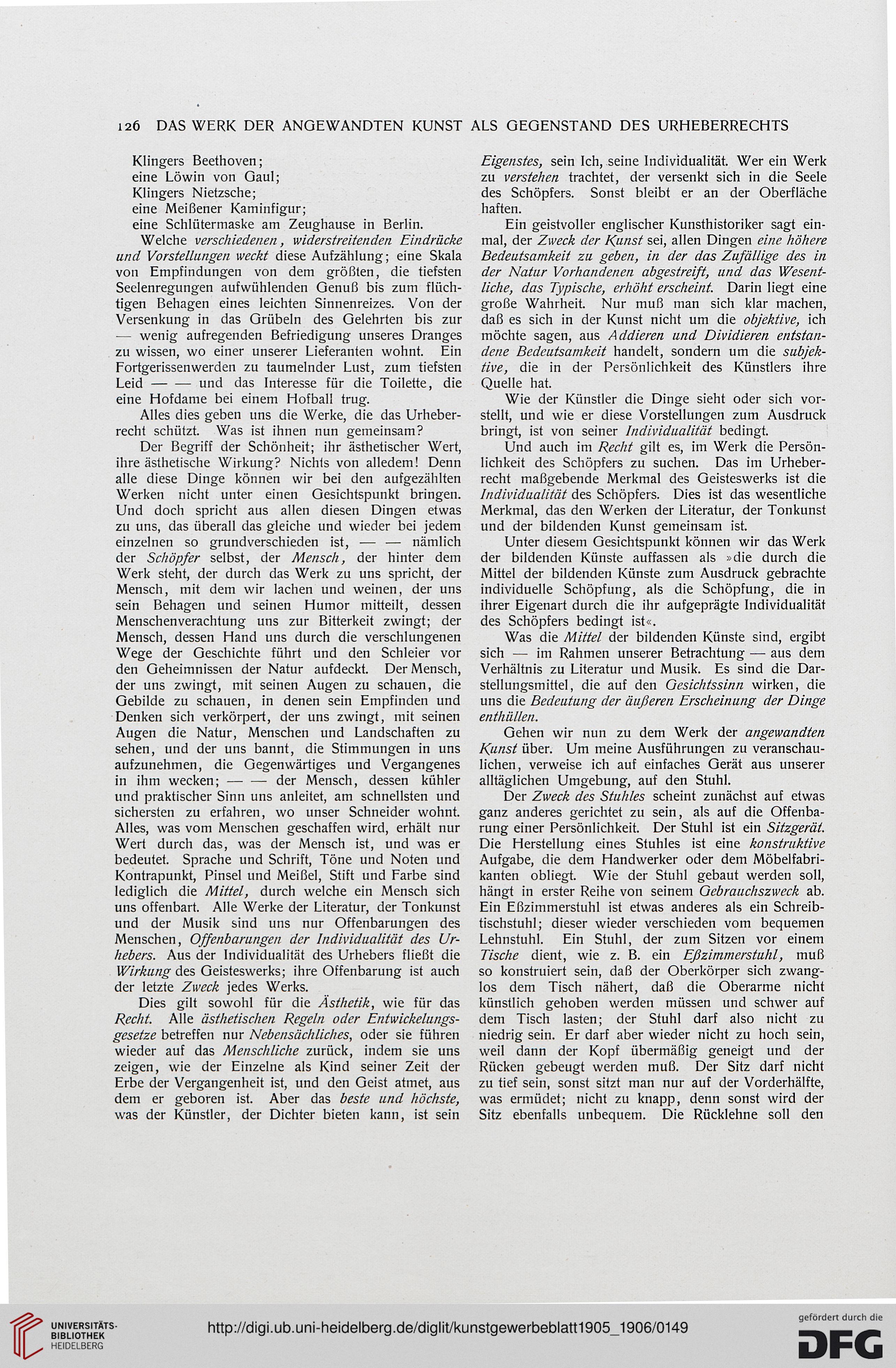126 DAS WERK DER ANGEWANDTEN KUNST ALS GEGENSTAND DES URHEBERRECHTS
Klingers Beethoven;
eine Löwin von Gaul;
Klingers Nietzsche;
eine Meißener Kaminfigur;
eine Schlütermaske am Zeughause in Berlin.
Welche verschiedenen, widerstreitenden Eindrücke
und Vorstellungen weckt diese Aufzählung; eine Skala
von Empfindungen von dem größten, die tiefsten
Seelenregungen aufwühlenden Genuß bis zum flüch-
tigen Behagen eines leichten Sinnenreizes. Von der
Versenkung in das Grübeln des Gelehrten bis zur
— wenig aufregenden Befriedigung unseres Dranges
zu wissen, wo einer unserer Lieferanten wohnt. Ein
Fortgerissenwerden zu taumelnder Lust, zum tiefsten
Leid--------und das Interesse für die Toilette, die
eine Hofdame bei einem Hofbai! trug.
Alles dies geben uns die Werke, die das Urheber-
recht schützt. Was ist ihnen nun gemeinsam?
Der Begriff der Schönheit; ihr ästhetischer Wert,
ihre ästhetische Wirkung? Nichts von alledem! Denn
alle diese Dinge können wir bei den aufgezählten
Werken nicht unter einen Gesichtspunkt bringen.
Und doch spricht aus allen diesen Dingen etwas
zu uns, das überall das gleiche und wieder bei jedem
einzelnen so grundverschieden ist, — — nämlich
der Schöpfer selbst, der Mensch, der hinter dem
Werk steht, der durch das Werk zu uns spricht, der
Mensch, mit dem wir lachen und weinen, der uns
sein Behagen und seinen Humor mitteilt, dessen
Menschenverachtung uns zur Bitterkeit zwingt; der
Mensch, dessen Hand uns durch die verschlungenen
Wege der Geschichte führt und den Schleier vor
den Geheimnissen der Natur aufdeckt. Der Mensch,
der uns zwingt, mit seinen Augen zu schauen, die
Gebilde zu schauen, in denen sein Empfinden und
Denken sich verkörpert, der uns zwingt, mit seinen
Augen die Natur, Menschen und Landschaften zu
sehen, und der uns bannt, die Stimmungen in uns
aufzunehmen, die Gegenwärtiges und Vergangenes
in ihm wecken; — — der Mensch, dessen kühler
und praktischer Sinn uns anleitet, am schnellsten und
sichersten zu erfahren, wo unser Schneider wohnt.
Alles, was vom Menschen geschaffen wird, erhält nur
Wert durch das, was der Mensch ist, und was er
bedeutet. Sprache und Schrift, Töne und Noten und
Kontrapunkt, Pinsel und Meißel, Stift und Farbe sind
lediglich die Mittel, durch welche ein Mensch sich
uns offenbart. Alle Werke der Literatur, der Tonkunst
und der Musik sind uns nur Offenbarungen des
Menschen, Offenbarungen der Individualität des Ur-
hebers. Aus der Individualität des Urhebers fließt die
Wirkung des Geisteswerks; ihre Offenbarung ist auch
der letzte Zweck jedes Werks.
Dies gilt sowohl für die Ästhetik, wie für das
Recht. Alle ästhetischen Regeln oder Entwicklungs-
gesetze betreffen nur Nebensächliches, oder sie führen
wieder auf das Menschliche zurück, indem sie uns
zeigen, wie der Einzelne als Kind seiner Zeit der
Erbe der Vergangenheit ist, und den Geist atmet, aus
dem er geboren ist. Aber das beste und höchste,
was der Künstler, der Dichter bieten kann, ist sein
Eigenstes, sein Ich, seine Individualität. Wer ein Werk
zu verstehen trachtet, der versenkt sich in die Seele
des Schöpfers. Sonst bleibt er an der Oberfläche
haften.
Ein geistvoller englischer Kunsthistoriker sagt ein-
mal, der Zweck der Kunst sei, allen Dingen eine höhere
Bedeutsamkeit zu geben, in der das Zufällige des in
der Natur Vorhandenen abgestreift, und das Wesent-
liche, das Typische, erhöht erscheint. Darin liegt eine
große Wahrheit. Nur muß man sich klar machen,
daß es sich in der Kunst nicht um die objektive, ich
möchte sagen, aus Addieren und Dividieren entstan-
dene Bedeutsamkeit handelt, sondern um die subjek-
tive, die in der Persönlichkeit des Künstlers ihre
Quelle hat.
Wie der Künstler die Dinge sieht oder sich vor-
stellt, und wie er diese Vorstellungen zum Ausdruck
bringt, ist von seiner Individualität bedingt.
Und auch im Recht gilt es, im Werk die Persön-
lichkeit des Schöpfers zu suchen. Das im Urheber-
recht maßgebende Merkmal des Geisteswerks ist die
Individualität des Schöpfers. Dies ist das wesentliche
Merkmal, das den Werken der Literatur, der Tonkunst
und der bildenden Kunst gemeinsam ist.
Unter diesem Gesichtspunkt können wir das Werk
der bildenden Künste auffassen als »die durch die
Mittel der bildenden Künste zum Ausdruck gebrachte
individuelle Schöpfung, als die Schöpfung, die in
ihrer Eigenart durch die ihr aufgeprägte Individualität
des Schöpfers bedingt ist«.
Was die Mittel der bildenden Künste sind, ergibt
sich — im Rahmen unserer Betrachtung — aus dem
Verhältnis zu Literatur und Musik. Es sind die Dar-
stellungsmittel, die auf den Gesichtssinn wirken, die
uns die Bedeutung der äußeren Erscheinung der Dinge
enthüllen.
Gehen wir nun zu dem Werk der angewandten
Kunst über. Um meine Ausführungen zu veranschau-
lichen, verweise ich auf einfaches Gerät aus unserer
alltäglichen Umgebung, auf den Stuhl.
Der Zweck des Stuhles scheint zunächst auf etwas
ganz anderes gerichtet zu sein, als auf die Offenba-
rung einer Persönlichkeit. Der Stuhl ist ein Sitzgerät.
Die Herstellung eines Stuhles ist eine konstruktive
Aufgabe, die dem Handwerker oder dem Möbelfabri-
kanten obliegt. Wie der Stuhl gebaut werden soll,
hängt in erster Reihe von seinem Gebrauchszweck ab.
Ein Eßzimmerstuhl ist etwas anderes als ein Schreib-
tischstuhl; dieser wieder verschieden vom bequemen
Lehnstuhl. Ein Stuhl, der zum Sitzen vor einem
Tische dient, wie z. B. ein Eßzimmerstuhl, muß
so konstruiert sein, daß der Oberkörper sich zwang-
los dem Tisch nähert, daß die Oberarme nicht
künstlich gehoben werden müssen und schwer auf
dem Tisch lasten; der Stuhl darf also nicht zu
niedrig sein. Er darf aber wieder nicht zu hoch sein,
weil dann der Kopf übermäßig geneigt und der
Rücken gebeugt werden muß. Der Sitz darf nicht
zu tief sein, sonst sitzt man nur auf der Vorderhälfte,
was ermüdet; nicht zu knapp, denn sonst wird der
Sitz ebenfalls unbequem. Die Rücklehne soll den
Klingers Beethoven;
eine Löwin von Gaul;
Klingers Nietzsche;
eine Meißener Kaminfigur;
eine Schlütermaske am Zeughause in Berlin.
Welche verschiedenen, widerstreitenden Eindrücke
und Vorstellungen weckt diese Aufzählung; eine Skala
von Empfindungen von dem größten, die tiefsten
Seelenregungen aufwühlenden Genuß bis zum flüch-
tigen Behagen eines leichten Sinnenreizes. Von der
Versenkung in das Grübeln des Gelehrten bis zur
— wenig aufregenden Befriedigung unseres Dranges
zu wissen, wo einer unserer Lieferanten wohnt. Ein
Fortgerissenwerden zu taumelnder Lust, zum tiefsten
Leid--------und das Interesse für die Toilette, die
eine Hofdame bei einem Hofbai! trug.
Alles dies geben uns die Werke, die das Urheber-
recht schützt. Was ist ihnen nun gemeinsam?
Der Begriff der Schönheit; ihr ästhetischer Wert,
ihre ästhetische Wirkung? Nichts von alledem! Denn
alle diese Dinge können wir bei den aufgezählten
Werken nicht unter einen Gesichtspunkt bringen.
Und doch spricht aus allen diesen Dingen etwas
zu uns, das überall das gleiche und wieder bei jedem
einzelnen so grundverschieden ist, — — nämlich
der Schöpfer selbst, der Mensch, der hinter dem
Werk steht, der durch das Werk zu uns spricht, der
Mensch, mit dem wir lachen und weinen, der uns
sein Behagen und seinen Humor mitteilt, dessen
Menschenverachtung uns zur Bitterkeit zwingt; der
Mensch, dessen Hand uns durch die verschlungenen
Wege der Geschichte führt und den Schleier vor
den Geheimnissen der Natur aufdeckt. Der Mensch,
der uns zwingt, mit seinen Augen zu schauen, die
Gebilde zu schauen, in denen sein Empfinden und
Denken sich verkörpert, der uns zwingt, mit seinen
Augen die Natur, Menschen und Landschaften zu
sehen, und der uns bannt, die Stimmungen in uns
aufzunehmen, die Gegenwärtiges und Vergangenes
in ihm wecken; — — der Mensch, dessen kühler
und praktischer Sinn uns anleitet, am schnellsten und
sichersten zu erfahren, wo unser Schneider wohnt.
Alles, was vom Menschen geschaffen wird, erhält nur
Wert durch das, was der Mensch ist, und was er
bedeutet. Sprache und Schrift, Töne und Noten und
Kontrapunkt, Pinsel und Meißel, Stift und Farbe sind
lediglich die Mittel, durch welche ein Mensch sich
uns offenbart. Alle Werke der Literatur, der Tonkunst
und der Musik sind uns nur Offenbarungen des
Menschen, Offenbarungen der Individualität des Ur-
hebers. Aus der Individualität des Urhebers fließt die
Wirkung des Geisteswerks; ihre Offenbarung ist auch
der letzte Zweck jedes Werks.
Dies gilt sowohl für die Ästhetik, wie für das
Recht. Alle ästhetischen Regeln oder Entwicklungs-
gesetze betreffen nur Nebensächliches, oder sie führen
wieder auf das Menschliche zurück, indem sie uns
zeigen, wie der Einzelne als Kind seiner Zeit der
Erbe der Vergangenheit ist, und den Geist atmet, aus
dem er geboren ist. Aber das beste und höchste,
was der Künstler, der Dichter bieten kann, ist sein
Eigenstes, sein Ich, seine Individualität. Wer ein Werk
zu verstehen trachtet, der versenkt sich in die Seele
des Schöpfers. Sonst bleibt er an der Oberfläche
haften.
Ein geistvoller englischer Kunsthistoriker sagt ein-
mal, der Zweck der Kunst sei, allen Dingen eine höhere
Bedeutsamkeit zu geben, in der das Zufällige des in
der Natur Vorhandenen abgestreift, und das Wesent-
liche, das Typische, erhöht erscheint. Darin liegt eine
große Wahrheit. Nur muß man sich klar machen,
daß es sich in der Kunst nicht um die objektive, ich
möchte sagen, aus Addieren und Dividieren entstan-
dene Bedeutsamkeit handelt, sondern um die subjek-
tive, die in der Persönlichkeit des Künstlers ihre
Quelle hat.
Wie der Künstler die Dinge sieht oder sich vor-
stellt, und wie er diese Vorstellungen zum Ausdruck
bringt, ist von seiner Individualität bedingt.
Und auch im Recht gilt es, im Werk die Persön-
lichkeit des Schöpfers zu suchen. Das im Urheber-
recht maßgebende Merkmal des Geisteswerks ist die
Individualität des Schöpfers. Dies ist das wesentliche
Merkmal, das den Werken der Literatur, der Tonkunst
und der bildenden Kunst gemeinsam ist.
Unter diesem Gesichtspunkt können wir das Werk
der bildenden Künste auffassen als »die durch die
Mittel der bildenden Künste zum Ausdruck gebrachte
individuelle Schöpfung, als die Schöpfung, die in
ihrer Eigenart durch die ihr aufgeprägte Individualität
des Schöpfers bedingt ist«.
Was die Mittel der bildenden Künste sind, ergibt
sich — im Rahmen unserer Betrachtung — aus dem
Verhältnis zu Literatur und Musik. Es sind die Dar-
stellungsmittel, die auf den Gesichtssinn wirken, die
uns die Bedeutung der äußeren Erscheinung der Dinge
enthüllen.
Gehen wir nun zu dem Werk der angewandten
Kunst über. Um meine Ausführungen zu veranschau-
lichen, verweise ich auf einfaches Gerät aus unserer
alltäglichen Umgebung, auf den Stuhl.
Der Zweck des Stuhles scheint zunächst auf etwas
ganz anderes gerichtet zu sein, als auf die Offenba-
rung einer Persönlichkeit. Der Stuhl ist ein Sitzgerät.
Die Herstellung eines Stuhles ist eine konstruktive
Aufgabe, die dem Handwerker oder dem Möbelfabri-
kanten obliegt. Wie der Stuhl gebaut werden soll,
hängt in erster Reihe von seinem Gebrauchszweck ab.
Ein Eßzimmerstuhl ist etwas anderes als ein Schreib-
tischstuhl; dieser wieder verschieden vom bequemen
Lehnstuhl. Ein Stuhl, der zum Sitzen vor einem
Tische dient, wie z. B. ein Eßzimmerstuhl, muß
so konstruiert sein, daß der Oberkörper sich zwang-
los dem Tisch nähert, daß die Oberarme nicht
künstlich gehoben werden müssen und schwer auf
dem Tisch lasten; der Stuhl darf also nicht zu
niedrig sein. Er darf aber wieder nicht zu hoch sein,
weil dann der Kopf übermäßig geneigt und der
Rücken gebeugt werden muß. Der Sitz darf nicht
zu tief sein, sonst sitzt man nur auf der Vorderhälfte,
was ermüdet; nicht zu knapp, denn sonst wird der
Sitz ebenfalls unbequem. Die Rücklehne soll den