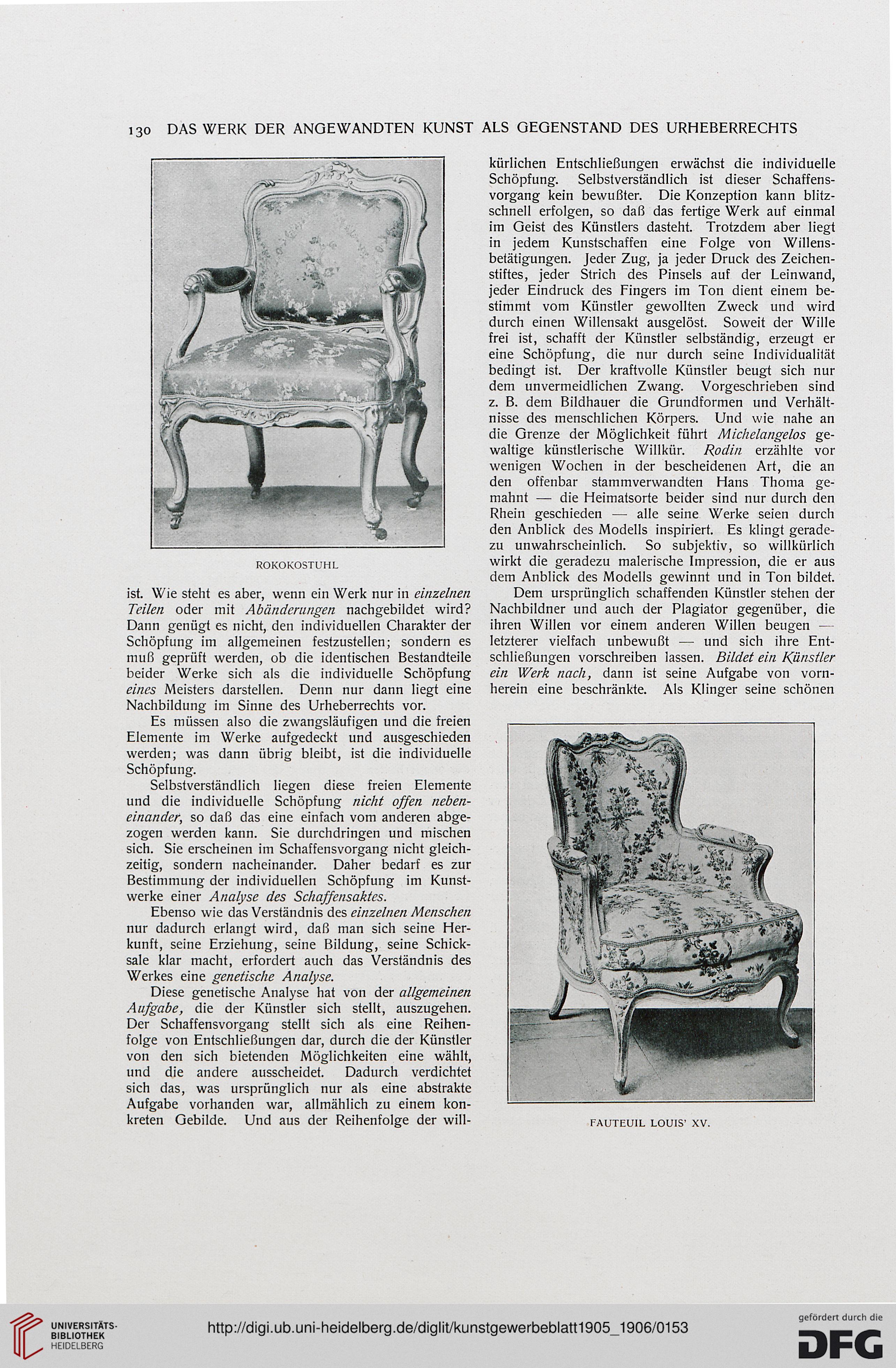i3o DAS WERK DER ANGEWANDTEN KUNST ALS GEGENSTAND DES URHEBERRECHTS
ROKOKOSTUHL
ist. Wie steht es aber, wenn ein Werk nur in einzelnen
Teilen oder mit Abänderungen nachgebildet wird?
Dann genügt es nicht, den individuellen Charakter der
Schöpfung im allgemeinen festzustellen; sondern es
muß geprüft werden, ob die identischen Bestandteile
beider Werke sich als die individuelle Schöpfung
eines Meisters darstellen. Denn nur dann liegt eine
Nachbildung im Sinne des Urheberrechts vor.
Es müssen also die zwangsläufigen und die freien
Elemente im Werke aufgedeckt und ausgeschieden
werden; was dann übrig bleibt, ist die individuelle
Schöpfung.
Selbstverständlich liegen diese freien Elemente
und die individuelle Schöpfung nicht offen neben-
einander, so daß das eine einfach vom anderen abge-
zogen werden kann. Sie durchdringen und mischen
sich. Sie erscheinen im Schaffensvorgang nicht gleich-
zeitig, sondern nacheinander. Daher bedarf es zur
Bestimmung der individuellen Schöpfung im Kunst-
werke einer Analyse des Schaffensaktes.
Ebenso wie das Verständnis des einzelnen Menschen
nur dadurch erlangt wird, daß man sich seine Her-
kunft, seine Erziehung, seine Bildung, seine Schick-
sale klar macht, erfordert auch das Verständnis des
Werkes eine genetische Analyse.
Diese genetische Analyse hat von der allgemeinen
Aufgabe, die der Künstler sich stellt, auszugehen.
Der Schaffensvorgang stellt sich als eine Reihen-
folge von Entschließungen dar, durch die der Künstler
von den sich bietenden Möglichkeiten eine wählt,
und die andere ausscheidet. Dadurch verdichtet
sich das, was ursprünglich nur als eine abstrakte
Aufgabe vorhanden war, allmählich zu einem kon-
kreten Gebilde. Und aus der Reihenfolge der will-
kürlichen Entschließungen erwächst die individuelle
Schöpfung. Selbstverständlich ist dieser Schaffens-
vorgang kein bewußter. Die Konzeption kann blitz-
schnell erfolgen, so daß das fertige Werk auf einmal
im Geist des Künstlers dasteht. Trotzdem aber liegt
in jedem Kunstschaffen eine Folge von Willens-
betätigungen. Jeder Zug, ja jeder Druck des Zeichen-
stiftes, jeder Strich des Pinsels auf der Leinwand,
jeder Eindruck des Fingers im Ton dient einem be-
stimmt vom Künstler gewollten Zweck und wird
durch einen Willensakt ausgelöst. Soweit der Wille
frei ist, schafft der Künstler selbständig, erzeugt er
eine Schöpfung, die nur durch seine Individualität
bedingt ist. Der kraftvolle Künstler beugt sich nur
dem unvermeidlichen Zwang. Vorgeschrieben sind
z. B. dem Bildhauer die Grundformen und Verhält-
nisse des menschlichen Körpers. Und wie nahe an
die Grenze der Möglichkeit führt Michelangelos ge-
waltige künstlerische Willkür. Rodin erzählte vor
wenigen Wochen in der bescheidenen Art, die an
den offenbar stammverwandten Hans Thoma ge-
mahnt — die Heimatsorte beider sind nur durch den
Rhein geschieden — alle seine Werke seien durch
den Anblick des Modells inspiriert. Es klingt gerade-
zu unwahrscheinlich. So subjektiv, so willkürlich
wirkt die geradezu malerische Impression, die er aus
dem Anblick des Modells gewinnt und in Ton bildet.
Dem ursprünglich schaffenden Künstler stehen der
Nachbildner und auch der Plagiator gegenüber, die
ihren Willen vor einem anderen Willen beugen —
letzterer vielfach unbewußt — und sich ihre Ent-
schließungen vorschreiben lassen. Bildet ein Künstler
ein Werk nach, dann ist seine Aufgabe von vorn-
herein eine beschränkte. Als Klinger seine schönen
*M
FAUTEUIL LOUIS' XV.
ROKOKOSTUHL
ist. Wie steht es aber, wenn ein Werk nur in einzelnen
Teilen oder mit Abänderungen nachgebildet wird?
Dann genügt es nicht, den individuellen Charakter der
Schöpfung im allgemeinen festzustellen; sondern es
muß geprüft werden, ob die identischen Bestandteile
beider Werke sich als die individuelle Schöpfung
eines Meisters darstellen. Denn nur dann liegt eine
Nachbildung im Sinne des Urheberrechts vor.
Es müssen also die zwangsläufigen und die freien
Elemente im Werke aufgedeckt und ausgeschieden
werden; was dann übrig bleibt, ist die individuelle
Schöpfung.
Selbstverständlich liegen diese freien Elemente
und die individuelle Schöpfung nicht offen neben-
einander, so daß das eine einfach vom anderen abge-
zogen werden kann. Sie durchdringen und mischen
sich. Sie erscheinen im Schaffensvorgang nicht gleich-
zeitig, sondern nacheinander. Daher bedarf es zur
Bestimmung der individuellen Schöpfung im Kunst-
werke einer Analyse des Schaffensaktes.
Ebenso wie das Verständnis des einzelnen Menschen
nur dadurch erlangt wird, daß man sich seine Her-
kunft, seine Erziehung, seine Bildung, seine Schick-
sale klar macht, erfordert auch das Verständnis des
Werkes eine genetische Analyse.
Diese genetische Analyse hat von der allgemeinen
Aufgabe, die der Künstler sich stellt, auszugehen.
Der Schaffensvorgang stellt sich als eine Reihen-
folge von Entschließungen dar, durch die der Künstler
von den sich bietenden Möglichkeiten eine wählt,
und die andere ausscheidet. Dadurch verdichtet
sich das, was ursprünglich nur als eine abstrakte
Aufgabe vorhanden war, allmählich zu einem kon-
kreten Gebilde. Und aus der Reihenfolge der will-
kürlichen Entschließungen erwächst die individuelle
Schöpfung. Selbstverständlich ist dieser Schaffens-
vorgang kein bewußter. Die Konzeption kann blitz-
schnell erfolgen, so daß das fertige Werk auf einmal
im Geist des Künstlers dasteht. Trotzdem aber liegt
in jedem Kunstschaffen eine Folge von Willens-
betätigungen. Jeder Zug, ja jeder Druck des Zeichen-
stiftes, jeder Strich des Pinsels auf der Leinwand,
jeder Eindruck des Fingers im Ton dient einem be-
stimmt vom Künstler gewollten Zweck und wird
durch einen Willensakt ausgelöst. Soweit der Wille
frei ist, schafft der Künstler selbständig, erzeugt er
eine Schöpfung, die nur durch seine Individualität
bedingt ist. Der kraftvolle Künstler beugt sich nur
dem unvermeidlichen Zwang. Vorgeschrieben sind
z. B. dem Bildhauer die Grundformen und Verhält-
nisse des menschlichen Körpers. Und wie nahe an
die Grenze der Möglichkeit führt Michelangelos ge-
waltige künstlerische Willkür. Rodin erzählte vor
wenigen Wochen in der bescheidenen Art, die an
den offenbar stammverwandten Hans Thoma ge-
mahnt — die Heimatsorte beider sind nur durch den
Rhein geschieden — alle seine Werke seien durch
den Anblick des Modells inspiriert. Es klingt gerade-
zu unwahrscheinlich. So subjektiv, so willkürlich
wirkt die geradezu malerische Impression, die er aus
dem Anblick des Modells gewinnt und in Ton bildet.
Dem ursprünglich schaffenden Künstler stehen der
Nachbildner und auch der Plagiator gegenüber, die
ihren Willen vor einem anderen Willen beugen —
letzterer vielfach unbewußt — und sich ihre Ent-
schließungen vorschreiben lassen. Bildet ein Künstler
ein Werk nach, dann ist seine Aufgabe von vorn-
herein eine beschränkte. Als Klinger seine schönen
*M
FAUTEUIL LOUIS' XV.