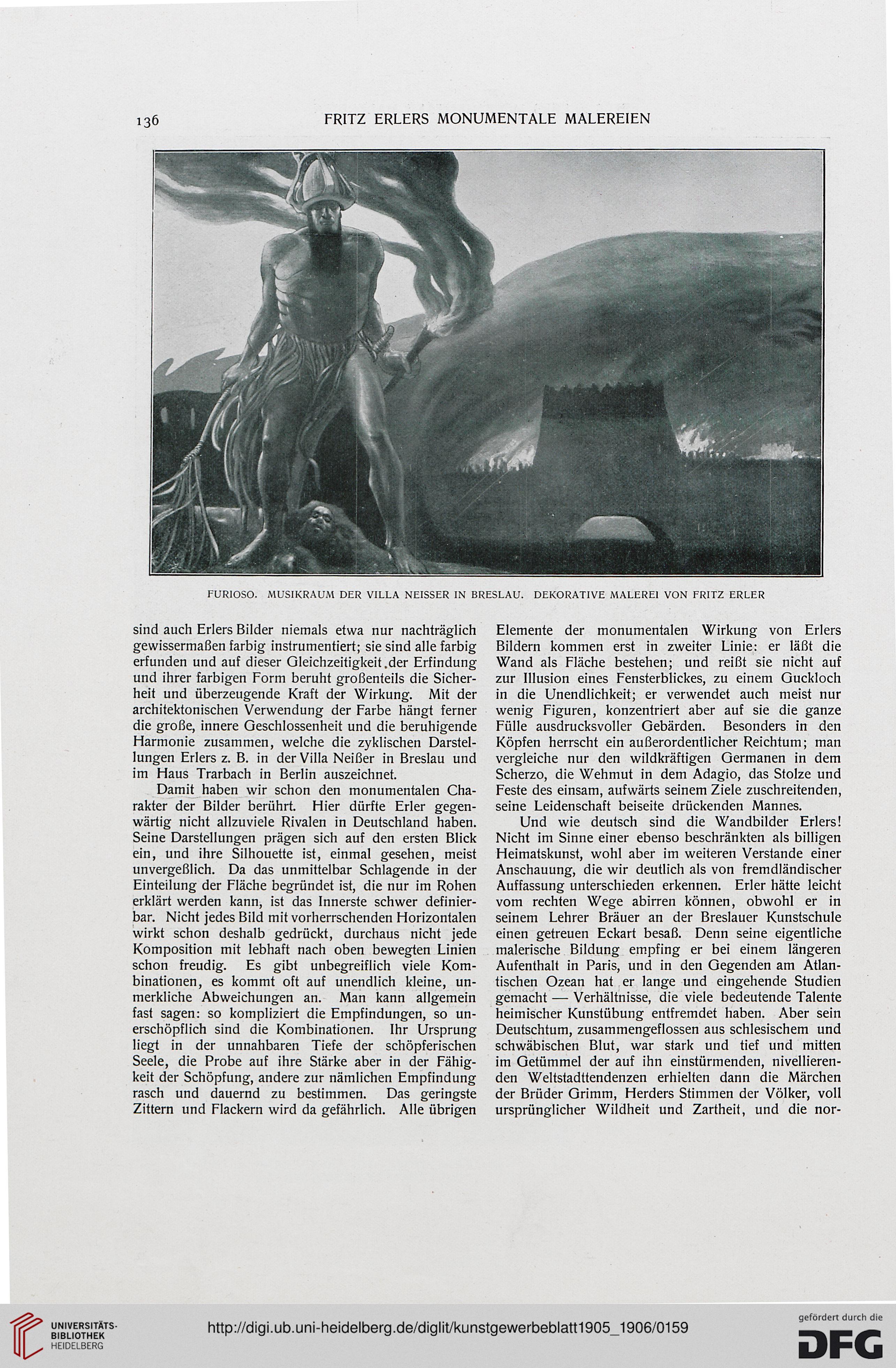136
FRITZ ERLERS MONUMENTALE MALEREIEN
FURIOSO. MUSIKRAUM DER VILLA NEISSER IN BRESLAU. DEKORATIVE MALEREI VON FRITZ ERLER
sind auch Erlers Bilder niemals etwa nur nachträglich
gewissermaßen farbig instrumentiert; sie sind alle farbig
erfunden und auf dieser Gleichzeitigkeit.der Erfindung
und ihrer farbigen Form beruht großenteils die Sicher-
heit und überzeugende Kraft der Wirkung. Mit der
architektonischen Verwendung der Farbe hängt ferner
die große, innere Geschlossenheit und die beruhigende
Harmonie zusammen, welche die zyklischen Darstel-
lungen Erlers z. B. in der Villa Neißer in Breslau und
im Haus Trarbach in Berlin auszeichnet.
Damit haben wir schon den monumentalen Cha-
rakter der Bilder berührt. Hier dürfte Erler gegen-
wärtig nicht allzuviele Rivalen in Deutschland haben.
Seine Darstellungen prägen sich auf den ersten Blick
ein, und ihre Silhouette ist, einmal gesehen, meist
unvergeßlich. Da das unmittelbar Schlagende in der
Einteilung der Fläche begründet ist, die nur im Rohen
erklärt werden kann, ist das Innerste schwer definier-
bar. Nicht jedes Bild mit vorherrschenden Horizontalen
wirkt schon deshalb gedrückt, durchaus nicht jede
Komposition mit lebhaft nach oben bewegten Linien
schon freudig. Es gibt unbegreiflich viele Kom-
binationen, es kommt oft auf unendlich kleine, un-
merkliche Abweichungen an. Man kann allgemein
fast sagen: so kompliziert die Empfindungen, so un-
erschöpflich sind die Kombinationen. Ihr Ursprung
liegt in der unnahbaren Tiefe der schöpferischen
Seele, die Probe auf ihre Stärke aber in der Fähig-
keit der Schöpfung, andere zur nämlichen Empfindung
rasch und dauernd zu bestimmen. Das geringste
Zittern und Flackern wird da gefährlich. Alle übrigen
Elemente der monumentalen Wirkung von Erlers
Bildern kommen erst in zweiter Linie: er läßt die
Wand als Fläche bestehen; und reißt sie nicht auf
zur Illusion eines Fensterblickes, zu einem Guckloch
in die Unendlichkeit; er verwendet auch meist nur
wenig Figuren, konzentriert aber auf sie die ganze
Fülle ausdrucksvoller Gebärden. Besonders in den
Köpfen herrscht ein außerordentlicher Reichtum; man
vergleiche nur den wildkräftigen Germanen in dem
Scherzo, die Wehmut in dem Adagio, das Stolze und
Feste des einsam, aufwärts seinem Ziele zuschreitenden,
seine Leidenschaft beiseite drückenden Mannes.
Und wie deutsch sind die Wandbilder Erlers!
Nicht im Sinne einer ebenso beschränkten als billigen
Heimatskunst, wohl aber im weiteren Verstände einer
Anschauung, die wir deutlich als von fremdländischer
Auffassung unterschieden erkennen. Erler hätte leicht
vom rechten Wege abirren können, obwohl er in
seinem Lehrer Bräuer an der Breslauer Kunstschule
einen getreuen Eckart besaß. Denn seine eigentliche
malerische Bildung empfing er bei einem längeren
Aufenthalt in Paris, und in den Gegenden am Atlan-
tischen Ozean hat er lange und eingehende Studien
gemacht — Verhältnisse, die viele bedeutende Talente
heimischer Kunstübung entfremdet haben. Aber sein
Deutschtum, zusammengeflossen aus schlesischem und
schwäbischen Blut, war stark und tief und mitten
im Getümmel der auf ihn einstürmenden, nivellieren-
den Weltstadttendenzen erhielten dann die Märchen
der Brüder Grimm, Herders Stimmen der Völker, voll
ursprünglicher Wildheit und Zartheit, und die nor-
FRITZ ERLERS MONUMENTALE MALEREIEN
FURIOSO. MUSIKRAUM DER VILLA NEISSER IN BRESLAU. DEKORATIVE MALEREI VON FRITZ ERLER
sind auch Erlers Bilder niemals etwa nur nachträglich
gewissermaßen farbig instrumentiert; sie sind alle farbig
erfunden und auf dieser Gleichzeitigkeit.der Erfindung
und ihrer farbigen Form beruht großenteils die Sicher-
heit und überzeugende Kraft der Wirkung. Mit der
architektonischen Verwendung der Farbe hängt ferner
die große, innere Geschlossenheit und die beruhigende
Harmonie zusammen, welche die zyklischen Darstel-
lungen Erlers z. B. in der Villa Neißer in Breslau und
im Haus Trarbach in Berlin auszeichnet.
Damit haben wir schon den monumentalen Cha-
rakter der Bilder berührt. Hier dürfte Erler gegen-
wärtig nicht allzuviele Rivalen in Deutschland haben.
Seine Darstellungen prägen sich auf den ersten Blick
ein, und ihre Silhouette ist, einmal gesehen, meist
unvergeßlich. Da das unmittelbar Schlagende in der
Einteilung der Fläche begründet ist, die nur im Rohen
erklärt werden kann, ist das Innerste schwer definier-
bar. Nicht jedes Bild mit vorherrschenden Horizontalen
wirkt schon deshalb gedrückt, durchaus nicht jede
Komposition mit lebhaft nach oben bewegten Linien
schon freudig. Es gibt unbegreiflich viele Kom-
binationen, es kommt oft auf unendlich kleine, un-
merkliche Abweichungen an. Man kann allgemein
fast sagen: so kompliziert die Empfindungen, so un-
erschöpflich sind die Kombinationen. Ihr Ursprung
liegt in der unnahbaren Tiefe der schöpferischen
Seele, die Probe auf ihre Stärke aber in der Fähig-
keit der Schöpfung, andere zur nämlichen Empfindung
rasch und dauernd zu bestimmen. Das geringste
Zittern und Flackern wird da gefährlich. Alle übrigen
Elemente der monumentalen Wirkung von Erlers
Bildern kommen erst in zweiter Linie: er läßt die
Wand als Fläche bestehen; und reißt sie nicht auf
zur Illusion eines Fensterblickes, zu einem Guckloch
in die Unendlichkeit; er verwendet auch meist nur
wenig Figuren, konzentriert aber auf sie die ganze
Fülle ausdrucksvoller Gebärden. Besonders in den
Köpfen herrscht ein außerordentlicher Reichtum; man
vergleiche nur den wildkräftigen Germanen in dem
Scherzo, die Wehmut in dem Adagio, das Stolze und
Feste des einsam, aufwärts seinem Ziele zuschreitenden,
seine Leidenschaft beiseite drückenden Mannes.
Und wie deutsch sind die Wandbilder Erlers!
Nicht im Sinne einer ebenso beschränkten als billigen
Heimatskunst, wohl aber im weiteren Verstände einer
Anschauung, die wir deutlich als von fremdländischer
Auffassung unterschieden erkennen. Erler hätte leicht
vom rechten Wege abirren können, obwohl er in
seinem Lehrer Bräuer an der Breslauer Kunstschule
einen getreuen Eckart besaß. Denn seine eigentliche
malerische Bildung empfing er bei einem längeren
Aufenthalt in Paris, und in den Gegenden am Atlan-
tischen Ozean hat er lange und eingehende Studien
gemacht — Verhältnisse, die viele bedeutende Talente
heimischer Kunstübung entfremdet haben. Aber sein
Deutschtum, zusammengeflossen aus schlesischem und
schwäbischen Blut, war stark und tief und mitten
im Getümmel der auf ihn einstürmenden, nivellieren-
den Weltstadttendenzen erhielten dann die Märchen
der Brüder Grimm, Herders Stimmen der Völker, voll
ursprünglicher Wildheit und Zartheit, und die nor-