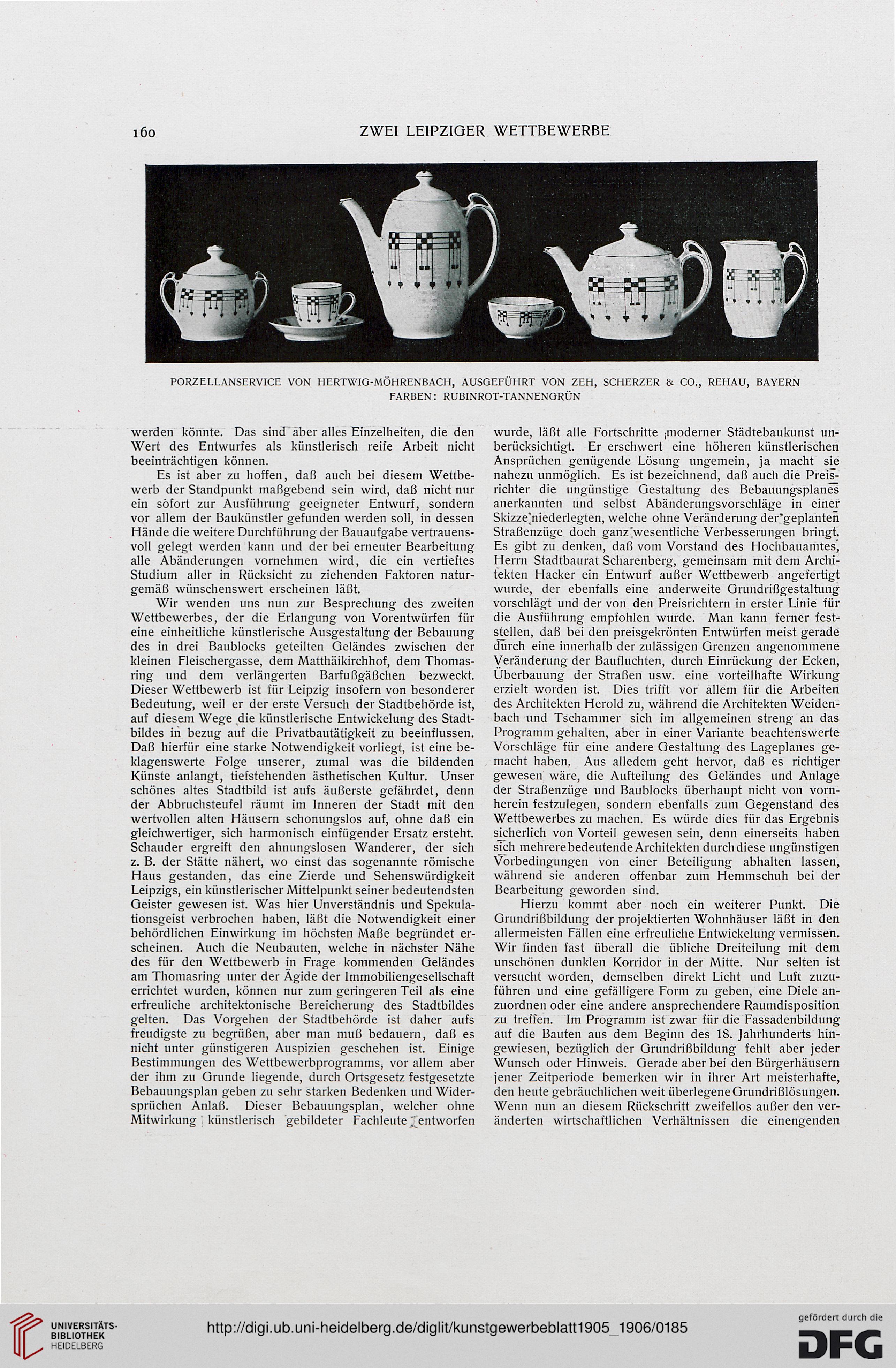i6o
ZWEI LEIPZIGER WETTBEWERBE
PORZELLANSERVICE VON HERTWTG-MOHRENBACH, AUSGEFÜHRT VON ZEH, SCHERZER & CO., REHAU, BAYERN
FARBEN: RUBINROT-TANNENGRÜN
werden könnte. Das sind aber alles Einzelheiten, die den
Wert des Entwurfes als künstlerisch reife Arbeit nicht
beeinträchtigen können.
Es ist aber zu hoffen, daß auch bei diesem Wettbe-
werb der Standpunkt maßgebend sein wird, daß nicht nur
ein sofort zur Ausführung geeigneter Entwurf, sondern
vor allem der Baukünstler gefunden werden soll, in dessen
Hände die weitere Durchführung der Bauaufgabe vertrauens-
voll gelegt werden kann und der bei erneuter Bearbeitung
alle Abänderungen vornehmen wird, die ein vertieftes
Studium aller in Rücksicht zu ziehenden Faktoren natur-
gemäß wünschenswert erscheinen läßt.
Wir wenden uns nun zur Besprechung des zweiten
Wettbewerbes, der die Erlangung von Vorentwürfen für
eine einheitliche künstlerische Ausgestaltung der Bebauung
des in drei Baublocks geteilten Geländes zwischen der
kleinen Fleischergasse, dem Matthäikirchhof, dem Thomas-
ring und dem verlängerten Barfußgäßchen bezweckt.
Dieser Wettbewerb ist für Leipzig insofern von besonderer
Bedeutung, weil er der erste Versuch der Stadtbehörde ist,
auf diesem Wege die künstlerische Entwickelung des Stadt-
bildes in bezug auf die Privatbautätigkeit zu beeinflussen.
Daß hierfür eine starke Notwendigkeit vorliegt, ist eine be-
klagenswerte Folge unserer, zumal was die bildenden
Künste anlangt, tiefstehenden ästhetischen Kultur. Unser
schönes altes Stadtbild ist aufs äußerste gefährdet, denn
der Abbruchsteufel räumt im Inneren der Stadt mit den
wertvollen alten Häusern schonungslos auf, ohne daß ein
gleichwertiger, sich harmonisch einfügender Ersatz ersteht.
Schauder ergreift den ahnungslosen Wanderer, der sich
z. B. der Stätte nähert, wo einst das sogenannte römische
Haus gestanden, das eine Zierde und Sehenswürdigkeit
Leipzigs, ein künstlerischer Mittelpunkt seiner bedeutendsten
Geister gewesen ist. Was hier Unverständnis und Spekula-
tionsgeist verbrochen haben, läßt die Notwendigkeit einer
behördlichen Einwirkung im höchsten Maße begründet er-
scheinen. Auch die Neubauten, welche in nächster Nähe
des für den Wettbewerb in Frage kommenden Geländes
am Thomasring unter der Ägide der Immobiliengesellschaft
errichtet wurden, können nur zum geringeren Teil als eine
erfreuliche architektonische Bereicherung des Stadtbildes
gelten. Das Vorgehen der Stadtbehörde ist daher aufs
freudigste zu begrüßen, aber man muß bedauern, daß es
nicht unter günstigeren Auspizien geschehen ist. Einige
Bestimmungen des Wettbewerbprogramms, vor allem aber
der ihm zu Grunde liegende, durch Ortsgesetz festgesetzte
Bebauungsplan geben zu sehr starken Bedenken und Wider-
sprüchen Anlaß. Dieser Bebauungsplan, welcher ohne
Mitwirkung ' künstlerisch gebildeter Fachleute ^entworfen
wurde, läßt alle Fortschritte jmoderner Städtebaukunst un-
berücksichtigt. Er erschwert eine höheren künstlerischen
Ansprüchen genügende Lösung ungemein, ja macht sie
nahezu unmöglich. Es ist bezeichnend, daß auch die Preis-
richter die ungünstige Gestaltung des Bebauungsplanes
anerkannten und selbst Abänderungsvorschläge in einer
Skizze'niederlegten, welche ohne Veränderung der'geplanten
Straßenzüge doch ganz [wesentliche Verbesserungen bringt.
Es gibt zu denken, daß vom Vorstand des Hochbauamtes,
Herrn Stadtbaurat Scharenberg, gemeinsam mit dem Archi-
tekten Hacker ein Entwurf außer Wettbewerb angefertigt
wurde, der ebenfalls eine anderweite Grundrißgestaltung
vorschlägt und der von den Preisrichtern in erster Linie für
die Ausführung empfohlen wurde. Man kann ferner fest-
stellen, daß bei den preisgekrönten Entwürfen meist gerade
durch eine innerhalb der zulässigen Grenzen angenommene
Veränderung der Baufluchten, durch Einrückung der Ecken,
Überbauung der Straßen usw. eine vorteilhafte Wirkung
erzielt worden ist. Dies trifft vor allem für die Arbeiten
des Architekten Herold zu, während die Architekten Weiden-
bach und Tschammer sich im allgemeinen streng an das
Programm gehalten, aber in einer Variante beachtenswerte
Vorschläge für eine andere Gestaltung des Lageplanes ge-
macht haben. Aus alledem geht hervor, daß es richtiger
gewesen wäre, die Aufteilung des Geländes und Anlage
der Straßenzüge und Baublocks überhaupt nicht von vorn-
herein festzulegen, sondern ebenfalls zum Gegenstand des
Wettbewerbes zu machen. Es würde dies für das Ergebnis
sicherlich von Vorteil gewesen sein, denn einerseits haben
sich mehrere bedeutende Architekten durch diese ungünstigen
Vorbedingungen von einer Beteiligung abhalten lassen,
während sie anderen offenbar zum Hemmschuh bei der
Bearbeitung geworden sind.
Hierzu kommt aber noch ein weiterer Punkt. Die
Grundrißbildung der projektierten Wohnhäuser läßt in den
allermeisten Fällen eine erfreuliche Entwickelung vermissen.
Wir finden fast überall die übliche Dreiteilung mit dem
unschönen dunklen Korridor in der Mitte. Nur selten ist
versucht worden, demselben direkt Licht und Luft zuzu-
führen und eine gefälligere Form zu geben, eine Diele an-
zuordnen oder eine andere ansprechendere Raumdisposition
zu treffen. Im Programm ist zwar für die Fassadenbildung
auf die Bauten aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts hin-
gewiesen, bezüglich der Grundrißbildung fehlt aber jeder
Wunsch oder Hinweis. Gerade aber bei den Bürgerhäusern
jener Zeitperiode bemerken wir in ihrer Art meisterhafte,
den heute gebräuchlichen weit überlegene Grundrißlösungen.
Wenn nun an diesem Rückschritt zweifellos außer den ver-
änderten wirtschaftlichen Verhältnissen die einengenden
ZWEI LEIPZIGER WETTBEWERBE
PORZELLANSERVICE VON HERTWTG-MOHRENBACH, AUSGEFÜHRT VON ZEH, SCHERZER & CO., REHAU, BAYERN
FARBEN: RUBINROT-TANNENGRÜN
werden könnte. Das sind aber alles Einzelheiten, die den
Wert des Entwurfes als künstlerisch reife Arbeit nicht
beeinträchtigen können.
Es ist aber zu hoffen, daß auch bei diesem Wettbe-
werb der Standpunkt maßgebend sein wird, daß nicht nur
ein sofort zur Ausführung geeigneter Entwurf, sondern
vor allem der Baukünstler gefunden werden soll, in dessen
Hände die weitere Durchführung der Bauaufgabe vertrauens-
voll gelegt werden kann und der bei erneuter Bearbeitung
alle Abänderungen vornehmen wird, die ein vertieftes
Studium aller in Rücksicht zu ziehenden Faktoren natur-
gemäß wünschenswert erscheinen läßt.
Wir wenden uns nun zur Besprechung des zweiten
Wettbewerbes, der die Erlangung von Vorentwürfen für
eine einheitliche künstlerische Ausgestaltung der Bebauung
des in drei Baublocks geteilten Geländes zwischen der
kleinen Fleischergasse, dem Matthäikirchhof, dem Thomas-
ring und dem verlängerten Barfußgäßchen bezweckt.
Dieser Wettbewerb ist für Leipzig insofern von besonderer
Bedeutung, weil er der erste Versuch der Stadtbehörde ist,
auf diesem Wege die künstlerische Entwickelung des Stadt-
bildes in bezug auf die Privatbautätigkeit zu beeinflussen.
Daß hierfür eine starke Notwendigkeit vorliegt, ist eine be-
klagenswerte Folge unserer, zumal was die bildenden
Künste anlangt, tiefstehenden ästhetischen Kultur. Unser
schönes altes Stadtbild ist aufs äußerste gefährdet, denn
der Abbruchsteufel räumt im Inneren der Stadt mit den
wertvollen alten Häusern schonungslos auf, ohne daß ein
gleichwertiger, sich harmonisch einfügender Ersatz ersteht.
Schauder ergreift den ahnungslosen Wanderer, der sich
z. B. der Stätte nähert, wo einst das sogenannte römische
Haus gestanden, das eine Zierde und Sehenswürdigkeit
Leipzigs, ein künstlerischer Mittelpunkt seiner bedeutendsten
Geister gewesen ist. Was hier Unverständnis und Spekula-
tionsgeist verbrochen haben, läßt die Notwendigkeit einer
behördlichen Einwirkung im höchsten Maße begründet er-
scheinen. Auch die Neubauten, welche in nächster Nähe
des für den Wettbewerb in Frage kommenden Geländes
am Thomasring unter der Ägide der Immobiliengesellschaft
errichtet wurden, können nur zum geringeren Teil als eine
erfreuliche architektonische Bereicherung des Stadtbildes
gelten. Das Vorgehen der Stadtbehörde ist daher aufs
freudigste zu begrüßen, aber man muß bedauern, daß es
nicht unter günstigeren Auspizien geschehen ist. Einige
Bestimmungen des Wettbewerbprogramms, vor allem aber
der ihm zu Grunde liegende, durch Ortsgesetz festgesetzte
Bebauungsplan geben zu sehr starken Bedenken und Wider-
sprüchen Anlaß. Dieser Bebauungsplan, welcher ohne
Mitwirkung ' künstlerisch gebildeter Fachleute ^entworfen
wurde, läßt alle Fortschritte jmoderner Städtebaukunst un-
berücksichtigt. Er erschwert eine höheren künstlerischen
Ansprüchen genügende Lösung ungemein, ja macht sie
nahezu unmöglich. Es ist bezeichnend, daß auch die Preis-
richter die ungünstige Gestaltung des Bebauungsplanes
anerkannten und selbst Abänderungsvorschläge in einer
Skizze'niederlegten, welche ohne Veränderung der'geplanten
Straßenzüge doch ganz [wesentliche Verbesserungen bringt.
Es gibt zu denken, daß vom Vorstand des Hochbauamtes,
Herrn Stadtbaurat Scharenberg, gemeinsam mit dem Archi-
tekten Hacker ein Entwurf außer Wettbewerb angefertigt
wurde, der ebenfalls eine anderweite Grundrißgestaltung
vorschlägt und der von den Preisrichtern in erster Linie für
die Ausführung empfohlen wurde. Man kann ferner fest-
stellen, daß bei den preisgekrönten Entwürfen meist gerade
durch eine innerhalb der zulässigen Grenzen angenommene
Veränderung der Baufluchten, durch Einrückung der Ecken,
Überbauung der Straßen usw. eine vorteilhafte Wirkung
erzielt worden ist. Dies trifft vor allem für die Arbeiten
des Architekten Herold zu, während die Architekten Weiden-
bach und Tschammer sich im allgemeinen streng an das
Programm gehalten, aber in einer Variante beachtenswerte
Vorschläge für eine andere Gestaltung des Lageplanes ge-
macht haben. Aus alledem geht hervor, daß es richtiger
gewesen wäre, die Aufteilung des Geländes und Anlage
der Straßenzüge und Baublocks überhaupt nicht von vorn-
herein festzulegen, sondern ebenfalls zum Gegenstand des
Wettbewerbes zu machen. Es würde dies für das Ergebnis
sicherlich von Vorteil gewesen sein, denn einerseits haben
sich mehrere bedeutende Architekten durch diese ungünstigen
Vorbedingungen von einer Beteiligung abhalten lassen,
während sie anderen offenbar zum Hemmschuh bei der
Bearbeitung geworden sind.
Hierzu kommt aber noch ein weiterer Punkt. Die
Grundrißbildung der projektierten Wohnhäuser läßt in den
allermeisten Fällen eine erfreuliche Entwickelung vermissen.
Wir finden fast überall die übliche Dreiteilung mit dem
unschönen dunklen Korridor in der Mitte. Nur selten ist
versucht worden, demselben direkt Licht und Luft zuzu-
führen und eine gefälligere Form zu geben, eine Diele an-
zuordnen oder eine andere ansprechendere Raumdisposition
zu treffen. Im Programm ist zwar für die Fassadenbildung
auf die Bauten aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts hin-
gewiesen, bezüglich der Grundrißbildung fehlt aber jeder
Wunsch oder Hinweis. Gerade aber bei den Bürgerhäusern
jener Zeitperiode bemerken wir in ihrer Art meisterhafte,
den heute gebräuchlichen weit überlegene Grundrißlösungen.
Wenn nun an diesem Rückschritt zweifellos außer den ver-
änderten wirtschaftlichen Verhältnissen die einengenden