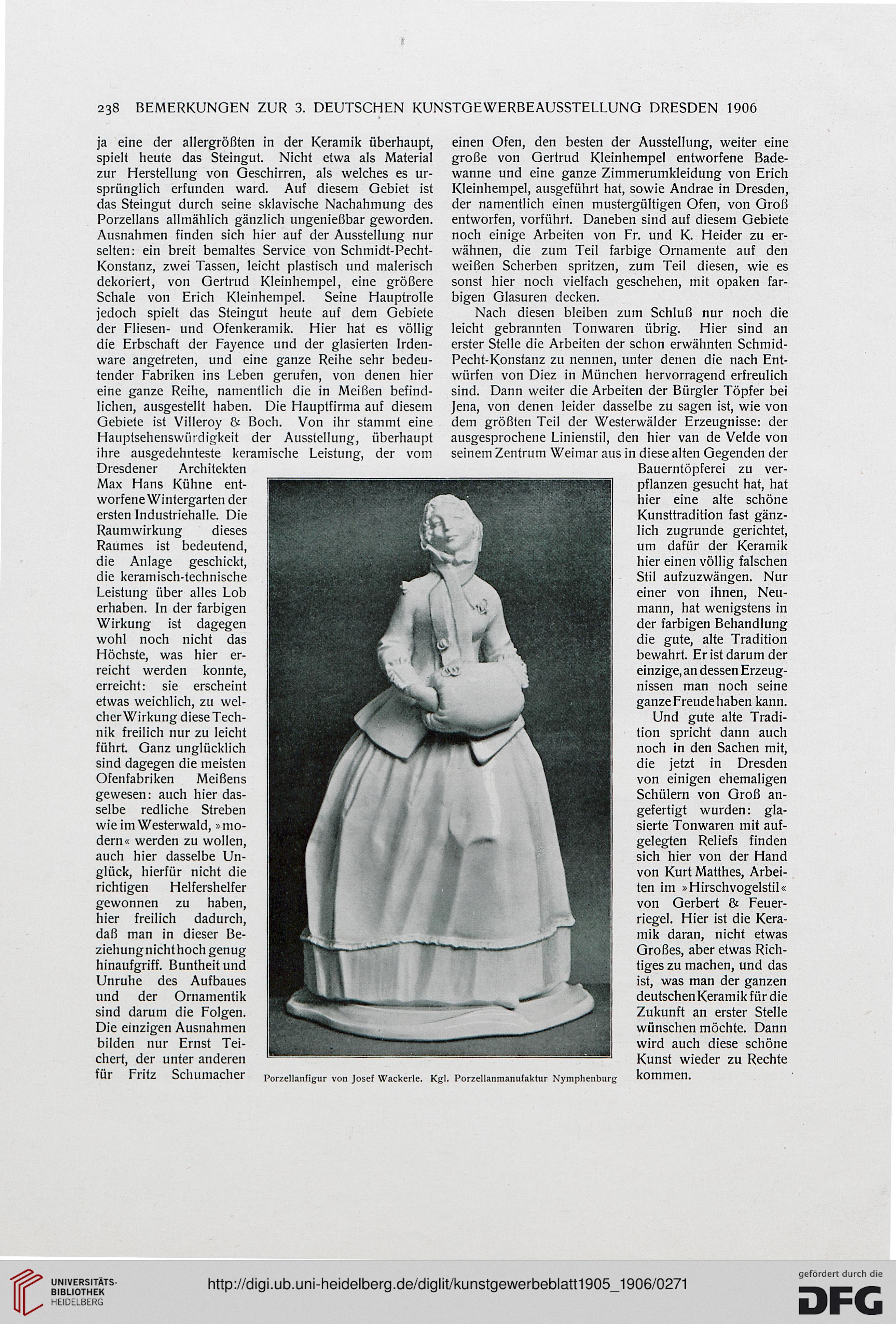238 BEMERKUNGEN ZUR 3. DEUTSCHEN KUNSTGEWERBEAUSSTELLUNG DRESDEN 1906
ja eine der allergrößten in der Keramik überhaupt,
spielt heute das Steingut. Nicht etwa als Material
zur Herstellung von Geschirren, als welches es ur-
sprünglich erfunden ward. Auf diesem Gebiet ist
das Steingut durch seine sklavische Nachahmung des
Porzellans allmählich gänzlich ungenießbar geworden.
Ausnahmen finden sich hier auf der Ausstellung nur
selten: ein breit bemaltes Service von Schmidt-Pecht-
Konstanz, zwei Tassen, leicht plastisch und malerisch
dekoriert, von Gertrud Kleinhempel, eine größere
Schale von Erich Kleinhempel. Seine Hauptrolle
jedoch spielt das Steingut heute auf dem Gebiete
der Fliesen- und Ofenkeramik. Hier hat es völlig
die Erbschaft der Fayence und der glasierten Irden-
ware angetreten, und eine ganze Reihe sehr bedeu-
tender Fabriken ins Leben gerufen, von denen hier
eine ganze Reihe, namentlich die in Meißen befind-
lichen, ausgestellt haben. Die Hauptfirma auf diesem
Gebiete ist Villeroy & Boch. Von ihr stammt eine
Hauptsehenswürdigkeit der Ausstellung, überhaupt
ihre ausgedehnteste keramische Leistung, der vom
Dresdener Architekten
Max Hans Kühne ent-
worfene Wintergarten der
ersten Industriehalle. Die
Raumwirkung dieses
Raumes ist bedeutend,
die Anlage geschickt,
die keramisch-technische
Leistung über alles Lob
erhaben. In der farbigen
Wirkung ist dagegen
wohl noch nicht das
Höchste, was hier er-
reicht werden konnte,
erreicht: sie erscheint
etwas weichlich, zu wel-
cher Wirkung diese Tech-
nik freilich nur zu leicht
führt. Ganz unglücklich
sind dagegen die meisten
Ofenfabriken Meißens
gewesen: auch hier das-
selbe redliche Streben
wieimWesterwald, »mo-
dern« werden zu wollen,
auch hier dasselbe Un-
glück, hierfür nicht die
richtigen Helfershelfer
gewonnen zu haben,
hier freilich dadurch,
daß man in dieser Be-
ziehungnichthoch genug
hinaufgriff. Buntheit und
Unruhe des Aufbaues
und der Ornamentik
sind darum die Folgen.
Die einzigen Ausnahmen
bilden nur Ernst Tei-
chert, der unter anderen
für Fritz Schumacher
■PH
■ i ■>. fj
1
Eh ■£
■
Porzellanfigur von Josef Wackerle. Kgl. Porzellanmanufaktur Nymphenburg
einen Ofen, den besten der Ausstellung, weiter eine
große von Gertrud Kleinhempel entworfene Bade-
wanne und eine ganze Zimmerumkleidung von Erich
Kleinhempel, ausgeführt hat, sowie Andrae in Dresden,
der namentlich einen mustergültigen Ofen, von Groß
entworfen, vorführt. Daneben sind auf diesem Gebiete
noch einige Arbeiten von Fr. und K. Heider zu er-
wähnen, die zum Teil farbige Ornamente auf den
weißen Scherben spritzen, zum Teil diesen, wie es
sonst hier noch vielfach geschehen, mit opaken far-
bigen Glasuren decken.
Nach diesen bleiben zum Schluß nur noch die
leicht gebrannten Tonwaren übrig. Hier sind an
erster Stelle die Arbeiten der schon erwähnten Schmid-
Pecht-Konstanz zu nennen, unter denen die nach Ent-
würfen von Diez in München hervorragend erfreulich
sind. Dann weiter die Arbeiten der Bürgler Töpfer bei
Jena, von denen leider dasselbe zu sagen ist, wie von
dem größten Teil der Westerwälder Erzeugnisse: der
ausgesprochene Linienstil, den hier van de Velde von
seinem Zentrum Weimar aus in diese alten Gegenden der
Bauerntöpferei zu ver-
pflanzen gesucht hat, hat
hier eine alte schöne
Kunsttradition fast gänz-
lich zugrunde gerichtet,
um dafür der Keramik
hier einen völlig falschen
Stil aufzuzwängen. Nur
einer von ihnen, Neu-
mann, hat wenigstens in
der farbigen Behandlung
die gute, alte Tradition
bewahrt. Er ist darum der
einzige, an dessen Erzeug-
nissen man noch seine
ganze Freude haben kann.
Und gute alte Tradi-
tion spricht dann auch
noch in den Sachen mit,
die jetzt in Dresden
von einigen ehemaligen
Schülern von Groß an-
gefertigt wurden: gla-
sierte Tonwaren mit auf-
gelegten Reliefs finden
sich hier von der Hand
von Kurt Matthes, Arbei-
ten im »Hirschvogelstil«
von Gerbert & Feuer-
riegel. Hier ist die Kera-
mik daran, nicht etwas
Großes, aber etwas Rich-
tiges zu machen, und das
ist, was man der ganzen
deutschen Keramik für die
Zukunft an erster Stelle
wünschen möchte. Dann
wird auch diese schöne
Kunst wieder zu Rechte
kommen.
ja eine der allergrößten in der Keramik überhaupt,
spielt heute das Steingut. Nicht etwa als Material
zur Herstellung von Geschirren, als welches es ur-
sprünglich erfunden ward. Auf diesem Gebiet ist
das Steingut durch seine sklavische Nachahmung des
Porzellans allmählich gänzlich ungenießbar geworden.
Ausnahmen finden sich hier auf der Ausstellung nur
selten: ein breit bemaltes Service von Schmidt-Pecht-
Konstanz, zwei Tassen, leicht plastisch und malerisch
dekoriert, von Gertrud Kleinhempel, eine größere
Schale von Erich Kleinhempel. Seine Hauptrolle
jedoch spielt das Steingut heute auf dem Gebiete
der Fliesen- und Ofenkeramik. Hier hat es völlig
die Erbschaft der Fayence und der glasierten Irden-
ware angetreten, und eine ganze Reihe sehr bedeu-
tender Fabriken ins Leben gerufen, von denen hier
eine ganze Reihe, namentlich die in Meißen befind-
lichen, ausgestellt haben. Die Hauptfirma auf diesem
Gebiete ist Villeroy & Boch. Von ihr stammt eine
Hauptsehenswürdigkeit der Ausstellung, überhaupt
ihre ausgedehnteste keramische Leistung, der vom
Dresdener Architekten
Max Hans Kühne ent-
worfene Wintergarten der
ersten Industriehalle. Die
Raumwirkung dieses
Raumes ist bedeutend,
die Anlage geschickt,
die keramisch-technische
Leistung über alles Lob
erhaben. In der farbigen
Wirkung ist dagegen
wohl noch nicht das
Höchste, was hier er-
reicht werden konnte,
erreicht: sie erscheint
etwas weichlich, zu wel-
cher Wirkung diese Tech-
nik freilich nur zu leicht
führt. Ganz unglücklich
sind dagegen die meisten
Ofenfabriken Meißens
gewesen: auch hier das-
selbe redliche Streben
wieimWesterwald, »mo-
dern« werden zu wollen,
auch hier dasselbe Un-
glück, hierfür nicht die
richtigen Helfershelfer
gewonnen zu haben,
hier freilich dadurch,
daß man in dieser Be-
ziehungnichthoch genug
hinaufgriff. Buntheit und
Unruhe des Aufbaues
und der Ornamentik
sind darum die Folgen.
Die einzigen Ausnahmen
bilden nur Ernst Tei-
chert, der unter anderen
für Fritz Schumacher
■PH
■ i ■>. fj
1
Eh ■£
■
Porzellanfigur von Josef Wackerle. Kgl. Porzellanmanufaktur Nymphenburg
einen Ofen, den besten der Ausstellung, weiter eine
große von Gertrud Kleinhempel entworfene Bade-
wanne und eine ganze Zimmerumkleidung von Erich
Kleinhempel, ausgeführt hat, sowie Andrae in Dresden,
der namentlich einen mustergültigen Ofen, von Groß
entworfen, vorführt. Daneben sind auf diesem Gebiete
noch einige Arbeiten von Fr. und K. Heider zu er-
wähnen, die zum Teil farbige Ornamente auf den
weißen Scherben spritzen, zum Teil diesen, wie es
sonst hier noch vielfach geschehen, mit opaken far-
bigen Glasuren decken.
Nach diesen bleiben zum Schluß nur noch die
leicht gebrannten Tonwaren übrig. Hier sind an
erster Stelle die Arbeiten der schon erwähnten Schmid-
Pecht-Konstanz zu nennen, unter denen die nach Ent-
würfen von Diez in München hervorragend erfreulich
sind. Dann weiter die Arbeiten der Bürgler Töpfer bei
Jena, von denen leider dasselbe zu sagen ist, wie von
dem größten Teil der Westerwälder Erzeugnisse: der
ausgesprochene Linienstil, den hier van de Velde von
seinem Zentrum Weimar aus in diese alten Gegenden der
Bauerntöpferei zu ver-
pflanzen gesucht hat, hat
hier eine alte schöne
Kunsttradition fast gänz-
lich zugrunde gerichtet,
um dafür der Keramik
hier einen völlig falschen
Stil aufzuzwängen. Nur
einer von ihnen, Neu-
mann, hat wenigstens in
der farbigen Behandlung
die gute, alte Tradition
bewahrt. Er ist darum der
einzige, an dessen Erzeug-
nissen man noch seine
ganze Freude haben kann.
Und gute alte Tradi-
tion spricht dann auch
noch in den Sachen mit,
die jetzt in Dresden
von einigen ehemaligen
Schülern von Groß an-
gefertigt wurden: gla-
sierte Tonwaren mit auf-
gelegten Reliefs finden
sich hier von der Hand
von Kurt Matthes, Arbei-
ten im »Hirschvogelstil«
von Gerbert & Feuer-
riegel. Hier ist die Kera-
mik daran, nicht etwas
Großes, aber etwas Rich-
tiges zu machen, und das
ist, was man der ganzen
deutschen Keramik für die
Zukunft an erster Stelle
wünschen möchte. Dann
wird auch diese schöne
Kunst wieder zu Rechte
kommen.