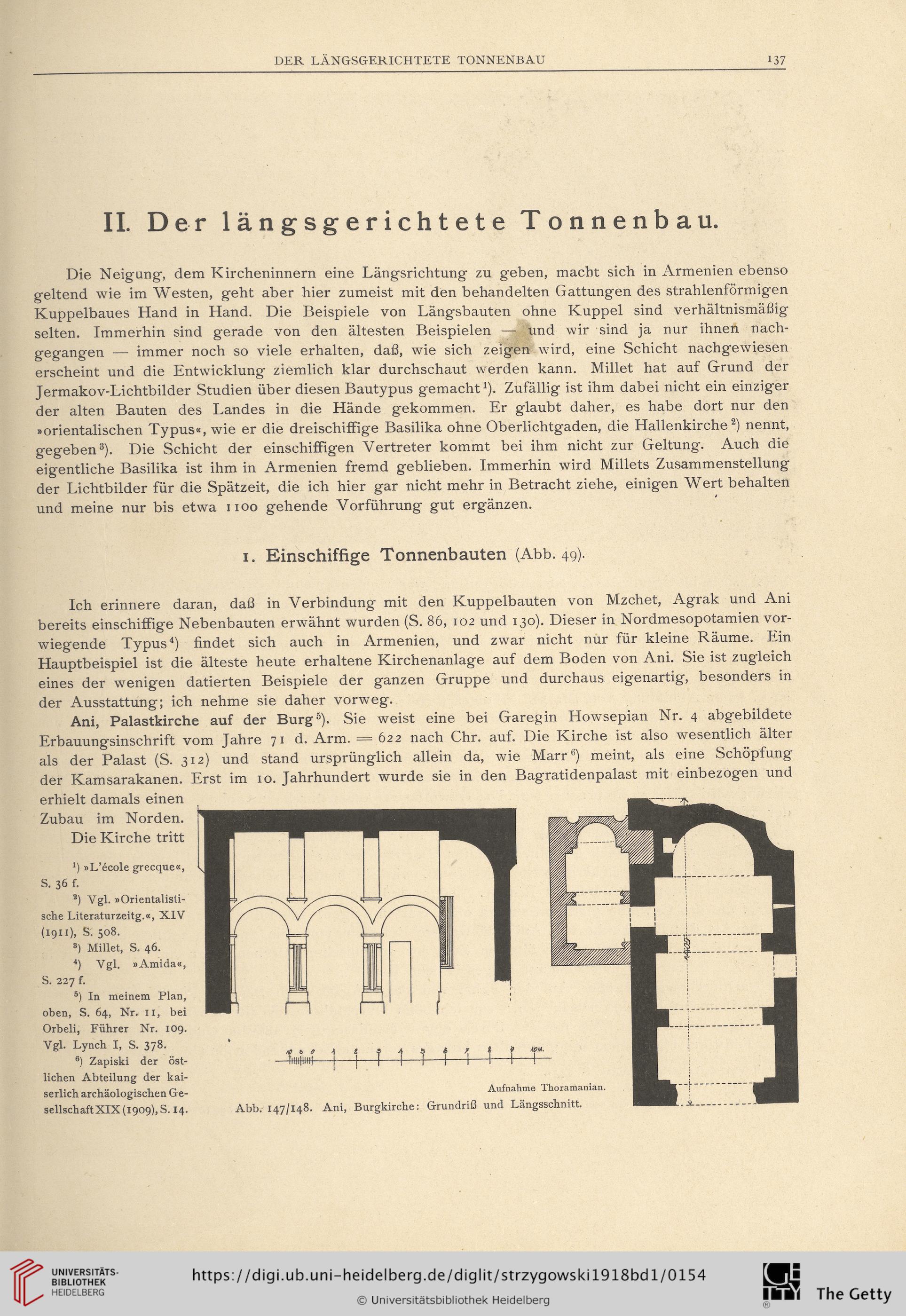DER LÄNGSGERICHTETE TONNENBAU
137
II. Der längsgerichtete Tonnenbau.
Die Neigung, dem Kircheninnern eine Längsrichtung zu geben, macht sich in Armenien ebenso
geltend wie im Westen, geht aber hier zumeist mit den behandelten Gattungen des strahlenförmigen
Kuppelbaues Hand in Hand. Die Beispiele von Längsbauten ohne Kuppel sind verhältnismäßig
selten. Immerhin sind gerade von den ältesten Beispielen — und wir sind ja nur ihnen nach-
gegangen — immer noch so viele erhalten, daß, wie sich zeigen wird, eine Schicht nach gewiesen
erscheint und die Entwicklung ziemlich klar durchschaut werden kann. Millet hat auf Grund der
Jermakov-Lichtbilder Studien über diesen Bautypus gemacht1). Zufällig ist ihm dabei nicht ein einziger
der alten Bauten des Landes in die Hände gekommen. Er glaubt daher, es habe dort nur den
»orientalischen Typus«, wie er die dreischiffige Basilika ohne Oberlichtgaden, die Hallenkirche2) nennt,
gegeben3). Die Schicht der einschiffigen Vertreter kommt bei ihm nicht zur Geltung. Auch die
eigentliche Basilika ist ihm in Armenien fremd geblieben. Immerhin wird Millets Zusammenstellung
der Lichtbilder für die Spätzeit, die ich hier gar nicht mehr in Betracht ziehe, einigen Wert behalten
und meine nur bis etwa 1100 gehende Vorführung gut ergänzen.
1. Einschiffige Tonnenbauten (Abb. 49).
Ich erinnere daran, daß in Verbindung mit den Kuppelbauten von Mzchet, Agrak und Ani
bereits einschiffige Nebenbauten erwähnt wurden (S. 86, 102 und 130). Dieser in Nordmesopotamien vor-
wiegende Typus4) findet sich auch in Armenien, und zwar nicht nur für kleine Räume. Ein
Hauptbeispiel ist die älteste heute erhaltene Kirchenanlage auf dem Boden von Ani. Sie ist zugleich
eines der wenigen datierten Beispiele der ganzen Gruppe und durchaus eigenartig, besonders in
der Ausstattung; ich nehme sie daher vorweg.
Ani, Palastkirche auf der Burg5). Sie weist eine bei Garegin Howsepian Nr. 4 abgebildete
Erbauungsinschrift vom Jahre 71 d. Arm. = 622 nach Chr. auf. Die Kirche ist also wesentlich älter
als der Palast (S. 312) und stand ursprünglich allein da, wie Marr6) meint, als eine Schöpfung
der Kamsarakanen. Erst im 10. Jahrhundert wurde sie in den Bagratidenpalast mit einbezogen und
erhielt damals einen
Zubau im Norden.
Die Kirche tritt
J) »L’ecole grecque«,
S. 36 f.
2) Vgl. »Orientalisti¬
sche Literaturzeitg.«, XIV
(1911), S. 508.
3) Millet, S. 46.
4) Vgl. »Amida«,
S. 227 f.
5) In meinem Plan,
oben, S. 64, Nr. II, bei
Orbeli, Führer Nr. 109.
Vgl. Lynch I, S. 378.
6) Zapiski der öst¬
lichen Abteilung der kai¬
serlich archäologischen Ge¬
sellschaft XIX (1909), S. 14.
Aufnahme Thoramanian.
1. Ani, Burgkirche: Grundriß und Längsschnitt.
137
II. Der längsgerichtete Tonnenbau.
Die Neigung, dem Kircheninnern eine Längsrichtung zu geben, macht sich in Armenien ebenso
geltend wie im Westen, geht aber hier zumeist mit den behandelten Gattungen des strahlenförmigen
Kuppelbaues Hand in Hand. Die Beispiele von Längsbauten ohne Kuppel sind verhältnismäßig
selten. Immerhin sind gerade von den ältesten Beispielen — und wir sind ja nur ihnen nach-
gegangen — immer noch so viele erhalten, daß, wie sich zeigen wird, eine Schicht nach gewiesen
erscheint und die Entwicklung ziemlich klar durchschaut werden kann. Millet hat auf Grund der
Jermakov-Lichtbilder Studien über diesen Bautypus gemacht1). Zufällig ist ihm dabei nicht ein einziger
der alten Bauten des Landes in die Hände gekommen. Er glaubt daher, es habe dort nur den
»orientalischen Typus«, wie er die dreischiffige Basilika ohne Oberlichtgaden, die Hallenkirche2) nennt,
gegeben3). Die Schicht der einschiffigen Vertreter kommt bei ihm nicht zur Geltung. Auch die
eigentliche Basilika ist ihm in Armenien fremd geblieben. Immerhin wird Millets Zusammenstellung
der Lichtbilder für die Spätzeit, die ich hier gar nicht mehr in Betracht ziehe, einigen Wert behalten
und meine nur bis etwa 1100 gehende Vorführung gut ergänzen.
1. Einschiffige Tonnenbauten (Abb. 49).
Ich erinnere daran, daß in Verbindung mit den Kuppelbauten von Mzchet, Agrak und Ani
bereits einschiffige Nebenbauten erwähnt wurden (S. 86, 102 und 130). Dieser in Nordmesopotamien vor-
wiegende Typus4) findet sich auch in Armenien, und zwar nicht nur für kleine Räume. Ein
Hauptbeispiel ist die älteste heute erhaltene Kirchenanlage auf dem Boden von Ani. Sie ist zugleich
eines der wenigen datierten Beispiele der ganzen Gruppe und durchaus eigenartig, besonders in
der Ausstattung; ich nehme sie daher vorweg.
Ani, Palastkirche auf der Burg5). Sie weist eine bei Garegin Howsepian Nr. 4 abgebildete
Erbauungsinschrift vom Jahre 71 d. Arm. = 622 nach Chr. auf. Die Kirche ist also wesentlich älter
als der Palast (S. 312) und stand ursprünglich allein da, wie Marr6) meint, als eine Schöpfung
der Kamsarakanen. Erst im 10. Jahrhundert wurde sie in den Bagratidenpalast mit einbezogen und
erhielt damals einen
Zubau im Norden.
Die Kirche tritt
J) »L’ecole grecque«,
S. 36 f.
2) Vgl. »Orientalisti¬
sche Literaturzeitg.«, XIV
(1911), S. 508.
3) Millet, S. 46.
4) Vgl. »Amida«,
S. 227 f.
5) In meinem Plan,
oben, S. 64, Nr. II, bei
Orbeli, Führer Nr. 109.
Vgl. Lynch I, S. 378.
6) Zapiski der öst¬
lichen Abteilung der kai¬
serlich archäologischen Ge¬
sellschaft XIX (1909), S. 14.
Aufnahme Thoramanian.
1. Ani, Burgkirche: Grundriß und Längsschnitt.