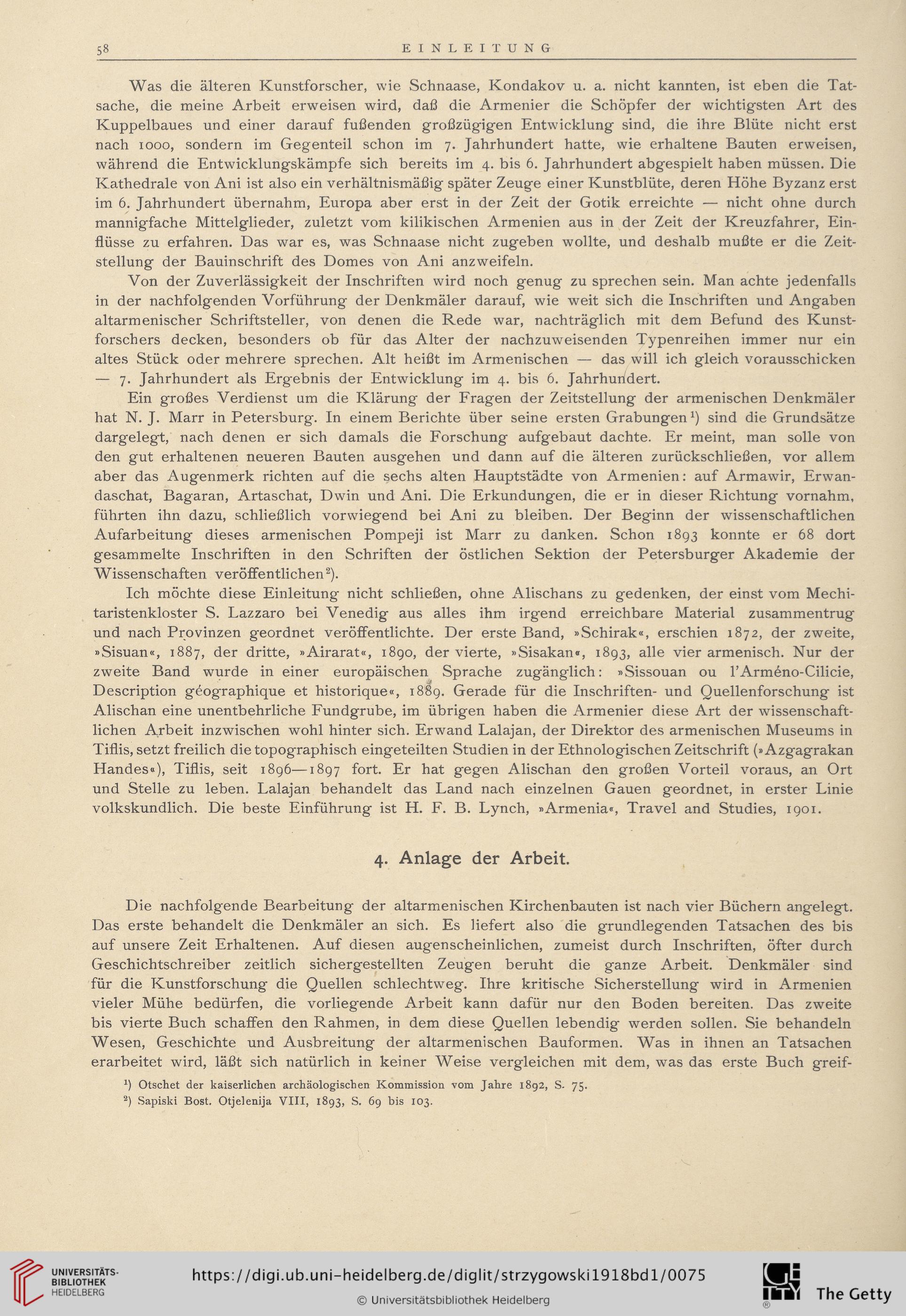$8
EINLEITUNG
Was die älteren Kunstforscher, wie Schnaase, Kondakov u. a. nicht kannten, ist eben die Tat-
sache, die meine Arbeit erweisen wird, daß die Armenier die Schöpfer der wichtigsten Art des
Kuppelbaues und einer darauf fußenden großzügigen Entwicklung sind, die ihre Blüte nicht erst
nach 1000, sondern im Gegenteil schon im 7. Jahrhundert hatte, wie erhaltene Bauten erweisen,
während die Entwicklungskämpfe sich bereits im 4. bis 6. Jahrhundert abgespielt haben müssen. Die
Kathedrale von Ani ist also ein verhältnismäßig später Zeuge einer Kunstblüte, deren Höhe Byzanz erst
im 6. Jahrhundert übernahm, Europa aber erst in der Zeit der Gotik erreichte — nicht ohne durch
mannigfache Mittelglieder, zuletzt vom kilikischen Armenien aus in der Zeit der Kreuzfahrer, Ein-
flüsse zu erfahren. Das war es, was Schnaase nicht zugeben wollte, und deshalb mußte er die Zeit-
stellung der Bauinschrift des Domes von Ani anzweifeln.
Von der Zuverlässigkeit der Inschriften wird noch genug zu sprechen sein. Man achte jedenfalls
in der nachfolgenden Vorführung der Denkmäler darauf, wie weit sich die Inschriften und Angaben
altarmenischer Schriftsteller, von denen die Rede war, nachträglich mit dem Befund des Kunst-
forschers decken, besonders ob für das Alter der nachzuweisenden Typenreihen immer nur ein
altes Stück oder mehrere sprechen. Alt heißt im Armenischen — das will ich gleich vorausschicken
— 7. Jahrhundert als Ergebnis der Entwicklung im 4. bis 6. Jahrhundert.
Ein großes Verdienst um die Klärung der Fragen der Zeitstellung der armenischen Denkmäler
hat N. J. Marr in Petersburg. In einem Berichte über seine ersten Grabungen1) sind die Grundsätze
dargelegt, nach denen er sich damals die Forschung aufgebaut dachte. Er meint, man solle von
den gut erhaltenen neueren Bauten ausgehen und dann auf die älteren zurückschließen, vor allem
aber das Augenmerk richten auf die sechs alten Hauptstädte von Armenien: auf Armawir, Erwan-
daschat, Bagaran, Artaschat, Dwin und Ani. Die Erkundungen, die er in dieser Richtung vornahm,
führten ihn dazu, schließlich vorwiegend bei Ani zu bleiben. Der Beginn der wissenschaftlichen
Aufarbeitung dieses armenischen Pompeji ist Marr zu danken. Schon 1893 konnte er 68 dort
gesammelte Inschriften in den Schriften der östlichen Sektion der Petersburger Akademie der
Wissenschaften veröffentlichen2).
Ich möchte diese Einleitung nicht schließen, ohne Alischans zu gedenken, der einst vom Mechi-
taristenkloster S. Lazzaro bei Venedig aus alles ihm irgend erreichbare Material zusammentrug
und nach Provinzen geordnet veröffentlichte. Der erste Band, »Schirak«, erschien 1872, der zweite,
»Sisuan«, 1887, der dritte, »Airarat«, 1890, der vierte, »Sisakan«, 1893, alle vier armenisch. Nur der
zweite Band wurde in einer europäischen Sprache zugänglich: »Sissouan ou l’Armeno-Cilicie,
Description geographique et historique«, 1889. Gerade für die Inschriften- und Quellenforschung ist
Alischan eine unentbehrliche Fundgrube, im übrigen haben die Armenier diese Art der wissenschaft-
lichen Arbeit inzwischen wohl hinter sich. Erwand Lalajan, der Direktor des armenischen Museums in
Tiflis, setzt freilich die topographisch eingeteilten Studien in der Ethnologischen Zeitschrift (»Azgagrakan
Handes«), Tiflis, seit 1896—1897 fort. Er hat gegen Alischan den großen Vorteil voraus, an Ort
und Stelle zu leben. Lalajan behandelt das Land nach einzelnen Gauen geordnet, in erster Linie
volkskundlich. Die beste Einführung ist H. F. B. Lynch, »Armenia«, Travel and Studies, 1901.
4. Anlage der Arbeit.
Die nachfolgende Bearbeitung der altarmenischen Kirchenbauten ist nach vier Büchern angelegt.
Das erste behandelt die Denkmäler an sich. Es liefert also die grundlegenden Tatsachen des bis
auf unsere Zeit Erhaltenen. Auf diesen augenscheinlichen, zumeist durch Inschriften, öfter durch
Geschichtschreiber zeitlich sichergestellten Zeugen beruht die ganze Arbeit. Denkmäler sind
für die Kunstforschung die Quellen schlechtweg. Ihre kritische Sicherstellung wird in Armenien
vieler Mühe bedürfen, die vorliegende Arbeit kann dafür nur den Boden bereiten. Das zweite
bis vierte Buch schaffen den Rahmen, in dem diese Quellen lebendig werden sollen. Sie behandeln
Wesen, Geschichte und Ausbreitung der altarmenischen Bauformen. Was in ihnen an Tatsachen
erarbeitet wird, läßt sich natürlich in keiner Weise vergleichen mit dem, was das erste Buch greif-
x) Otschet der kaiserlichen archäologischen Kommission vom Jahre 1892, S- 75.
2) Sapiski Bost. Otjelenija VIII, 1893, S. 69 bis 103.
EINLEITUNG
Was die älteren Kunstforscher, wie Schnaase, Kondakov u. a. nicht kannten, ist eben die Tat-
sache, die meine Arbeit erweisen wird, daß die Armenier die Schöpfer der wichtigsten Art des
Kuppelbaues und einer darauf fußenden großzügigen Entwicklung sind, die ihre Blüte nicht erst
nach 1000, sondern im Gegenteil schon im 7. Jahrhundert hatte, wie erhaltene Bauten erweisen,
während die Entwicklungskämpfe sich bereits im 4. bis 6. Jahrhundert abgespielt haben müssen. Die
Kathedrale von Ani ist also ein verhältnismäßig später Zeuge einer Kunstblüte, deren Höhe Byzanz erst
im 6. Jahrhundert übernahm, Europa aber erst in der Zeit der Gotik erreichte — nicht ohne durch
mannigfache Mittelglieder, zuletzt vom kilikischen Armenien aus in der Zeit der Kreuzfahrer, Ein-
flüsse zu erfahren. Das war es, was Schnaase nicht zugeben wollte, und deshalb mußte er die Zeit-
stellung der Bauinschrift des Domes von Ani anzweifeln.
Von der Zuverlässigkeit der Inschriften wird noch genug zu sprechen sein. Man achte jedenfalls
in der nachfolgenden Vorführung der Denkmäler darauf, wie weit sich die Inschriften und Angaben
altarmenischer Schriftsteller, von denen die Rede war, nachträglich mit dem Befund des Kunst-
forschers decken, besonders ob für das Alter der nachzuweisenden Typenreihen immer nur ein
altes Stück oder mehrere sprechen. Alt heißt im Armenischen — das will ich gleich vorausschicken
— 7. Jahrhundert als Ergebnis der Entwicklung im 4. bis 6. Jahrhundert.
Ein großes Verdienst um die Klärung der Fragen der Zeitstellung der armenischen Denkmäler
hat N. J. Marr in Petersburg. In einem Berichte über seine ersten Grabungen1) sind die Grundsätze
dargelegt, nach denen er sich damals die Forschung aufgebaut dachte. Er meint, man solle von
den gut erhaltenen neueren Bauten ausgehen und dann auf die älteren zurückschließen, vor allem
aber das Augenmerk richten auf die sechs alten Hauptstädte von Armenien: auf Armawir, Erwan-
daschat, Bagaran, Artaschat, Dwin und Ani. Die Erkundungen, die er in dieser Richtung vornahm,
führten ihn dazu, schließlich vorwiegend bei Ani zu bleiben. Der Beginn der wissenschaftlichen
Aufarbeitung dieses armenischen Pompeji ist Marr zu danken. Schon 1893 konnte er 68 dort
gesammelte Inschriften in den Schriften der östlichen Sektion der Petersburger Akademie der
Wissenschaften veröffentlichen2).
Ich möchte diese Einleitung nicht schließen, ohne Alischans zu gedenken, der einst vom Mechi-
taristenkloster S. Lazzaro bei Venedig aus alles ihm irgend erreichbare Material zusammentrug
und nach Provinzen geordnet veröffentlichte. Der erste Band, »Schirak«, erschien 1872, der zweite,
»Sisuan«, 1887, der dritte, »Airarat«, 1890, der vierte, »Sisakan«, 1893, alle vier armenisch. Nur der
zweite Band wurde in einer europäischen Sprache zugänglich: »Sissouan ou l’Armeno-Cilicie,
Description geographique et historique«, 1889. Gerade für die Inschriften- und Quellenforschung ist
Alischan eine unentbehrliche Fundgrube, im übrigen haben die Armenier diese Art der wissenschaft-
lichen Arbeit inzwischen wohl hinter sich. Erwand Lalajan, der Direktor des armenischen Museums in
Tiflis, setzt freilich die topographisch eingeteilten Studien in der Ethnologischen Zeitschrift (»Azgagrakan
Handes«), Tiflis, seit 1896—1897 fort. Er hat gegen Alischan den großen Vorteil voraus, an Ort
und Stelle zu leben. Lalajan behandelt das Land nach einzelnen Gauen geordnet, in erster Linie
volkskundlich. Die beste Einführung ist H. F. B. Lynch, »Armenia«, Travel and Studies, 1901.
4. Anlage der Arbeit.
Die nachfolgende Bearbeitung der altarmenischen Kirchenbauten ist nach vier Büchern angelegt.
Das erste behandelt die Denkmäler an sich. Es liefert also die grundlegenden Tatsachen des bis
auf unsere Zeit Erhaltenen. Auf diesen augenscheinlichen, zumeist durch Inschriften, öfter durch
Geschichtschreiber zeitlich sichergestellten Zeugen beruht die ganze Arbeit. Denkmäler sind
für die Kunstforschung die Quellen schlechtweg. Ihre kritische Sicherstellung wird in Armenien
vieler Mühe bedürfen, die vorliegende Arbeit kann dafür nur den Boden bereiten. Das zweite
bis vierte Buch schaffen den Rahmen, in dem diese Quellen lebendig werden sollen. Sie behandeln
Wesen, Geschichte und Ausbreitung der altarmenischen Bauformen. Was in ihnen an Tatsachen
erarbeitet wird, läßt sich natürlich in keiner Weise vergleichen mit dem, was das erste Buch greif-
x) Otschet der kaiserlichen archäologischen Kommission vom Jahre 1892, S- 75.
2) Sapiski Bost. Otjelenija VIII, 1893, S. 69 bis 103.