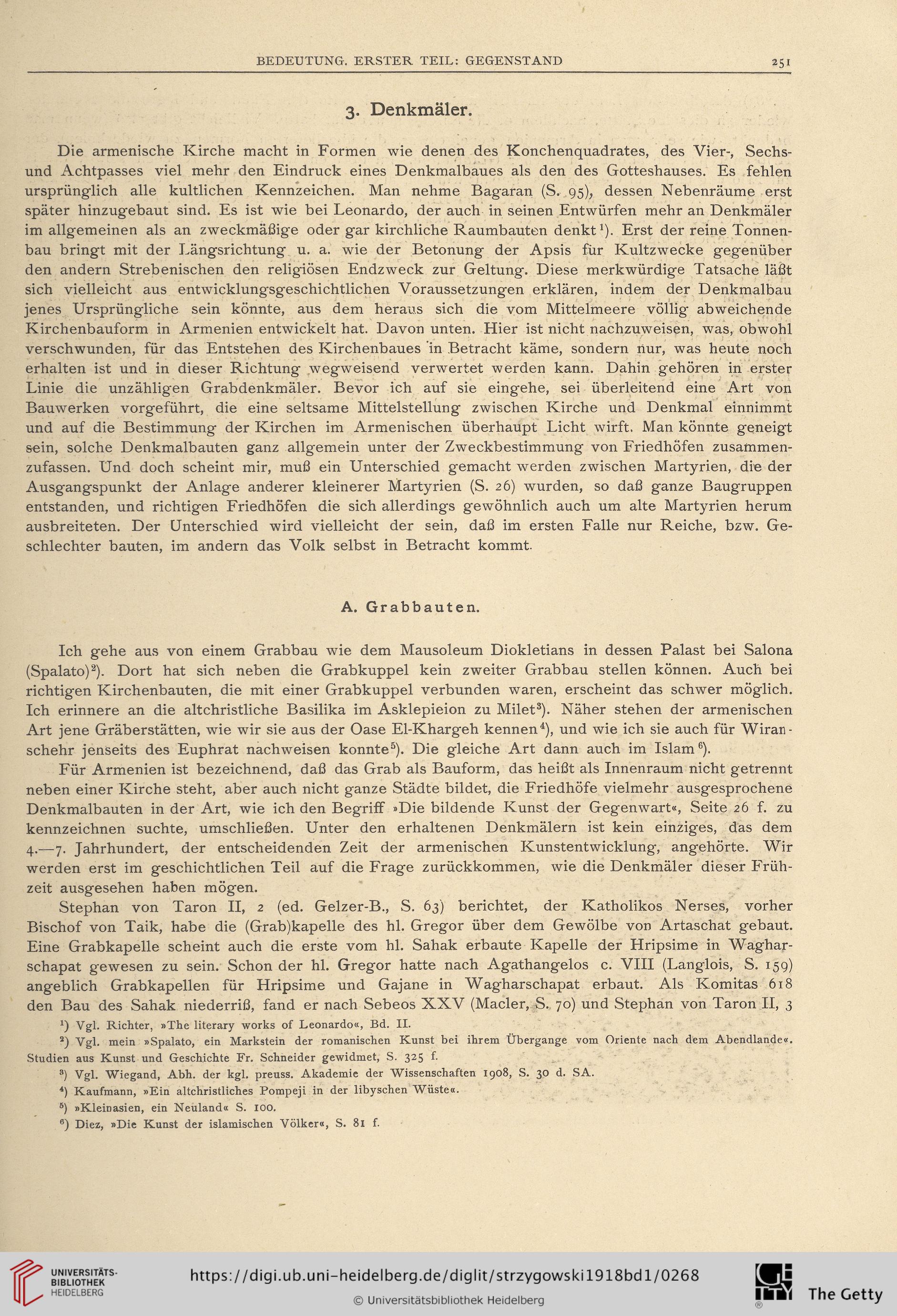BEDEUTUNG. ERSTER TEIL: GEGENSTAND
251
3. Denkmäler.
Die armenische Kirche macht in Formen wie denen des Konchenquadrates, des Vier-, Sechs-
und Achtpasses viel mehr den Eindruck eines Denkmalbaues als den des Gotteshauses. Es fehlen
ursprünglich alle kultlichen Kennzeichen. Man nehme Bagaran (S. 95), dessen Nebenräume erst
später hinzugebaut sind. Es ist wie bei Leonardo, der auch in seinen Entwürfen mehr an Denkmäler
im allgemeinen als an zweckmäßige oder gar kirchliche Raumbauten denkt1). Erst der reine Tonnen-
bau bringt mit der Längsrichtung u. a. wie der Betonung der Apsis für Kultzwecke gegenüber
den andern Strebenischen den religiösen Endzweck zur Geltung. Diese merkwürdige Tatsache läßt
sich vielleicht aus entwicklungsgeschichtlichen Voraussetzungen erklären, indem der Denkmalbau
jenes Ursprüngliche sein könnte, aus dem heraus sich die vom Mittelmeere völlig abweichende
Kirchenbauform in Armenien entwickelt hat. Davon unten. Hier ist nicht nachzuweisen, was, obwohl
verschwunden, für das Entstehen des Kirchenbaues in Betracht käme, sondern nur, was heute noch
erhalten ist und in dieser Richtung wegweisend verwertet werden kann. Dahin gehören in erster
Linie die unzähligen Grabdenkmäler. Bevor ich auf sie eingehe, sei überleitend eine Art von
Bauwerken vorgeführt, die eine seltsame Mittelstellung zwischen Kirche und Denkmal einnimmt
und auf die Bestimmung der Kirchen im Armenischen überhaupt Licht wirft. Man könnte geneigt
sein, solche Denkmalbauten ganz allgemein unter der Zweckbestimmung von Friedhöfen zusammen-
zufassen. Und doch scheint mir, muß ein Unterschied gemacht werden zwischen Martyrien, die der
Ausgangspunkt der Anlage anderer kleinerer Martyrien (S. 26) wurden, so daß ganze Baugruppen
entstanden, und richtigen Friedhöfen die sich allerdings gewöhnlich auch um alte Martyrien herum
ausbreiteten. Der Unterschied wird vielleicht der sein, daß im ersten Falle nur Reiche, bzw. Ge-
schlechter bauten, im andern das Volk selbst in Betracht kommt.
A. Grabbauten.
Ich gehe aus von einem Grabbau wie dem Mausoleum Diokletians in dessen Palast bei Salona
(Spalato)2). Dort hat sich neben die Grabkuppel kein zweiter Grabbau stellen können. Auch bei
richtigen Kirchenbauten, die mit einer Grabkuppel verbunden waren, erscheint das schwer möglich.
Ich erinnere an die altchristliche Basilika im Asklepieion zu Milet3). Näher stehen der armenischen
Art jene Gräber Stätten, wie wir sie aus der Oase El-Khargeh kennen4), und wie ich sie auch für Wiran-
schehr jenseits des Euphrat nachweisen konnte5). Die gleiche Art dann auch im Islam6).
Für Armenien ist bezeichnend, daß das Grab als Bauform, das heißt als Innenraum nicht getrennt
neben einer Kirche steht, aber auch nicht ganze Städte bildet, die Friedhöfe vielmehr ausgesprochene
Denkmalbauten in der Art, wie ich den Begriff »Die bildende Kunst der Gegenwart«, Seite 26 f. zu
kennzeichnen suchte, umschließen. Unter den erhaltenen Denkmälern ist kein einziges, das dem
4.—7. Jahrhundert, der entscheidenden Zeit der armenischen Kunstentwicklung, angehörte. Wir
werden erst im geschichtlichen Teil auf die Frage zurückkommen, wie die Denkmäler dieser Früh-
zeit ausgesehen haben mögen.
Stephan von Taron II, 2 (ed. Gelzer-B., S. 63) berichtet, der Katholikos Nerses, vorher
Bischof von Taik, habe die (Grab)kapelle des hl. Gregor über dem Gewölbe von Artaschat gebaut.
Eine Grabkapelle scheint auch die erste vom hl. Sahak erbaute Kapelle der Hripsime in Waghar-
schapat gewesen zu sein. Schon der hl. Gregor hatte nach Agathangelos c. VIII (Langlois, S. 159)
angeblich Grabkapellen für Hripsime und Gajane in Wagharschapat erbaut. Als Komitas 618
den Bau des Sahak niederriß, fand er nach Sebeos XXV (Macler, S. 70) und Stephan von Taron II, 3
J) Vgl. Richter, »The literary works of Leonardo«, Bd. II.
2) Vgl. mein »Spalato, ein Markstein der romanischen Kunst bei ihrem Übergange vom Oriente nach dem Abendlande«.
Studien aus Kunst und Geschichte Fr. Schneider gewidmet, S. 325 f.
3) Vgl- Wiegand, Abh. der kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften 1908, S. 3° d. SA.
4) Kaufmann, »Ein altchristliches Pompeji in der libyschen Wüste«.
5) »Kleinasien, ein Neuland« S. 100.
6) Diez, »Die Kunst der islamischen Völker«, S. 81 f.
251
3. Denkmäler.
Die armenische Kirche macht in Formen wie denen des Konchenquadrates, des Vier-, Sechs-
und Achtpasses viel mehr den Eindruck eines Denkmalbaues als den des Gotteshauses. Es fehlen
ursprünglich alle kultlichen Kennzeichen. Man nehme Bagaran (S. 95), dessen Nebenräume erst
später hinzugebaut sind. Es ist wie bei Leonardo, der auch in seinen Entwürfen mehr an Denkmäler
im allgemeinen als an zweckmäßige oder gar kirchliche Raumbauten denkt1). Erst der reine Tonnen-
bau bringt mit der Längsrichtung u. a. wie der Betonung der Apsis für Kultzwecke gegenüber
den andern Strebenischen den religiösen Endzweck zur Geltung. Diese merkwürdige Tatsache läßt
sich vielleicht aus entwicklungsgeschichtlichen Voraussetzungen erklären, indem der Denkmalbau
jenes Ursprüngliche sein könnte, aus dem heraus sich die vom Mittelmeere völlig abweichende
Kirchenbauform in Armenien entwickelt hat. Davon unten. Hier ist nicht nachzuweisen, was, obwohl
verschwunden, für das Entstehen des Kirchenbaues in Betracht käme, sondern nur, was heute noch
erhalten ist und in dieser Richtung wegweisend verwertet werden kann. Dahin gehören in erster
Linie die unzähligen Grabdenkmäler. Bevor ich auf sie eingehe, sei überleitend eine Art von
Bauwerken vorgeführt, die eine seltsame Mittelstellung zwischen Kirche und Denkmal einnimmt
und auf die Bestimmung der Kirchen im Armenischen überhaupt Licht wirft. Man könnte geneigt
sein, solche Denkmalbauten ganz allgemein unter der Zweckbestimmung von Friedhöfen zusammen-
zufassen. Und doch scheint mir, muß ein Unterschied gemacht werden zwischen Martyrien, die der
Ausgangspunkt der Anlage anderer kleinerer Martyrien (S. 26) wurden, so daß ganze Baugruppen
entstanden, und richtigen Friedhöfen die sich allerdings gewöhnlich auch um alte Martyrien herum
ausbreiteten. Der Unterschied wird vielleicht der sein, daß im ersten Falle nur Reiche, bzw. Ge-
schlechter bauten, im andern das Volk selbst in Betracht kommt.
A. Grabbauten.
Ich gehe aus von einem Grabbau wie dem Mausoleum Diokletians in dessen Palast bei Salona
(Spalato)2). Dort hat sich neben die Grabkuppel kein zweiter Grabbau stellen können. Auch bei
richtigen Kirchenbauten, die mit einer Grabkuppel verbunden waren, erscheint das schwer möglich.
Ich erinnere an die altchristliche Basilika im Asklepieion zu Milet3). Näher stehen der armenischen
Art jene Gräber Stätten, wie wir sie aus der Oase El-Khargeh kennen4), und wie ich sie auch für Wiran-
schehr jenseits des Euphrat nachweisen konnte5). Die gleiche Art dann auch im Islam6).
Für Armenien ist bezeichnend, daß das Grab als Bauform, das heißt als Innenraum nicht getrennt
neben einer Kirche steht, aber auch nicht ganze Städte bildet, die Friedhöfe vielmehr ausgesprochene
Denkmalbauten in der Art, wie ich den Begriff »Die bildende Kunst der Gegenwart«, Seite 26 f. zu
kennzeichnen suchte, umschließen. Unter den erhaltenen Denkmälern ist kein einziges, das dem
4.—7. Jahrhundert, der entscheidenden Zeit der armenischen Kunstentwicklung, angehörte. Wir
werden erst im geschichtlichen Teil auf die Frage zurückkommen, wie die Denkmäler dieser Früh-
zeit ausgesehen haben mögen.
Stephan von Taron II, 2 (ed. Gelzer-B., S. 63) berichtet, der Katholikos Nerses, vorher
Bischof von Taik, habe die (Grab)kapelle des hl. Gregor über dem Gewölbe von Artaschat gebaut.
Eine Grabkapelle scheint auch die erste vom hl. Sahak erbaute Kapelle der Hripsime in Waghar-
schapat gewesen zu sein. Schon der hl. Gregor hatte nach Agathangelos c. VIII (Langlois, S. 159)
angeblich Grabkapellen für Hripsime und Gajane in Wagharschapat erbaut. Als Komitas 618
den Bau des Sahak niederriß, fand er nach Sebeos XXV (Macler, S. 70) und Stephan von Taron II, 3
J) Vgl. Richter, »The literary works of Leonardo«, Bd. II.
2) Vgl. mein »Spalato, ein Markstein der romanischen Kunst bei ihrem Übergange vom Oriente nach dem Abendlande«.
Studien aus Kunst und Geschichte Fr. Schneider gewidmet, S. 325 f.
3) Vgl- Wiegand, Abh. der kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften 1908, S. 3° d. SA.
4) Kaufmann, »Ein altchristliches Pompeji in der libyschen Wüste«.
5) »Kleinasien, ein Neuland« S. 100.
6) Diez, »Die Kunst der islamischen Völker«, S. 81 f.