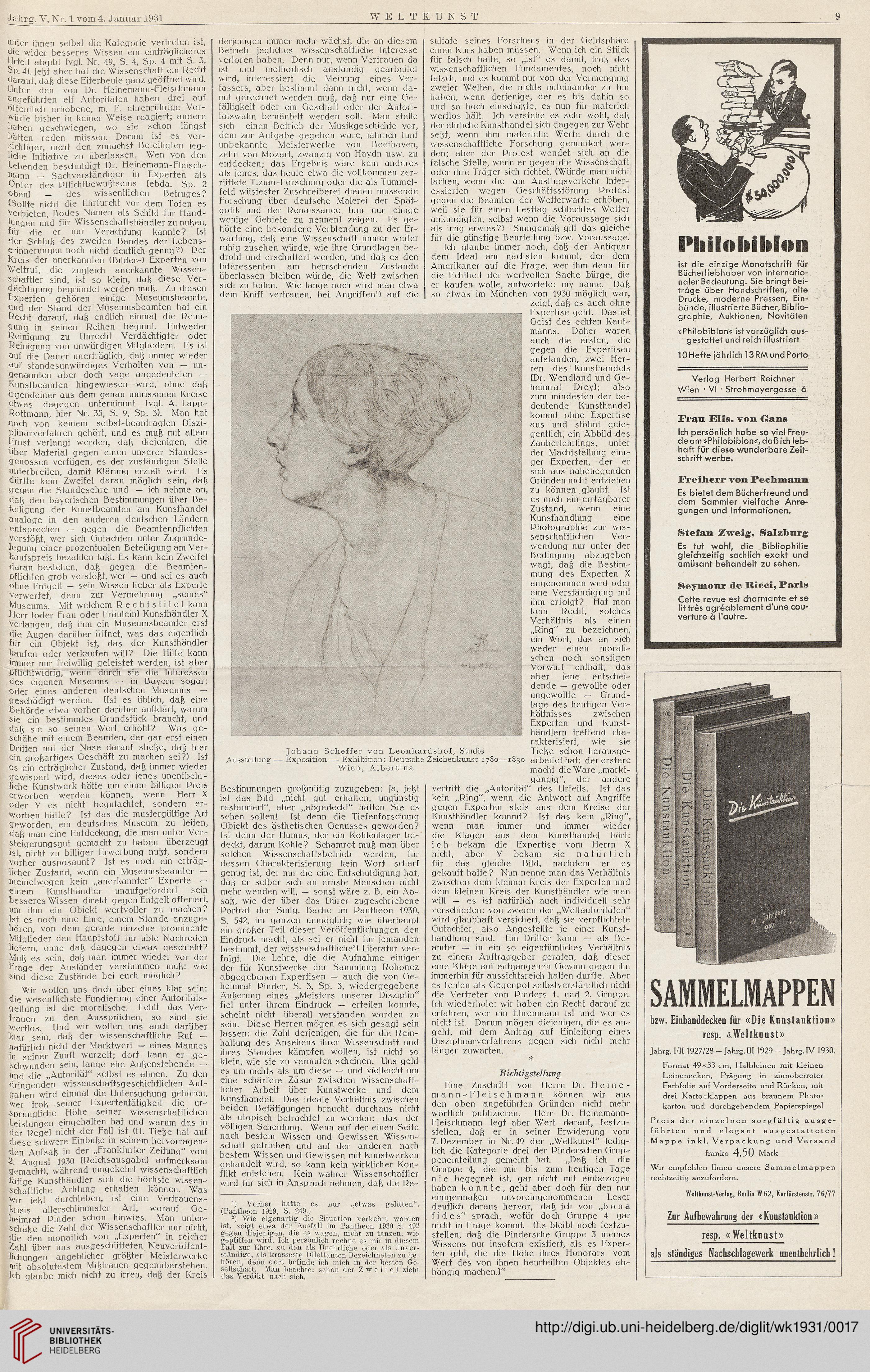Jahrg. V, Nr. 1 vom 4. Januar 1931
WELTKUNST
9
unter ihnen selbst die Kategorie vertreten ist,
die wider besseres Wissen ein einträglicheres
Urteil abgibt (vgl. Nr. 49, S. 4, Sp. 4 mit S. 3,
Sp. 4). Jefet aber hat die Wissenschaft ein Recht
darauf, daß diese Eiterbeule ganz geöffnet wird.
Unter den von Dr. Heinemann-Fleischmann
angeführten elf Autoritäten haben drei auf
öffentlich erhobene, m. E. ehrenrührige Vor-
dürfe bisher in keiner Weise reagiert; andere
haben geschwiegen, wo sie schon längst
hätten reden müssen. Darum ist es vor-
sichtiger, nicht den zunächst Beteiligten jeg-
liche Initiative zu überlassen. Wen von den
Lebenden beschuldigt Dr. Heinemann-Fleisch-
mann — Sachverständiger in Experten als
Opfer des Pflichtbewußtseins (ebda. Sp. 2
oben) — des wissentlichen Betruges?
(Sollte nicht die Ehrfurcht vor dem Toten es
"verbieten, Bodes Namen als Schild für Hand-
lungen und für Wissenschaftshändler zu nußen,
für die er nur Verachtung kannte? Ist
der Schluß des zweiten Bandes der Lebens-
erinnerungen noch nicht deutlich genug?) Der
Kreis der anerkannten (Bilder-) Experten von
Weltruf, die zugleich anerkannte Wissen-
schaftler sind, ist so klein, daß diese Ver-
dächtigung begründet werden muß. Zu diesen
Experten gehören einige Museumsbeamie,
und der Stand der Museumsbeamten hat ein
Recht darauf, daß endlich einmal die Reini-
gung in seinen Reihen beginnt. Entweder
Reinigung zu Unrecht Verdächtigter oder
Reinigung von unwürdigen Mitgliedern. Es ist
auf die Dauer unerträglich, daß immer wieder
auf standesunwürdiges Verhalten von — un-
genannten aber doch vage angedeuteten —
Kunstbeamten hingewiesen wird, ohne daß
irgendeiner aus dem genau umrissenen Kreise
etwas dagegen unternimmt (vgl. A. Lapp-
Rottmann, hier Nr. 35, S. 9, Sp. 3). Man hat
noch von keinem selbst-beantragten Diszi-
plinarverfahren gehört, und es muß mit allem
Ernst verlangt werden, daß diejenigen, die
über Material gegen einen unserer Standes-
genossen verfügen, es der zuständigen Stelle
unterbreiten, damit Klärung erzielt wird. Es
dürfte kein Zweifel daran möglich sein, daß
gegen die Standesehre und — ich nehme an,
daß den bayerischen Bestimmungen über Be-
teiligung der Kunstbeamten am Kunsthandel
analoge in den anderen deutschen Ländern
entsprechen — gegen die Beamtenpflichten
verstößt, wer sich Gutachten unter Zugrunde-
legung einer prozentualen Beteiligung am Ver-
kaufspreis bezahlen läßt. Es kann kein Zweifel
daran bestehen, daß gegen die Beamten-
pflichten grob verstößt, wer — und sei es auch
ohne Entgelt — sein Wissen lieber als Experte
Verwertet, denn zur Vermehrung „seines"
Museums. Mit welchem R e c h t s t i t e 1 kann
Herr (oder Frau oder Fräulein) Kunsthändler X
verlangen, daß ihm ein Museumsbeamter erst
die Augen darüber öffnet, was das eigentlich
für ein Objekt ist, das der Kunsthändler
kaufen oder verkaufen will? Die Hilfe kann
immer nur freiwillig geleistet werden, ist aber
Pflichtwidrig, wenn durch sie die Interessen
des eigenen Museums — in Bayern sogar:
oder eines anderen deutschen Museums —
geschädigt werden. (Ist es üblich, daß eine
Behörde etwa vorher darüber aufklärt, warum
sie ein bestimmtes Grundstück braucht, und
daß sie so seinen Wert erhöht? Was ge-
schähe mit einem Beamten, der gar erst einen
Dritten mit der Nase darauf stieße, daß hier
ein großartiges Geschäft zu machen sei?) Ist
es ein erträglicher Zustand, daß immer wieder
gewispert wird, dieses oder jenes unentbehr-
liche Kunstwerk hätte um einen billigen Preis
erworben werden können, wenn Herr X
oder y es nicht begutachtet, sondern er-
worben hätte? Ist das die mustergültige Art
geworden, ein deutsches Museum zu leiten,
daß man eine Entdeckung, die man unter Ver-
steigerungsgut gemacht zu haben überzeugt
ist, nicht zu billiger Erwerbung nußt, sondern
vorher ausposaunt? Ist es noch ein erträg-
licher Zustand, wenn ein Museumsbeamter —
meinetwegen kein „anerkannter“ Experte —
einem Kunsthändler unaufgefordert sein
besseres Wissen direkt gegen Entgelt offeriert,
um ihm ein Objekt wertvoller zu machen?
Ist es noch eine Ehre, einem Stande anzuge-
hören, von dem gerade einzelne prominente
Mitglieder den Hauptstoff für üble Nachreden
liefern, ohne daß dagegen etwas geschieht?
Muß es sein, daß man immer wieder vor der
Frage der Ausländer verstummen muß: wie
sind diese Zustände bei euch möglich?
Wir wollen uns doch über eines klar sein:
die wesentlichste Fundierung einer Autoritäts-
geltung ist die moralische. Fehlt das Ver-
trauen zu den Aussprüchen, so sind sie
Wertlos. Und wir wollen uns auch darüber
klar sein, daß der wissenschaftliche Ruf —
natürlich nicht der Marktwert — eines Mannes
in seiner Zunft wurzelt; dort kann er ge-
schwunden sein, lange ehe Außenstehende —
Und die „Autorität“ selbst es ahnen. Zu den
dringenden wissenschaftsgeschichtlichen Auf-
gaben wird einmal die Untersuchung gehören.
Wer troß seiner Expertentätigkeif die ur-
sprüngliche Höhe seiner wissenschaftlichen
Leistungen eingehalfen hat und warum das in
der Regel nicht der Fall ist (H. Tieße hat auf
diese schwere Einbuße in seinem hervorragen-
den Aufsaß in der „Frankfurter Zeitung“ vom
2. August 1930 (Reichsausgabe) aufmerksam
gemacht), während umgekehrt wissenschaftlich
tätige Kunsthändler sich die höchste wissen-
schaftliche Achtung erhalten können. Was
Wir jeßt durchleben, ist eine Vertrauens-
krisis allerschlimmster Art, worauf Ge-
heimrat Pinder schon hinwies. Man unter-
schäße die Zahl der Wissenschaftler nur nicht,
die den monatlich von „Experten“ in reicher
Zahl über uns ausgeschütteten Neuveröffent-
lichungen angeblicher größter Meisterwerke
mit absolutestem Mißtrauen gegenüberstehen.
Ich glaube mich nicht zu irren, daß der Kreis
*
4 gar
festzu-
meines
Exper-
eine
eine
wis-
Ver-
kommt?
immer
aus
die
y
derjenigen immer mehr wächst, die an diesem
Betrieb jegliches wissenschaftliche Interesse
verloren haben. Denn nur, wenn Vertrauen da
ist und methodisch anständig gearbeitet
wird, interessiert die Meinung eines Ver-
fassers, aber bestimmt dann nicht, wenn da-
mit gerechnet werden muß, daß nur eine Ge-
fälligkeit oder ein Geschäft oder der Autori-
tätswahn bemäntelt werden soll. Man stelle
sich einen Betrieb der Musikgeschichte vor,
dem zur Aufgabe gegeben wäre, jährlich fünf
unbekannte Meisterwerke von Beethoven,
zehn von Mozart, zwanzig von Haydn usw. zu
entdecken; das Ergebnis wäre kein anderes
als jenes, das heute etwa die vollkommen zer-
rüttete Tizian-Forschung oder die als Tummel-
feld wüstester Zuschreiberei dienen müssende
Forschung über deutsche Malerei der Spät-
gotik und der Renaissance (um nur einige
wenige Gebiete zu nennen) zeigen. Es ge-
hörte eine besondere Verblendung zu der Er-
wartung, daß eine Wissenschaft immer weiter
ruhig zusehen würde, wie ihre Grundlagen be-
droht und erschüttert werden, und daß es den
Interessenten am herrschenden Zustande
überlassen bleiben würde, die Welt zwischen
sich zu teilen. Wie lange noch wird man etwa
dem Kniff vertrauen, bei Angriffen1) auf die
sulfate seines Forschens in der Geldsphäre
einen Kurs haben müssen. Wenn ich ein Stück
für falsch halte, so „ist“ es damit, troß des
wissenschaftlichen Fundamentes, noch nicht
falsch, und es kommt nur von der Vermengung
zweier Welten, die nichts miteinander zu tun
haben, wenn derjenige, der es bis dahin so
und so hoch einschäßte, es nun für materiell
wertlos hält. Ich verstehe es sehr wohl, daß
der ehrliche Kunsthandel sich dagegen zur Wehr
seßt, wenn ihm materielle Werte durch die
wissenschaftliche Forschung gemindert wer-
den; aber der Protest wendet sich an die
falsche Stelle, wenn er gegen die Wissenschaft
oder ihre Träger sich richtet. (Würde man nicht
lachen, wenn die am Ausflugsverkehr Inter-
essierten wegen Geschäftsstörung Protest
gegen die Beamten der Wetterwarte erhöben,
weil sie für einen Festtag schlechtes Wetter
ankündigten, selbst wenn die Voraussage sich
als irrig erwies?) Sinngemäß gilt das gleiche
für die günstige Beurteilung bzw. Voraussage.
Ich glaube immer noch, daß der Antiguar
dem Ideal am nächsten kommt, der dem
Amerikaner auf die Frage, wer ihm denn für
die Echtheit der wertvollen Sache bürge, die
er kaufen wolle, antwortete: my name. Daß
so etwas im München von 1930 möglich war,
zeigt, daß es auch ohne
Expertise geht. Das ist
Geist des echten Kauf-
manns. Daher waren
auch die ersten, die
gegen die Expertisen
aufstanden, zwei Her-
ren des Kunsthandels
(Dr. Wendland und Ge-
heimrat Drey); also
zum mindesten der be-
deutende Kunsthandel
kommt ohne Expertise
aus und stöhnt gele-
gentlich, ein Abbild des
Zauberlehrlings, unter
der Machtstellung eini-
ger Experten, der er
sich aus naheliegenden
Gründen nicht entziehen
zu können glaubt. Ist
es noch ein erriagbarer
Zustand, wenn
Kunsthandlung
Photographie zur
senschaftlichen
Wendung nur unter der
Bedingung abzugeben
wagt, daß die Bestim-
mung des Experten X
angenommen wird oder
eine Verständigung mit
ihm erfolgt? Hat man
kein Recht, solches
Verhältnis als einen
„Ring“ zu bezeichnen,
ein Wort, das an sich
weder einen morali-
schen noch sonstigen
Vorwurf enthält, das
aber jene entschei-
dende — gewollte oder
ungewollte — Grund-
lage des heutigen Ver-
hältnisses zwischen
Experten und Kunst-
händlern treffend cha-
rakterisiert, wie sie
Tieße schon herausge-
arbeitethat: der erstere
macht die Ware „markt-
gängig“, der andere
des Urteils. Ist das
Antwort auf Angriffe
aus dem Kreise der
Ist das kein „Ring“,
und immer wieder
dem Kunsthandel hört:
Expertise vom Herrn X
bekam sie natürlich
Bild, nachdem er es
x) Vorher hatte es nur „etwas gelitten“.
(Pantheon 1929, S. 249.)
2) Wie eigenartig die Situation verkehrt worden
ist, zeigt etwa der Ausfall im Pantheon 1930 S. 492
gegen diejenigen, die es wagen, nicht zu tanzen, wie
gepfiffen wird. Ich persönlich rechne es mir in diesem
Fall zur Ehre, zu den als Unehrliche oder als Unver-
ständige, als krasseste Dilettanten Bezeichneten zu ge-
hören, denn dort befinde ich mich in der besten Ge-
sellschaft. Man beachte: schon der Zweifel zieht
das Verdikt nach sich.
Bestimmungen großmütig zuzugeben: Ja, jeßt
ist das Bild „nicht gut erhalten, ungünstig
restauriert", aber „abgedeckt“ hätten Sie es
sehen sollen! Ist denn die Tiefenforschung
Objekt des ästhetischen Genusses geworden?
Ist denn der Humus, der ein Kohlenlager be-
deckt, darum Kohle? Schamrot muß man über
solchen Wissenschaftsbetrieb werden, für
dessen Charakterisierung kein Wort scharf
genug ist, der nur die eine Entschuldigung hat,
daß er selber sich an ernste Menschen nicht
mehr wenden will, — sonst wäre z. B. ein Ab-
saß, wie der über das Dürer zugeschriebene
Porträt der Smlg. Bache im Pantheon 1930,
S. 542, im ganzen unmöglich; wie überhaupt
ein großer Teil dieser Veröffentlichungen den
Eindruck macht, als sei er nicht für jemanden
bestimmt, der wissenschaftliche2) Literatur ver-
folgt. Die Lehre, die die Aufnahme einiger
der für Kunstwerke der Sammlung Rohoncz
abgegebenen Expertisen — auch die von Ge-
heimrat Pinder, S. 3, Sp. 3, wiedergegebene
Äußerung eines „Meisters unserer Disziplin“
fiel unter ihrem Eindruck — erteilen konnte,
scheint nicht überall verstanden worden zu
sein. Diese Herren mögen es sich gesagt sein
lassen: die Zahl derjenigen, die für die Rein-
haltung des Ansehens ihrer Wissenschaft und
ihres Standes kämpfen wollen, ist nicht so
klein, wie sie zu vermuten scheinen. Uns geht
es um nichts als um diese — und vielleicht um
eine schärfere Zäsur zwischen wissenschaft-
licher Arbeit über Kunstwerke und dem
Kunsthandel. Das ideale Verhältnis zwischen
beiden Betätigungen braucht durchaus nicht
als utopisch betrachtet zu werden: das der
völligen Scheidung. Wenn auf der einen Seite
nach bestem, Wissen und Gewissen Wissen-
schaft getrieben und auf der anderen nach
bestem Wissen und Gewissen mit Kunstwerken
gehandelt wird, so kann kein wirklicher Kon-
flikt entstehen. Kein wahrer Wissenschaftler
wird für sich in Anspruch nehmen, daß die Re-
Johann Scheffer von Leonhardshof, Studie
Ausstellung — Exposition — Exhibition: Deutsche Zeichenkunst 1780—1830
Wien, Albertina
Richtigstellung
Eine Zuschrift von Herrn Dr. Heine-
mann-Fleischmann können wir aus
den oben angeführten Gründen nicht mehr
wörtlich publizieren. Herr Dr. Heinemann-
Fleischmann legt aber Wert darauf, festzu-
stellen, daß er in seiner Erwiderung vom
7. Dezember in Nr. 49 der „Weltkunst“ ledig-
lich die Kategorie drei der Pinderschen Grup-
peneinteilung gemeint hat. „Daß ich die
Gruppe 4, die mir bis zum heutigen Tage
n i e begegnet ist, gar nicht mit einbezogen
haben konnte, geht aber doch für den nur
einigermaßen unvoreingenommenen Leser
deutlich daraus hervor, daß ich von „bona
fides“ sprach, wofür doch Gruppe
nicht in Frage kommt. (Es bleibt noch
stellen, daß die Pindersche Gruppe 3
Wissens nur insofern existiert, als es
ten gibt, die die Höhe ihres Honorars vom
Wert des von ihnen beurteilten Objektes ab-
hängig machen.)“
vertritt die „Autorität“
kein „Ring“, wenn die
gegen Experten stets
Kunsthändler
wenn man
die Klagen
i c h bekam
nicht, aber
für das gleiche
gekauft hafte? Nun nenne man das Verhältnis
zwischen dem kleinen Kreis der Experten und
dem kleinen Kreis der Kunsthändler wie man
will — es ist natürlich auch individuell sehr
verschieden: von zweien der „Weltautoritäten“
wird glaubhaft versichert, daß sie verpflichtete
Gutachter, also Angestellte je einer Kunst-
handlung sind. Ein Dritter kann — als Be-
amter — in ein so eigentümliches Verhältnis
zu einem Auftraggeber geraten, daß dieser
eine Klage auf entgangenen Gewinn gegen ihn
immerhin für aussichtsreich halten durfte. Aber
es fehlen als Gegenpol selbstverständlich nicht
die Vertreter von Pinders 1. und 2. Gruppe.
Ich wiederhole: wir haben ein Recht darauf zu
erfahren, wer ein Ehrenmann ist und wer es
nicht ist. Darum mögen diejenigen, die es an-
geht, mit dem Antrag auf Einleitung eines
Disziplinarverfahrens gegen sich nicht mehr
länger zuwarten.
Pliilobiblon
ist die einzige Monatschrift für
Bücherliebhaber von internatio-
naler Bedeutung. Sie bringt Bei-
träge über Handschriften, alte
Drucke, moderne Pressen, Ein-
bände, illustrierte Bücher, Biblio-
graphie, Auktionen, Novitäten
»Philobiblon« ist vorzüglich aus-
gestattet und reich illustriert
10 Hefte jährlich 13 RM und Porto
Verlag Herbert Reichner
Wien • VI • Strohmayergasse 6
Frau Elis, von Gans
Ich persönlich habe so viel Freu-
deam»Philobiblon«,daßich leb-
haft für diese wunderbare Zeit-
schrift werbe.
Freiherr von Pechmann
Es bietet dem Bücherfreund und
dem Sammler vielfache Anre-
gungen und Informationen.
Stefan Zweig, Salzburg
Es tut wohl, die Bibliophilie
gleichzeitig sachlich exakt und
amüsant behandelt zu sehen.
Seymour de Bicci, Paris
Cette revue est charmante et se
lit tres agreablement d'une Cou-
verture d l’autre.
SAMMELMAPPEN
bzw. Einbanddecken für «Die Kunstauktion»
resp. «Weltkunst»
Jahrg. I/II 1927/28 — Jahrg. III 1929 - Jahrg. IV 1930.
Format 49><33 cm, Halbleinen mit kleinen
Leinenecken, Prägung in zinnoberroter
Farbfolie auf Vorderseite und Rücken, mit
drei Karton klappen aus braunem Photo-
karton und durchgehendem Papierspiegel
Preis der einzelnen sorgfältig ausge-
führten und elegant ausgesta 11 eten
Mappe inkl. Verpackung und Versand
franko 4.50 Mark
Wir empfehlen Ihnen unsere Sammelmappen
rechtzeitig anzufordern.
Weltkunst-Verlag, Beilin W62, Kurfürstenstr. 76/77
Zur Aufbewahrung der «Kunstauktion»
resp. «Weltkunst»
als ständiges Nachschlagewerk unentbehrlicb!
WELTKUNST
9
unter ihnen selbst die Kategorie vertreten ist,
die wider besseres Wissen ein einträglicheres
Urteil abgibt (vgl. Nr. 49, S. 4, Sp. 4 mit S. 3,
Sp. 4). Jefet aber hat die Wissenschaft ein Recht
darauf, daß diese Eiterbeule ganz geöffnet wird.
Unter den von Dr. Heinemann-Fleischmann
angeführten elf Autoritäten haben drei auf
öffentlich erhobene, m. E. ehrenrührige Vor-
dürfe bisher in keiner Weise reagiert; andere
haben geschwiegen, wo sie schon längst
hätten reden müssen. Darum ist es vor-
sichtiger, nicht den zunächst Beteiligten jeg-
liche Initiative zu überlassen. Wen von den
Lebenden beschuldigt Dr. Heinemann-Fleisch-
mann — Sachverständiger in Experten als
Opfer des Pflichtbewußtseins (ebda. Sp. 2
oben) — des wissentlichen Betruges?
(Sollte nicht die Ehrfurcht vor dem Toten es
"verbieten, Bodes Namen als Schild für Hand-
lungen und für Wissenschaftshändler zu nußen,
für die er nur Verachtung kannte? Ist
der Schluß des zweiten Bandes der Lebens-
erinnerungen noch nicht deutlich genug?) Der
Kreis der anerkannten (Bilder-) Experten von
Weltruf, die zugleich anerkannte Wissen-
schaftler sind, ist so klein, daß diese Ver-
dächtigung begründet werden muß. Zu diesen
Experten gehören einige Museumsbeamie,
und der Stand der Museumsbeamten hat ein
Recht darauf, daß endlich einmal die Reini-
gung in seinen Reihen beginnt. Entweder
Reinigung zu Unrecht Verdächtigter oder
Reinigung von unwürdigen Mitgliedern. Es ist
auf die Dauer unerträglich, daß immer wieder
auf standesunwürdiges Verhalten von — un-
genannten aber doch vage angedeuteten —
Kunstbeamten hingewiesen wird, ohne daß
irgendeiner aus dem genau umrissenen Kreise
etwas dagegen unternimmt (vgl. A. Lapp-
Rottmann, hier Nr. 35, S. 9, Sp. 3). Man hat
noch von keinem selbst-beantragten Diszi-
plinarverfahren gehört, und es muß mit allem
Ernst verlangt werden, daß diejenigen, die
über Material gegen einen unserer Standes-
genossen verfügen, es der zuständigen Stelle
unterbreiten, damit Klärung erzielt wird. Es
dürfte kein Zweifel daran möglich sein, daß
gegen die Standesehre und — ich nehme an,
daß den bayerischen Bestimmungen über Be-
teiligung der Kunstbeamten am Kunsthandel
analoge in den anderen deutschen Ländern
entsprechen — gegen die Beamtenpflichten
verstößt, wer sich Gutachten unter Zugrunde-
legung einer prozentualen Beteiligung am Ver-
kaufspreis bezahlen läßt. Es kann kein Zweifel
daran bestehen, daß gegen die Beamten-
pflichten grob verstößt, wer — und sei es auch
ohne Entgelt — sein Wissen lieber als Experte
Verwertet, denn zur Vermehrung „seines"
Museums. Mit welchem R e c h t s t i t e 1 kann
Herr (oder Frau oder Fräulein) Kunsthändler X
verlangen, daß ihm ein Museumsbeamter erst
die Augen darüber öffnet, was das eigentlich
für ein Objekt ist, das der Kunsthändler
kaufen oder verkaufen will? Die Hilfe kann
immer nur freiwillig geleistet werden, ist aber
Pflichtwidrig, wenn durch sie die Interessen
des eigenen Museums — in Bayern sogar:
oder eines anderen deutschen Museums —
geschädigt werden. (Ist es üblich, daß eine
Behörde etwa vorher darüber aufklärt, warum
sie ein bestimmtes Grundstück braucht, und
daß sie so seinen Wert erhöht? Was ge-
schähe mit einem Beamten, der gar erst einen
Dritten mit der Nase darauf stieße, daß hier
ein großartiges Geschäft zu machen sei?) Ist
es ein erträglicher Zustand, daß immer wieder
gewispert wird, dieses oder jenes unentbehr-
liche Kunstwerk hätte um einen billigen Preis
erworben werden können, wenn Herr X
oder y es nicht begutachtet, sondern er-
worben hätte? Ist das die mustergültige Art
geworden, ein deutsches Museum zu leiten,
daß man eine Entdeckung, die man unter Ver-
steigerungsgut gemacht zu haben überzeugt
ist, nicht zu billiger Erwerbung nußt, sondern
vorher ausposaunt? Ist es noch ein erträg-
licher Zustand, wenn ein Museumsbeamter —
meinetwegen kein „anerkannter“ Experte —
einem Kunsthändler unaufgefordert sein
besseres Wissen direkt gegen Entgelt offeriert,
um ihm ein Objekt wertvoller zu machen?
Ist es noch eine Ehre, einem Stande anzuge-
hören, von dem gerade einzelne prominente
Mitglieder den Hauptstoff für üble Nachreden
liefern, ohne daß dagegen etwas geschieht?
Muß es sein, daß man immer wieder vor der
Frage der Ausländer verstummen muß: wie
sind diese Zustände bei euch möglich?
Wir wollen uns doch über eines klar sein:
die wesentlichste Fundierung einer Autoritäts-
geltung ist die moralische. Fehlt das Ver-
trauen zu den Aussprüchen, so sind sie
Wertlos. Und wir wollen uns auch darüber
klar sein, daß der wissenschaftliche Ruf —
natürlich nicht der Marktwert — eines Mannes
in seiner Zunft wurzelt; dort kann er ge-
schwunden sein, lange ehe Außenstehende —
Und die „Autorität“ selbst es ahnen. Zu den
dringenden wissenschaftsgeschichtlichen Auf-
gaben wird einmal die Untersuchung gehören.
Wer troß seiner Expertentätigkeif die ur-
sprüngliche Höhe seiner wissenschaftlichen
Leistungen eingehalfen hat und warum das in
der Regel nicht der Fall ist (H. Tieße hat auf
diese schwere Einbuße in seinem hervorragen-
den Aufsaß in der „Frankfurter Zeitung“ vom
2. August 1930 (Reichsausgabe) aufmerksam
gemacht), während umgekehrt wissenschaftlich
tätige Kunsthändler sich die höchste wissen-
schaftliche Achtung erhalten können. Was
Wir jeßt durchleben, ist eine Vertrauens-
krisis allerschlimmster Art, worauf Ge-
heimrat Pinder schon hinwies. Man unter-
schäße die Zahl der Wissenschaftler nur nicht,
die den monatlich von „Experten“ in reicher
Zahl über uns ausgeschütteten Neuveröffent-
lichungen angeblicher größter Meisterwerke
mit absolutestem Mißtrauen gegenüberstehen.
Ich glaube mich nicht zu irren, daß der Kreis
*
4 gar
festzu-
meines
Exper-
eine
eine
wis-
Ver-
kommt?
immer
aus
die
y
derjenigen immer mehr wächst, die an diesem
Betrieb jegliches wissenschaftliche Interesse
verloren haben. Denn nur, wenn Vertrauen da
ist und methodisch anständig gearbeitet
wird, interessiert die Meinung eines Ver-
fassers, aber bestimmt dann nicht, wenn da-
mit gerechnet werden muß, daß nur eine Ge-
fälligkeit oder ein Geschäft oder der Autori-
tätswahn bemäntelt werden soll. Man stelle
sich einen Betrieb der Musikgeschichte vor,
dem zur Aufgabe gegeben wäre, jährlich fünf
unbekannte Meisterwerke von Beethoven,
zehn von Mozart, zwanzig von Haydn usw. zu
entdecken; das Ergebnis wäre kein anderes
als jenes, das heute etwa die vollkommen zer-
rüttete Tizian-Forschung oder die als Tummel-
feld wüstester Zuschreiberei dienen müssende
Forschung über deutsche Malerei der Spät-
gotik und der Renaissance (um nur einige
wenige Gebiete zu nennen) zeigen. Es ge-
hörte eine besondere Verblendung zu der Er-
wartung, daß eine Wissenschaft immer weiter
ruhig zusehen würde, wie ihre Grundlagen be-
droht und erschüttert werden, und daß es den
Interessenten am herrschenden Zustande
überlassen bleiben würde, die Welt zwischen
sich zu teilen. Wie lange noch wird man etwa
dem Kniff vertrauen, bei Angriffen1) auf die
sulfate seines Forschens in der Geldsphäre
einen Kurs haben müssen. Wenn ich ein Stück
für falsch halte, so „ist“ es damit, troß des
wissenschaftlichen Fundamentes, noch nicht
falsch, und es kommt nur von der Vermengung
zweier Welten, die nichts miteinander zu tun
haben, wenn derjenige, der es bis dahin so
und so hoch einschäßte, es nun für materiell
wertlos hält. Ich verstehe es sehr wohl, daß
der ehrliche Kunsthandel sich dagegen zur Wehr
seßt, wenn ihm materielle Werte durch die
wissenschaftliche Forschung gemindert wer-
den; aber der Protest wendet sich an die
falsche Stelle, wenn er gegen die Wissenschaft
oder ihre Träger sich richtet. (Würde man nicht
lachen, wenn die am Ausflugsverkehr Inter-
essierten wegen Geschäftsstörung Protest
gegen die Beamten der Wetterwarte erhöben,
weil sie für einen Festtag schlechtes Wetter
ankündigten, selbst wenn die Voraussage sich
als irrig erwies?) Sinngemäß gilt das gleiche
für die günstige Beurteilung bzw. Voraussage.
Ich glaube immer noch, daß der Antiguar
dem Ideal am nächsten kommt, der dem
Amerikaner auf die Frage, wer ihm denn für
die Echtheit der wertvollen Sache bürge, die
er kaufen wolle, antwortete: my name. Daß
so etwas im München von 1930 möglich war,
zeigt, daß es auch ohne
Expertise geht. Das ist
Geist des echten Kauf-
manns. Daher waren
auch die ersten, die
gegen die Expertisen
aufstanden, zwei Her-
ren des Kunsthandels
(Dr. Wendland und Ge-
heimrat Drey); also
zum mindesten der be-
deutende Kunsthandel
kommt ohne Expertise
aus und stöhnt gele-
gentlich, ein Abbild des
Zauberlehrlings, unter
der Machtstellung eini-
ger Experten, der er
sich aus naheliegenden
Gründen nicht entziehen
zu können glaubt. Ist
es noch ein erriagbarer
Zustand, wenn
Kunsthandlung
Photographie zur
senschaftlichen
Wendung nur unter der
Bedingung abzugeben
wagt, daß die Bestim-
mung des Experten X
angenommen wird oder
eine Verständigung mit
ihm erfolgt? Hat man
kein Recht, solches
Verhältnis als einen
„Ring“ zu bezeichnen,
ein Wort, das an sich
weder einen morali-
schen noch sonstigen
Vorwurf enthält, das
aber jene entschei-
dende — gewollte oder
ungewollte — Grund-
lage des heutigen Ver-
hältnisses zwischen
Experten und Kunst-
händlern treffend cha-
rakterisiert, wie sie
Tieße schon herausge-
arbeitethat: der erstere
macht die Ware „markt-
gängig“, der andere
des Urteils. Ist das
Antwort auf Angriffe
aus dem Kreise der
Ist das kein „Ring“,
und immer wieder
dem Kunsthandel hört:
Expertise vom Herrn X
bekam sie natürlich
Bild, nachdem er es
x) Vorher hatte es nur „etwas gelitten“.
(Pantheon 1929, S. 249.)
2) Wie eigenartig die Situation verkehrt worden
ist, zeigt etwa der Ausfall im Pantheon 1930 S. 492
gegen diejenigen, die es wagen, nicht zu tanzen, wie
gepfiffen wird. Ich persönlich rechne es mir in diesem
Fall zur Ehre, zu den als Unehrliche oder als Unver-
ständige, als krasseste Dilettanten Bezeichneten zu ge-
hören, denn dort befinde ich mich in der besten Ge-
sellschaft. Man beachte: schon der Zweifel zieht
das Verdikt nach sich.
Bestimmungen großmütig zuzugeben: Ja, jeßt
ist das Bild „nicht gut erhalten, ungünstig
restauriert", aber „abgedeckt“ hätten Sie es
sehen sollen! Ist denn die Tiefenforschung
Objekt des ästhetischen Genusses geworden?
Ist denn der Humus, der ein Kohlenlager be-
deckt, darum Kohle? Schamrot muß man über
solchen Wissenschaftsbetrieb werden, für
dessen Charakterisierung kein Wort scharf
genug ist, der nur die eine Entschuldigung hat,
daß er selber sich an ernste Menschen nicht
mehr wenden will, — sonst wäre z. B. ein Ab-
saß, wie der über das Dürer zugeschriebene
Porträt der Smlg. Bache im Pantheon 1930,
S. 542, im ganzen unmöglich; wie überhaupt
ein großer Teil dieser Veröffentlichungen den
Eindruck macht, als sei er nicht für jemanden
bestimmt, der wissenschaftliche2) Literatur ver-
folgt. Die Lehre, die die Aufnahme einiger
der für Kunstwerke der Sammlung Rohoncz
abgegebenen Expertisen — auch die von Ge-
heimrat Pinder, S. 3, Sp. 3, wiedergegebene
Äußerung eines „Meisters unserer Disziplin“
fiel unter ihrem Eindruck — erteilen konnte,
scheint nicht überall verstanden worden zu
sein. Diese Herren mögen es sich gesagt sein
lassen: die Zahl derjenigen, die für die Rein-
haltung des Ansehens ihrer Wissenschaft und
ihres Standes kämpfen wollen, ist nicht so
klein, wie sie zu vermuten scheinen. Uns geht
es um nichts als um diese — und vielleicht um
eine schärfere Zäsur zwischen wissenschaft-
licher Arbeit über Kunstwerke und dem
Kunsthandel. Das ideale Verhältnis zwischen
beiden Betätigungen braucht durchaus nicht
als utopisch betrachtet zu werden: das der
völligen Scheidung. Wenn auf der einen Seite
nach bestem, Wissen und Gewissen Wissen-
schaft getrieben und auf der anderen nach
bestem Wissen und Gewissen mit Kunstwerken
gehandelt wird, so kann kein wirklicher Kon-
flikt entstehen. Kein wahrer Wissenschaftler
wird für sich in Anspruch nehmen, daß die Re-
Johann Scheffer von Leonhardshof, Studie
Ausstellung — Exposition — Exhibition: Deutsche Zeichenkunst 1780—1830
Wien, Albertina
Richtigstellung
Eine Zuschrift von Herrn Dr. Heine-
mann-Fleischmann können wir aus
den oben angeführten Gründen nicht mehr
wörtlich publizieren. Herr Dr. Heinemann-
Fleischmann legt aber Wert darauf, festzu-
stellen, daß er in seiner Erwiderung vom
7. Dezember in Nr. 49 der „Weltkunst“ ledig-
lich die Kategorie drei der Pinderschen Grup-
peneinteilung gemeint hat. „Daß ich die
Gruppe 4, die mir bis zum heutigen Tage
n i e begegnet ist, gar nicht mit einbezogen
haben konnte, geht aber doch für den nur
einigermaßen unvoreingenommenen Leser
deutlich daraus hervor, daß ich von „bona
fides“ sprach, wofür doch Gruppe
nicht in Frage kommt. (Es bleibt noch
stellen, daß die Pindersche Gruppe 3
Wissens nur insofern existiert, als es
ten gibt, die die Höhe ihres Honorars vom
Wert des von ihnen beurteilten Objektes ab-
hängig machen.)“
vertritt die „Autorität“
kein „Ring“, wenn die
gegen Experten stets
Kunsthändler
wenn man
die Klagen
i c h bekam
nicht, aber
für das gleiche
gekauft hafte? Nun nenne man das Verhältnis
zwischen dem kleinen Kreis der Experten und
dem kleinen Kreis der Kunsthändler wie man
will — es ist natürlich auch individuell sehr
verschieden: von zweien der „Weltautoritäten“
wird glaubhaft versichert, daß sie verpflichtete
Gutachter, also Angestellte je einer Kunst-
handlung sind. Ein Dritter kann — als Be-
amter — in ein so eigentümliches Verhältnis
zu einem Auftraggeber geraten, daß dieser
eine Klage auf entgangenen Gewinn gegen ihn
immerhin für aussichtsreich halten durfte. Aber
es fehlen als Gegenpol selbstverständlich nicht
die Vertreter von Pinders 1. und 2. Gruppe.
Ich wiederhole: wir haben ein Recht darauf zu
erfahren, wer ein Ehrenmann ist und wer es
nicht ist. Darum mögen diejenigen, die es an-
geht, mit dem Antrag auf Einleitung eines
Disziplinarverfahrens gegen sich nicht mehr
länger zuwarten.
Pliilobiblon
ist die einzige Monatschrift für
Bücherliebhaber von internatio-
naler Bedeutung. Sie bringt Bei-
träge über Handschriften, alte
Drucke, moderne Pressen, Ein-
bände, illustrierte Bücher, Biblio-
graphie, Auktionen, Novitäten
»Philobiblon« ist vorzüglich aus-
gestattet und reich illustriert
10 Hefte jährlich 13 RM und Porto
Verlag Herbert Reichner
Wien • VI • Strohmayergasse 6
Frau Elis, von Gans
Ich persönlich habe so viel Freu-
deam»Philobiblon«,daßich leb-
haft für diese wunderbare Zeit-
schrift werbe.
Freiherr von Pechmann
Es bietet dem Bücherfreund und
dem Sammler vielfache Anre-
gungen und Informationen.
Stefan Zweig, Salzburg
Es tut wohl, die Bibliophilie
gleichzeitig sachlich exakt und
amüsant behandelt zu sehen.
Seymour de Bicci, Paris
Cette revue est charmante et se
lit tres agreablement d'une Cou-
verture d l’autre.
SAMMELMAPPEN
bzw. Einbanddecken für «Die Kunstauktion»
resp. «Weltkunst»
Jahrg. I/II 1927/28 — Jahrg. III 1929 - Jahrg. IV 1930.
Format 49><33 cm, Halbleinen mit kleinen
Leinenecken, Prägung in zinnoberroter
Farbfolie auf Vorderseite und Rücken, mit
drei Karton klappen aus braunem Photo-
karton und durchgehendem Papierspiegel
Preis der einzelnen sorgfältig ausge-
führten und elegant ausgesta 11 eten
Mappe inkl. Verpackung und Versand
franko 4.50 Mark
Wir empfehlen Ihnen unsere Sammelmappen
rechtzeitig anzufordern.
Weltkunst-Verlag, Beilin W62, Kurfürstenstr. 76/77
Zur Aufbewahrung der «Kunstauktion»
resp. «Weltkunst»
als ständiges Nachschlagewerk unentbehrlicb!