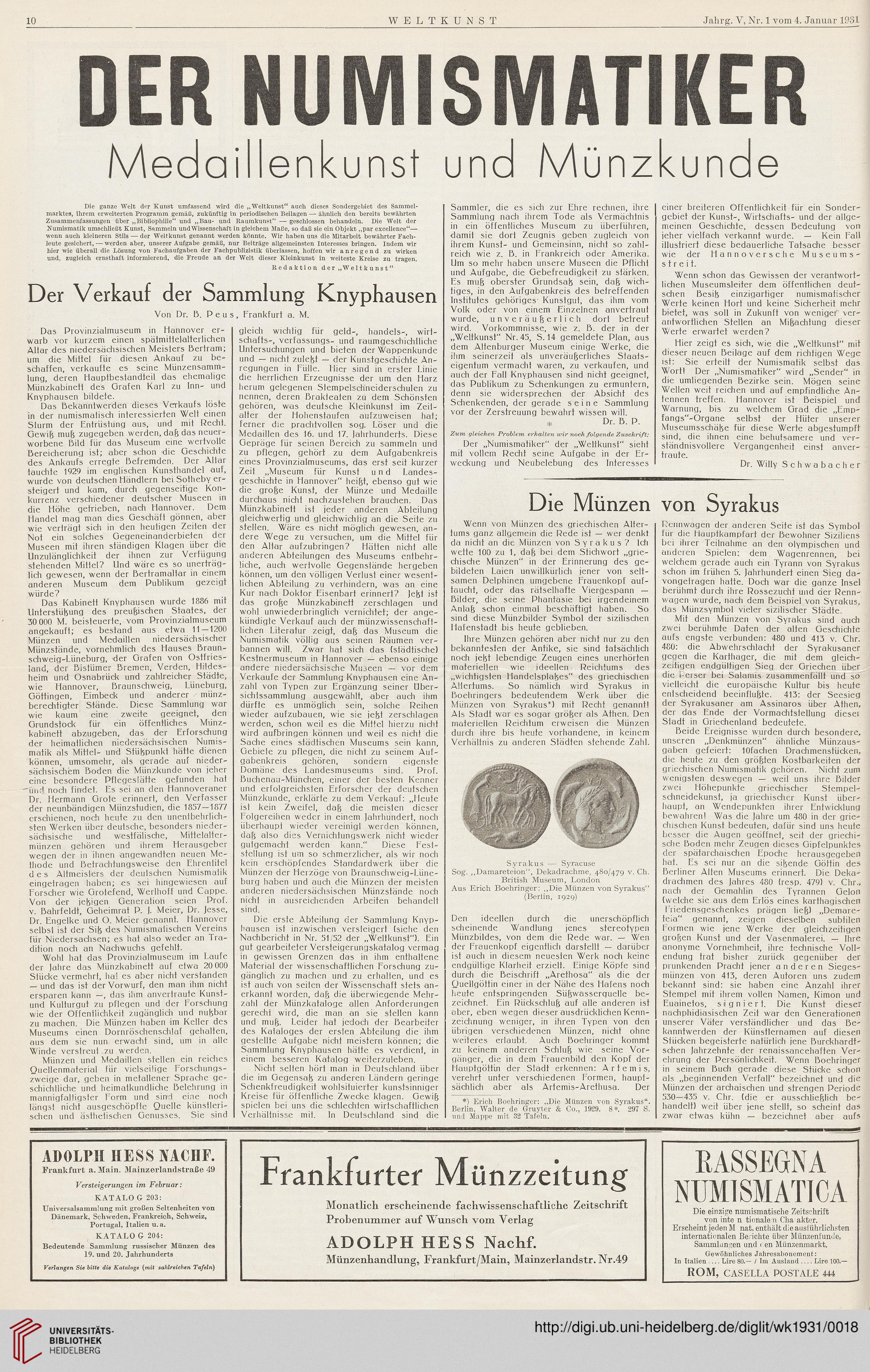10
Jahrg. V, Nr. 1 vom 4. Januar 1931
WELTKUNST
DER NUMISMATIKER
und Münzkunde
Die ganze Welt der Kunst umfassend wird die „Weltkunst“ auch dieses Sondergebiet des Sammel-
marktes, ihrem erweiterten Programm gemäß, zukünftig in periodischen Beilagen — ähnlich den bereits bewährten
Zusammenfassungen über „Bibliophilie“ und „Bau- und Raumkunst“ — geschlossen behandeln. Die Welt der
Numismatik umschließt Kunst, Sammeln und Wissenschaft in gleichem Maße, so daß sie ein Objekt „par excellence“—
wenn auch kleineren Stils -— der Weltkunst genannt werden könnte. Wir haben uns die Mitarbeit bewährter Fach-
leute gesichert, — werden aber, unserer Aufgabe gemäß, nur Beiträge allgemeinsten Interesses bringen. Indem wir
hier wie überall die Lösung von Fachaufgaben der Fachpublizistik überlassen, hoffen wir anregend zu wirken
und. zugleich ernsthaft informierend, die Freude an der Welt dieser Kleinkunst in weiteste Kreise zu tragen.
Redaktion der „Weltkunst“
Der Verkauf der Sammlung Knyphausen
Von Dr. B. Peus, Frankfurt a. M.
Lüneburg,
und anderer münz-
Diese Sammlung war
zweite geeignet, den
ein öffentliches Münz-
Das Provinzialmuseum in Hannover er-
warb vor kurzem einen spätmittelalterlichen
Altar des niedersächsischen Meisters Bertram;
um die Mittel für diesen Ankauf zu be-
schaffen, verkaufte es seine Münzensamm-
lung, deren Hauptbestandteil das ehemalige
Münzkabinett des Grafen Karl zu Inn- und
Knyphausen bildete.
Das Bekanntwerden dieses Verkaufs löste
in der numismatisch interessierten Welt einen
Sturm der Entrüstung aus, und mit Recht.
Gewiß muß zugegeben werden, dal} das neuer-
worbene Bild für das Museum eine wertvolle
Bereicherung ist; aber schon die Geschichte
des Ankaufs erregte Befremden. Der Altar
tauchte 1929 im englischen Kunsthandel auf,
wurde von deutschen Händlern bei Sotheby er-
steigert und kam, durch gegenseitige Kon-
kurrenz verschiedener deutscher Museen in
die Höhe getrieben, nach Hannover. Dem
Handel mag man dies Geschäft gönnen, aber
wie verträgt sich in den heutigen Zeiten der
Not ein solches Gegeneinanderbieten der
Museen mit ihren ständigen Klagen über die
Unzulänglichkeit der ihnen zur Verfügung
stehenden Mittel? Und wäre es so unerträg-
lich gewesen, wenn der Bertramaliar in einem
anderen Museum dem Publikum gezeigt
würde?
Das Kabinett Knyphausen wurde 1886 mit
Unterstüßung des preußischen Staates, der
30 000 M. beisteuerte, vom Provinzialmuseum
angekauft; es bestand aus etwa 11 1200
Münzen und Medaillen niedersächsischer
Münzstände, vornehmlich des Hauses Braun-
schweig-Lüneburg, der Grafen von Ostfries-
land, der Bistümer Bremen, Verden, Hildes-
heim und Osnabrück und zahlreicher Städte,
wie Hannover, Braunschweig,
Göttingen, Eimbeck
berechtigter Stände.
wie kaum eine
Grundstock für
kabinett abzugeben, das der Erforschung
der heimatlichen niedersächsischen Numis-
matik als Mittel- und Stüßpunkt hätte dienen
können, umsomehr, als gerade auf nieder-
sächsischem Boden die Münzkunde von jeher
eine besondere Pflegestätte gefunden hat
-und noch findet. Es sei an den Hannoveraner
Dr. Hermann Grote erinnert, den Verfasser
der neunbändigen Münzstudien, die 1857—1877
erschienen, noch heute zu den unentbehrlich-
sten Werken über deutsche, besonders nieder-
sächsische und westfälische. Mittelalter-
münzen gehören und ihrem Herausgeber
wegen der in ihnen angewandten neuen Me-
thode und Betrachtungsweise den Ehrentitel
des Altmeisters der deutschen Numismatik
eingetragen haben; es sei hingewiesen auf
Forscher wie Grotefend, Werlhoff und Cappe.
Von der jeßigen Generation seien Prof,
v. Bahrfeldt, Geheimrat P. ]. Meier, Dr. Jesse,
Dr. Engelke und O. Meier genannt. Hannover
selbst ist der Siß des Numismatischen Vereins
für Niedersachsen; es hat also weder an Tra-
dition noch an Nachwuchs gefehlt.
Wohl hat das Provinzialmuseum im Laufe
der Jahre das Münzkabinett auf etwa 20 000
Stücke vermehrt, hat es aber nicht verstanden
— und das ist der Vorwurf, den man ihm nicht
ersparen kann —, das ihm anvertraute Kunst-
und Kulturgut zu pflegen und der Forschung
wie der Öffentlichkeit zugänglich und nußbar
zu machen. Die Münzen haben im Keller des
Museums einen Dornröschenschlaf gehalten,
aus dem sie nun erwacht sind, um in alle
Winde verstreut zu werden.
Münzen und Medaillen stellen ein reiches
Quellenmateriai für vielseitige Forschungs-
zweige dar, geben in metallener Sprache ge-
schichtliche und heimatkundliche Belehrung in
mannigfaltigster Form und sind eine noch
längst nicht ausgeschöpfte Quelle künstleri-
schen und ästhetischen Genusses. Sie sind
gleich wichtig für geld-, handels-, wiri-
schafts-, verfassungs- und raumgeschichtliche
Untersuchungen und bieten der Wappenkunde
und — nicht zuleßt — der Kunstgeschichte An-
regungen in Fülle. Hier sind in erster Linie
die herrlichen Erzeugnisse der um den Harz
herum gelegenen Stempelschneiderschulen zu
nennen, deren Brakteaten zu dem Schönsten
gehören, was deutsche Kleinkunst im Zeit-
alter der. Hohenstaufen aufzuweisen hat;
ferner die prachtvollen sog. Löser und die
Medaillen des 16. und 17. Jahrhunderts. Diese
Gepräge für seinen Bereich zu sammeln und
zu pflegen, gehört zu dem Aufgabenkreis
eines Provinzialmuseums, das erst seit kurzer
Zeil „Museum für Kunst und Landes-
geschichte in Hannover“ heißt, ebenso gut wie
die große Kunst, der Münze und Medaille
durchaus nicht nachzustehen brauchen. Das
Münzkabinett ist jeder anderen Abteilung
gleichwertig und gleichwichiig an die Seite zu
stellen. Wäre es nicht möglich gewesen, an-
dere Wege zu versuchen, um die Mittel für
den Altar aufzubringen? Hätten nicht alle
anderen Abteilungen des Museums entbehr-
liche, auch wertvolle Gegenstände hergeben
können, um den völligen Verlust einer wesent-
lichen Abteilung zu verhindern, was an eine
Kur nach Doktor Eisenbart erinnert? Jeßt ist
das große Münzkabinett zerschlagen und
wohl unwiederbringlich vernichtet; der ange-
kündigte Verkauf auch der münzwissenschaff-
lichen Literatur zeigt, daß das Museum die
Numismatik völlig aus seinen Räumen ver-
bannen will. Zwar hat sich das (städtische)
Kestnermuseum in Hannover — ebenso einige
andere niedersächsische Museen — vor dem
Verkaufe der Sammlung Knyphausen eine An-
zahl von Typen zur Ergänzung seiner Llber-
sichfssammlung ausgewählt, aber auch ihm
dürfte es unmöglich sein, solche Reihen
wieder aufzubauen, wie sie jeßt zerschlagen
werden, schon weil es die Mittel hierzu nicht
wird aufbringen können und weil es nicht die
Sache eines städtischen Museums sein kann,
Gebiete zu pflegen, die nicht zu seinem Auf-
gabenkreis gehören, sondern eigenste
Domäne des Landesmuseums sind. Prof.
Buchenau-München, einer der besten Kenner
und erfolgreichsten Erforscher der deutschen
Münzkunde, erklärte zu dem Verkauf: „Heute
ist kein Zweifel, daß die meisten dieser
Folgereihen weder in einem Jahrhundert, noch
überhaupt wieder vereinigt werden können,
daß also dies Vernichiungswerk nicht wieder
gutgemacht werden kann.“ Diese Fest-
stellung ist um so schmerzlicher, als wir noch
kein erschöpfendes Standardwerk über die
Münzen der Herzöge von Braunschweig-Lüne-
burg haben und auch die Münzen der meisten
anderen niedersächsischen Münzstände noch
nicht in ausreichenden Arbeiten behandelt
sind.
Die erste Abteilung der Sammlung Knyp-
hausen ist inzwischen versteigert (siehe den
Nachbericht in Nr. 51/52 der „Weltkunst"). Ein
gut gearbeiteter Versteigerungskatalog vermag
in gewissen Grenzen das in ihm enthaltene
Material der wissenschaftlichen Forschung zu-
gänglich zu machen und zu erhalten, und es
ist auch von seifen der Wissenschaft stets an-
erkannt worden, daß die überwiegende Mehr-
zahl der Münzkataloge allen Anforderungen
gerecht wird, die man an sie stellen kann
und muß. Leider hat jedoch der Bearbeiter
des Kataloges der ersten Abteilung die ihm
gestellte Aufgabe nicht meistern können; die
Sammlung Knyphausen hätte es verdient, in
einem besseren Katalog weiterzuleben.
Nicht selten hört man in Deutschland über
die im Gegensaß zu anderen Ländern geringe
Schenkfreudigkeit wohlsituierter kunstsinniger
Kreise für öffentliche Zwecke klagen. Gewiß
spielen bei uns die schlechten wirtschaftlichen
Verhältnisse mil. In Deutschland sind die
Sammler, die es sich zur Ehre rechnen, ihre
Sammlung nach ihrem Tode als Vermächtnis
in ein öffentliches Museum zu überführen,
damit sie dort Zeugnis geben zugleich von
ihrem Kunst- und Gemeinsinn, nicht so zahl-
reich wie z. B. in Frankreich oder Amerika.
Um so mehr haben unsere Museen die Pflicht
und Aufgabe, die Gebefreudigkeii zu stärken.
Es muß oberster Grundsaß sein, daß wich-
tiges, in den Aufgabenkreis des betreffenden
Institutes gehöriges- Kunstgut, das ihm vom
Volk oder von einem Einzelnen anverfraut
wurde, unveräußerlich dort betreut
wird. Vorkommnisse, wie z. B. der in der
„Weltkunst“ Nr. 45, S. 14 gemeldete Plan, aus
dem Altenburger Museum einige Werke, die
ihm seinerzeit als unveräußerliches Staats-
eigentum vermacht waren, zu verkaufen, und
auch der Fall Knyphausen sind nicht geeignet,
das Publikum zu Schenkungen zu ermuntern,
denn sie widersprechen der Absicht des
Schenkenden, der gerade seine Sammlung
vor der Zerstreuung bewahrt wissen will.
* Dr. B. P.
Zum gleichen Problem, erhalten wir noch folgende Zuschrift:
Der „Numismatiker“ der „Weltkunst“ sieht
mit vollem Recht seine Aufgabe in der Er-
weckung und Neubelebung des Interesses
einer breiteren Öffentlichkeit für ein Sonder-
gebiet der Kunst-, Wirtschafts- und der allge-
meinen Geschichte, dessen Bedeutung von
jeher vielfach verkannt wurde. — Kein Fall
illustriert diese bedauerliche Tatsache besser
wie der Hannoversche Museums-
streit.
Wenn schon das Gewissen der verantwort-
lichen Museumsleiter dem öffentlichen deut-
schen Besiß einzigartiger numismatischer
Werte keinen Hort und keine Sicherheit mehr
bietet, was soll in Zukunft von wenige; ver-
antwortlichen Stellen an Mißachtung dieser
Werte erwartet werden?
Hier zeigt es sich, wie die „Weltkunst“ mit
dieser neuen Beilage auf dem richtigen Wege
ist; Sie erteilt der Numismatik selbst das
Wort! Der „Numismatiker“ wird „Sender“ in
die umliegenden Bezirke sein. Mögen seine
Wellen weit reichen und auf empfindliche An-
tennen treffen. Hannover ist Beispiel und
Warnung, bis zu welchem Grad die „Emp-
fangs“-Organe selbst der Hüter unserer
Museumsschäße für diese Werfe abgestumpft
sind, die ihnen eine behutsamere und ver-
ständnisvollere Vergangenheit einst anver-
traute.
Dr. Willy Sch wa bacher
Die Münzen
Wenn von Münzen des griechischen Alter-
tums ganz allgemein die Rede ist — wer denkt
da nicht an die Münzen von Syrakus? Ich
wette 100 zu 1, daß bei dem Stichwort „grie-
chische Münzen“ in der Erinnerung des ge-
bildeten Laien unwillkürlich jener von selt-
samen Delphinen umgebene Frauenkopf auf-
taucht, oder das rätselhafte Viergespann —
Bilder, die seine Phantasie bei irgendeinem
Anlaß schon einmal beschäftigt haben. So
sind diese Münzbilder Symbol der sizilischen
Hafenstadt bis heute geblieben.
Ihre Münzen gehören aber nicht nur zu den
bekanntesten der Antike, sie sind tatsächlich
noch jeßt lebendige Zeugen eines unerhörten
materiellen wie ideellen Reichtums des
„wichtigsten Handelsplaßes“ des griechischen
Altertums. So nämlich wird Syrakus in
Boehringers bedeutendem Werk über die
Münzen von Syrakus*) mit Recht genannt!
Als Stadt war es sogar größer als Athen. Den
materiellen Reichtum erweisen die Münzen
durch ihre bis heute vorhandene, in keinem
Verhältnis zu anderen Städten stehende Zahl.
Syrakus — Syracuse
Sog. „Damareteion“, Dekadrachme, 480/479 v. Ch.
British Museum, London
Aus Erich Boehringer: „Die Münzen von Syrakus"
(Berlin, 1929)
Den ideellen durch die unerschöpflich
scheinende Wandlung jenes stereotypen
Münzbildes, von dem die Rede war. — Wen
der Frauenkopf eigentlich darstellt — darüber
ist auch in diesem neuesten Werk noch keine
endgültige Klarheit erzielt. Einige Köpfe sind
durch die Beischrift „Arethosa“ als die der
Quellgöttin einer in der Nähe des Hafens noch
heute entspringenden Süßwasscrguelle be-
zeichnet. Ein Rückschluß auf alle anderen ist
aber, eben wegen dieser ausdrücklichen Kenn-
zeichnung weniger, in ihren Typen von den
übrigen verschiedenen Münzen, nicht ohne
weiteres erlaubt. Auch Boehringer kommt
zu keinem anderen Schluß wie seine Vor-
gänger, die in dem Frauenbild den Kopf der
Hauptgöttin der Stadt erkennen: Artemis,
verehrt unter verschiedenen Formen, haupt-
sächlich aber als Artemis-Arethusa. Der
*) Erich Boehringer: „Die Münzen von Syrakus“.
Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1929. 8». 297 S.
und Mappe mit 32 Tafeln.
von Syrakus
Rennwagen der anderen Seite ist das Symbol
für die Hauptkampfart der Bewohner Siziliens
bei ihrer Teilnahme an den olympischen und
anderen Spielen: dem Wagenrennen, bei
welchem gerade auch ein Tyrann von Syrakus
schon im frühen 5. Jahrhundert einen Sieg da-
vongetragen hatte. Doch war die ganze Insel
berühmt durch ihre Rossezucht und der Renn-
wagen wurde, nach dem Beispiel von Syrakus,
das Münzsymbol vieler sizilischer Städte.
Mit den Münzen von Syrakus sind auch
zwei berühmte Daten der alten Geschichte
aufs engste verbunden: 480 und 413 v. Chr.
480: die Abwehrschlacht der Syrakusaner
gegen die Karthager, die mit dem gleich-
zeitigen endgültigen Sieg der Griechen über
die Perser bei Salamis zusammenfällt und so
vielleicht die europäische Kultur bis heute
entscheidend beeinflußte. 413: der Seesieg
der Syrakusaner am Assinaros über Athen,
der das Ende der Vormachtstellung diesei
Stadt in Griechenland bedeutete.
Beide Ereignisse wurden durch besondere,
unseren „Denkmünzen“ ähnliche Münzaus-
gaben gefeiert: lOfachen Drachmenstücken,
die heute zu den größten Kostbarkeiten der
griechischen Numismatik gehören. Nicht zum
wenigsten deswegen — weil uns ihre Bilder
zwei Höhepunkte griechischer Stempel-
schneidekunst, ja griechischer Kunst über-
haupt, an Wendepunkten ihrer Entwicklung
bewahren! Was die Jahre um 480 in der grie-
chischen Kunst bedeuten, dafür sind uns heute
besser die Augen geöffnet, seit der griechi-
sche Boden mehr Zeugen dieses Gipfelpunktes
der spätarchaischen Epoche herausgegeben
hat. Es sei nur an die sißende Göttin des
Berliner Alten Museums erinnert. Die Deka-
drachmen des Jahres 480 (resp. 479) v. Chr.,
nach der Gemahlin des Tyrannen Gelon
(welche sie aus dem Erlös eines karthagischen
l'riedcnsgeschenkes prägen ließ) „Demare-
teia“ genannt, zeigen dieselben subtilen
Formen wie jene Werke der gleichzeitigen
großen Kunst und der Vasenmalerei. — Ihre
anonyme Vornehmheit, ihre technische Voll-
endung trat bisher zurück gegenüber der
prunkenden Pracht jener anderen Sieges-
münzen von 413, deren Autoren uns zudem
bekannt sind: sie haben eine Anzahl ihrer
Stempel mit ihrem vollen Namen, Kimon und
Euainetos, signiert. Die Kunst dieser
nachphidiasischen Zeit war den Generationen
unserer Väter verständlicher und das Be-
kanntwerden der Künstlernamen auf diesen
Stücken begeisterte natürlich jene Burckhardt-
schen Jahrzehnte der renaissancehaften Ver-
ehrung der Persönlichkeit. Wenn Boehringer
in seinem Buch gerade diese Stücke schon
als „beginnenden Verfall“ bezeichnet und die
Münzen der archaischen und strengen Periode
530—435 v. Chr. (die er ausschließlich be-
handelt) weit über jene stellt, so scheint das
zwar etwas kühn — bezeichnet aber aufs
ADOLPH HESS NACHF.
Frankfurt a. Main. Mainzerlandstraße 49
Versteigerungen im Februar:
KATALO G 203:
Universalsammlung mit großen Seltenheiten von
Dänemark, Schweden, Frankreich, Schweiz,
Portugal, Italien u. a.
KATALO G 204:
Bedeutende Sammlung russischer Münzen des
19. und 20. Jahrhunderts
Verlangen Sie bitte die Kataloge (mit zahlreichen Tafeln)
Frankfurter Münzzeitung
Monatlich erscheinende fachwissenschaftliche Zeitschrift
Probenummer auf Wunsch vom Verlag
ADOLPH HESS Nachf.
Münzenhandlung, Frankfurt/Main, Mainzerlandstr. Nr.49
RASSEGNA
NUM1SMATICA
Die einzige numismatische Zeitschrift
von inte n tionalen Cha akter.
Erscheint jeden M nat, enthält die ausführlichsten
internationalen Berichte über Münzenfunde,
Sammlungen und < en Münzenmarkt.
Gewöhnliches Jahresahonement:
In Italien .... Lire 80.— / Im Ausland .... Lire 100.—
ROM, CASELLA POSTALE 444
Jahrg. V, Nr. 1 vom 4. Januar 1931
WELTKUNST
DER NUMISMATIKER
und Münzkunde
Die ganze Welt der Kunst umfassend wird die „Weltkunst“ auch dieses Sondergebiet des Sammel-
marktes, ihrem erweiterten Programm gemäß, zukünftig in periodischen Beilagen — ähnlich den bereits bewährten
Zusammenfassungen über „Bibliophilie“ und „Bau- und Raumkunst“ — geschlossen behandeln. Die Welt der
Numismatik umschließt Kunst, Sammeln und Wissenschaft in gleichem Maße, so daß sie ein Objekt „par excellence“—
wenn auch kleineren Stils -— der Weltkunst genannt werden könnte. Wir haben uns die Mitarbeit bewährter Fach-
leute gesichert, — werden aber, unserer Aufgabe gemäß, nur Beiträge allgemeinsten Interesses bringen. Indem wir
hier wie überall die Lösung von Fachaufgaben der Fachpublizistik überlassen, hoffen wir anregend zu wirken
und. zugleich ernsthaft informierend, die Freude an der Welt dieser Kleinkunst in weiteste Kreise zu tragen.
Redaktion der „Weltkunst“
Der Verkauf der Sammlung Knyphausen
Von Dr. B. Peus, Frankfurt a. M.
Lüneburg,
und anderer münz-
Diese Sammlung war
zweite geeignet, den
ein öffentliches Münz-
Das Provinzialmuseum in Hannover er-
warb vor kurzem einen spätmittelalterlichen
Altar des niedersächsischen Meisters Bertram;
um die Mittel für diesen Ankauf zu be-
schaffen, verkaufte es seine Münzensamm-
lung, deren Hauptbestandteil das ehemalige
Münzkabinett des Grafen Karl zu Inn- und
Knyphausen bildete.
Das Bekanntwerden dieses Verkaufs löste
in der numismatisch interessierten Welt einen
Sturm der Entrüstung aus, und mit Recht.
Gewiß muß zugegeben werden, dal} das neuer-
worbene Bild für das Museum eine wertvolle
Bereicherung ist; aber schon die Geschichte
des Ankaufs erregte Befremden. Der Altar
tauchte 1929 im englischen Kunsthandel auf,
wurde von deutschen Händlern bei Sotheby er-
steigert und kam, durch gegenseitige Kon-
kurrenz verschiedener deutscher Museen in
die Höhe getrieben, nach Hannover. Dem
Handel mag man dies Geschäft gönnen, aber
wie verträgt sich in den heutigen Zeiten der
Not ein solches Gegeneinanderbieten der
Museen mit ihren ständigen Klagen über die
Unzulänglichkeit der ihnen zur Verfügung
stehenden Mittel? Und wäre es so unerträg-
lich gewesen, wenn der Bertramaliar in einem
anderen Museum dem Publikum gezeigt
würde?
Das Kabinett Knyphausen wurde 1886 mit
Unterstüßung des preußischen Staates, der
30 000 M. beisteuerte, vom Provinzialmuseum
angekauft; es bestand aus etwa 11 1200
Münzen und Medaillen niedersächsischer
Münzstände, vornehmlich des Hauses Braun-
schweig-Lüneburg, der Grafen von Ostfries-
land, der Bistümer Bremen, Verden, Hildes-
heim und Osnabrück und zahlreicher Städte,
wie Hannover, Braunschweig,
Göttingen, Eimbeck
berechtigter Stände.
wie kaum eine
Grundstock für
kabinett abzugeben, das der Erforschung
der heimatlichen niedersächsischen Numis-
matik als Mittel- und Stüßpunkt hätte dienen
können, umsomehr, als gerade auf nieder-
sächsischem Boden die Münzkunde von jeher
eine besondere Pflegestätte gefunden hat
-und noch findet. Es sei an den Hannoveraner
Dr. Hermann Grote erinnert, den Verfasser
der neunbändigen Münzstudien, die 1857—1877
erschienen, noch heute zu den unentbehrlich-
sten Werken über deutsche, besonders nieder-
sächsische und westfälische. Mittelalter-
münzen gehören und ihrem Herausgeber
wegen der in ihnen angewandten neuen Me-
thode und Betrachtungsweise den Ehrentitel
des Altmeisters der deutschen Numismatik
eingetragen haben; es sei hingewiesen auf
Forscher wie Grotefend, Werlhoff und Cappe.
Von der jeßigen Generation seien Prof,
v. Bahrfeldt, Geheimrat P. ]. Meier, Dr. Jesse,
Dr. Engelke und O. Meier genannt. Hannover
selbst ist der Siß des Numismatischen Vereins
für Niedersachsen; es hat also weder an Tra-
dition noch an Nachwuchs gefehlt.
Wohl hat das Provinzialmuseum im Laufe
der Jahre das Münzkabinett auf etwa 20 000
Stücke vermehrt, hat es aber nicht verstanden
— und das ist der Vorwurf, den man ihm nicht
ersparen kann —, das ihm anvertraute Kunst-
und Kulturgut zu pflegen und der Forschung
wie der Öffentlichkeit zugänglich und nußbar
zu machen. Die Münzen haben im Keller des
Museums einen Dornröschenschlaf gehalten,
aus dem sie nun erwacht sind, um in alle
Winde verstreut zu werden.
Münzen und Medaillen stellen ein reiches
Quellenmateriai für vielseitige Forschungs-
zweige dar, geben in metallener Sprache ge-
schichtliche und heimatkundliche Belehrung in
mannigfaltigster Form und sind eine noch
längst nicht ausgeschöpfte Quelle künstleri-
schen und ästhetischen Genusses. Sie sind
gleich wichtig für geld-, handels-, wiri-
schafts-, verfassungs- und raumgeschichtliche
Untersuchungen und bieten der Wappenkunde
und — nicht zuleßt — der Kunstgeschichte An-
regungen in Fülle. Hier sind in erster Linie
die herrlichen Erzeugnisse der um den Harz
herum gelegenen Stempelschneiderschulen zu
nennen, deren Brakteaten zu dem Schönsten
gehören, was deutsche Kleinkunst im Zeit-
alter der. Hohenstaufen aufzuweisen hat;
ferner die prachtvollen sog. Löser und die
Medaillen des 16. und 17. Jahrhunderts. Diese
Gepräge für seinen Bereich zu sammeln und
zu pflegen, gehört zu dem Aufgabenkreis
eines Provinzialmuseums, das erst seit kurzer
Zeil „Museum für Kunst und Landes-
geschichte in Hannover“ heißt, ebenso gut wie
die große Kunst, der Münze und Medaille
durchaus nicht nachzustehen brauchen. Das
Münzkabinett ist jeder anderen Abteilung
gleichwertig und gleichwichiig an die Seite zu
stellen. Wäre es nicht möglich gewesen, an-
dere Wege zu versuchen, um die Mittel für
den Altar aufzubringen? Hätten nicht alle
anderen Abteilungen des Museums entbehr-
liche, auch wertvolle Gegenstände hergeben
können, um den völligen Verlust einer wesent-
lichen Abteilung zu verhindern, was an eine
Kur nach Doktor Eisenbart erinnert? Jeßt ist
das große Münzkabinett zerschlagen und
wohl unwiederbringlich vernichtet; der ange-
kündigte Verkauf auch der münzwissenschaff-
lichen Literatur zeigt, daß das Museum die
Numismatik völlig aus seinen Räumen ver-
bannen will. Zwar hat sich das (städtische)
Kestnermuseum in Hannover — ebenso einige
andere niedersächsische Museen — vor dem
Verkaufe der Sammlung Knyphausen eine An-
zahl von Typen zur Ergänzung seiner Llber-
sichfssammlung ausgewählt, aber auch ihm
dürfte es unmöglich sein, solche Reihen
wieder aufzubauen, wie sie jeßt zerschlagen
werden, schon weil es die Mittel hierzu nicht
wird aufbringen können und weil es nicht die
Sache eines städtischen Museums sein kann,
Gebiete zu pflegen, die nicht zu seinem Auf-
gabenkreis gehören, sondern eigenste
Domäne des Landesmuseums sind. Prof.
Buchenau-München, einer der besten Kenner
und erfolgreichsten Erforscher der deutschen
Münzkunde, erklärte zu dem Verkauf: „Heute
ist kein Zweifel, daß die meisten dieser
Folgereihen weder in einem Jahrhundert, noch
überhaupt wieder vereinigt werden können,
daß also dies Vernichiungswerk nicht wieder
gutgemacht werden kann.“ Diese Fest-
stellung ist um so schmerzlicher, als wir noch
kein erschöpfendes Standardwerk über die
Münzen der Herzöge von Braunschweig-Lüne-
burg haben und auch die Münzen der meisten
anderen niedersächsischen Münzstände noch
nicht in ausreichenden Arbeiten behandelt
sind.
Die erste Abteilung der Sammlung Knyp-
hausen ist inzwischen versteigert (siehe den
Nachbericht in Nr. 51/52 der „Weltkunst"). Ein
gut gearbeiteter Versteigerungskatalog vermag
in gewissen Grenzen das in ihm enthaltene
Material der wissenschaftlichen Forschung zu-
gänglich zu machen und zu erhalten, und es
ist auch von seifen der Wissenschaft stets an-
erkannt worden, daß die überwiegende Mehr-
zahl der Münzkataloge allen Anforderungen
gerecht wird, die man an sie stellen kann
und muß. Leider hat jedoch der Bearbeiter
des Kataloges der ersten Abteilung die ihm
gestellte Aufgabe nicht meistern können; die
Sammlung Knyphausen hätte es verdient, in
einem besseren Katalog weiterzuleben.
Nicht selten hört man in Deutschland über
die im Gegensaß zu anderen Ländern geringe
Schenkfreudigkeit wohlsituierter kunstsinniger
Kreise für öffentliche Zwecke klagen. Gewiß
spielen bei uns die schlechten wirtschaftlichen
Verhältnisse mil. In Deutschland sind die
Sammler, die es sich zur Ehre rechnen, ihre
Sammlung nach ihrem Tode als Vermächtnis
in ein öffentliches Museum zu überführen,
damit sie dort Zeugnis geben zugleich von
ihrem Kunst- und Gemeinsinn, nicht so zahl-
reich wie z. B. in Frankreich oder Amerika.
Um so mehr haben unsere Museen die Pflicht
und Aufgabe, die Gebefreudigkeii zu stärken.
Es muß oberster Grundsaß sein, daß wich-
tiges, in den Aufgabenkreis des betreffenden
Institutes gehöriges- Kunstgut, das ihm vom
Volk oder von einem Einzelnen anverfraut
wurde, unveräußerlich dort betreut
wird. Vorkommnisse, wie z. B. der in der
„Weltkunst“ Nr. 45, S. 14 gemeldete Plan, aus
dem Altenburger Museum einige Werke, die
ihm seinerzeit als unveräußerliches Staats-
eigentum vermacht waren, zu verkaufen, und
auch der Fall Knyphausen sind nicht geeignet,
das Publikum zu Schenkungen zu ermuntern,
denn sie widersprechen der Absicht des
Schenkenden, der gerade seine Sammlung
vor der Zerstreuung bewahrt wissen will.
* Dr. B. P.
Zum gleichen Problem, erhalten wir noch folgende Zuschrift:
Der „Numismatiker“ der „Weltkunst“ sieht
mit vollem Recht seine Aufgabe in der Er-
weckung und Neubelebung des Interesses
einer breiteren Öffentlichkeit für ein Sonder-
gebiet der Kunst-, Wirtschafts- und der allge-
meinen Geschichte, dessen Bedeutung von
jeher vielfach verkannt wurde. — Kein Fall
illustriert diese bedauerliche Tatsache besser
wie der Hannoversche Museums-
streit.
Wenn schon das Gewissen der verantwort-
lichen Museumsleiter dem öffentlichen deut-
schen Besiß einzigartiger numismatischer
Werte keinen Hort und keine Sicherheit mehr
bietet, was soll in Zukunft von wenige; ver-
antwortlichen Stellen an Mißachtung dieser
Werte erwartet werden?
Hier zeigt es sich, wie die „Weltkunst“ mit
dieser neuen Beilage auf dem richtigen Wege
ist; Sie erteilt der Numismatik selbst das
Wort! Der „Numismatiker“ wird „Sender“ in
die umliegenden Bezirke sein. Mögen seine
Wellen weit reichen und auf empfindliche An-
tennen treffen. Hannover ist Beispiel und
Warnung, bis zu welchem Grad die „Emp-
fangs“-Organe selbst der Hüter unserer
Museumsschäße für diese Werfe abgestumpft
sind, die ihnen eine behutsamere und ver-
ständnisvollere Vergangenheit einst anver-
traute.
Dr. Willy Sch wa bacher
Die Münzen
Wenn von Münzen des griechischen Alter-
tums ganz allgemein die Rede ist — wer denkt
da nicht an die Münzen von Syrakus? Ich
wette 100 zu 1, daß bei dem Stichwort „grie-
chische Münzen“ in der Erinnerung des ge-
bildeten Laien unwillkürlich jener von selt-
samen Delphinen umgebene Frauenkopf auf-
taucht, oder das rätselhafte Viergespann —
Bilder, die seine Phantasie bei irgendeinem
Anlaß schon einmal beschäftigt haben. So
sind diese Münzbilder Symbol der sizilischen
Hafenstadt bis heute geblieben.
Ihre Münzen gehören aber nicht nur zu den
bekanntesten der Antike, sie sind tatsächlich
noch jeßt lebendige Zeugen eines unerhörten
materiellen wie ideellen Reichtums des
„wichtigsten Handelsplaßes“ des griechischen
Altertums. So nämlich wird Syrakus in
Boehringers bedeutendem Werk über die
Münzen von Syrakus*) mit Recht genannt!
Als Stadt war es sogar größer als Athen. Den
materiellen Reichtum erweisen die Münzen
durch ihre bis heute vorhandene, in keinem
Verhältnis zu anderen Städten stehende Zahl.
Syrakus — Syracuse
Sog. „Damareteion“, Dekadrachme, 480/479 v. Ch.
British Museum, London
Aus Erich Boehringer: „Die Münzen von Syrakus"
(Berlin, 1929)
Den ideellen durch die unerschöpflich
scheinende Wandlung jenes stereotypen
Münzbildes, von dem die Rede war. — Wen
der Frauenkopf eigentlich darstellt — darüber
ist auch in diesem neuesten Werk noch keine
endgültige Klarheit erzielt. Einige Köpfe sind
durch die Beischrift „Arethosa“ als die der
Quellgöttin einer in der Nähe des Hafens noch
heute entspringenden Süßwasscrguelle be-
zeichnet. Ein Rückschluß auf alle anderen ist
aber, eben wegen dieser ausdrücklichen Kenn-
zeichnung weniger, in ihren Typen von den
übrigen verschiedenen Münzen, nicht ohne
weiteres erlaubt. Auch Boehringer kommt
zu keinem anderen Schluß wie seine Vor-
gänger, die in dem Frauenbild den Kopf der
Hauptgöttin der Stadt erkennen: Artemis,
verehrt unter verschiedenen Formen, haupt-
sächlich aber als Artemis-Arethusa. Der
*) Erich Boehringer: „Die Münzen von Syrakus“.
Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1929. 8». 297 S.
und Mappe mit 32 Tafeln.
von Syrakus
Rennwagen der anderen Seite ist das Symbol
für die Hauptkampfart der Bewohner Siziliens
bei ihrer Teilnahme an den olympischen und
anderen Spielen: dem Wagenrennen, bei
welchem gerade auch ein Tyrann von Syrakus
schon im frühen 5. Jahrhundert einen Sieg da-
vongetragen hatte. Doch war die ganze Insel
berühmt durch ihre Rossezucht und der Renn-
wagen wurde, nach dem Beispiel von Syrakus,
das Münzsymbol vieler sizilischer Städte.
Mit den Münzen von Syrakus sind auch
zwei berühmte Daten der alten Geschichte
aufs engste verbunden: 480 und 413 v. Chr.
480: die Abwehrschlacht der Syrakusaner
gegen die Karthager, die mit dem gleich-
zeitigen endgültigen Sieg der Griechen über
die Perser bei Salamis zusammenfällt und so
vielleicht die europäische Kultur bis heute
entscheidend beeinflußte. 413: der Seesieg
der Syrakusaner am Assinaros über Athen,
der das Ende der Vormachtstellung diesei
Stadt in Griechenland bedeutete.
Beide Ereignisse wurden durch besondere,
unseren „Denkmünzen“ ähnliche Münzaus-
gaben gefeiert: lOfachen Drachmenstücken,
die heute zu den größten Kostbarkeiten der
griechischen Numismatik gehören. Nicht zum
wenigsten deswegen — weil uns ihre Bilder
zwei Höhepunkte griechischer Stempel-
schneidekunst, ja griechischer Kunst über-
haupt, an Wendepunkten ihrer Entwicklung
bewahren! Was die Jahre um 480 in der grie-
chischen Kunst bedeuten, dafür sind uns heute
besser die Augen geöffnet, seit der griechi-
sche Boden mehr Zeugen dieses Gipfelpunktes
der spätarchaischen Epoche herausgegeben
hat. Es sei nur an die sißende Göttin des
Berliner Alten Museums erinnert. Die Deka-
drachmen des Jahres 480 (resp. 479) v. Chr.,
nach der Gemahlin des Tyrannen Gelon
(welche sie aus dem Erlös eines karthagischen
l'riedcnsgeschenkes prägen ließ) „Demare-
teia“ genannt, zeigen dieselben subtilen
Formen wie jene Werke der gleichzeitigen
großen Kunst und der Vasenmalerei. — Ihre
anonyme Vornehmheit, ihre technische Voll-
endung trat bisher zurück gegenüber der
prunkenden Pracht jener anderen Sieges-
münzen von 413, deren Autoren uns zudem
bekannt sind: sie haben eine Anzahl ihrer
Stempel mit ihrem vollen Namen, Kimon und
Euainetos, signiert. Die Kunst dieser
nachphidiasischen Zeit war den Generationen
unserer Väter verständlicher und das Be-
kanntwerden der Künstlernamen auf diesen
Stücken begeisterte natürlich jene Burckhardt-
schen Jahrzehnte der renaissancehaften Ver-
ehrung der Persönlichkeit. Wenn Boehringer
in seinem Buch gerade diese Stücke schon
als „beginnenden Verfall“ bezeichnet und die
Münzen der archaischen und strengen Periode
530—435 v. Chr. (die er ausschließlich be-
handelt) weit über jene stellt, so scheint das
zwar etwas kühn — bezeichnet aber aufs
ADOLPH HESS NACHF.
Frankfurt a. Main. Mainzerlandstraße 49
Versteigerungen im Februar:
KATALO G 203:
Universalsammlung mit großen Seltenheiten von
Dänemark, Schweden, Frankreich, Schweiz,
Portugal, Italien u. a.
KATALO G 204:
Bedeutende Sammlung russischer Münzen des
19. und 20. Jahrhunderts
Verlangen Sie bitte die Kataloge (mit zahlreichen Tafeln)
Frankfurter Münzzeitung
Monatlich erscheinende fachwissenschaftliche Zeitschrift
Probenummer auf Wunsch vom Verlag
ADOLPH HESS Nachf.
Münzenhandlung, Frankfurt/Main, Mainzerlandstr. Nr.49
RASSEGNA
NUM1SMATICA
Die einzige numismatische Zeitschrift
von inte n tionalen Cha akter.
Erscheint jeden M nat, enthält die ausführlichsten
internationalen Berichte über Münzenfunde,
Sammlungen und < en Münzenmarkt.
Gewöhnliches Jahresahonement:
In Italien .... Lire 80.— / Im Ausland .... Lire 100.—
ROM, CASELLA POSTALE 444