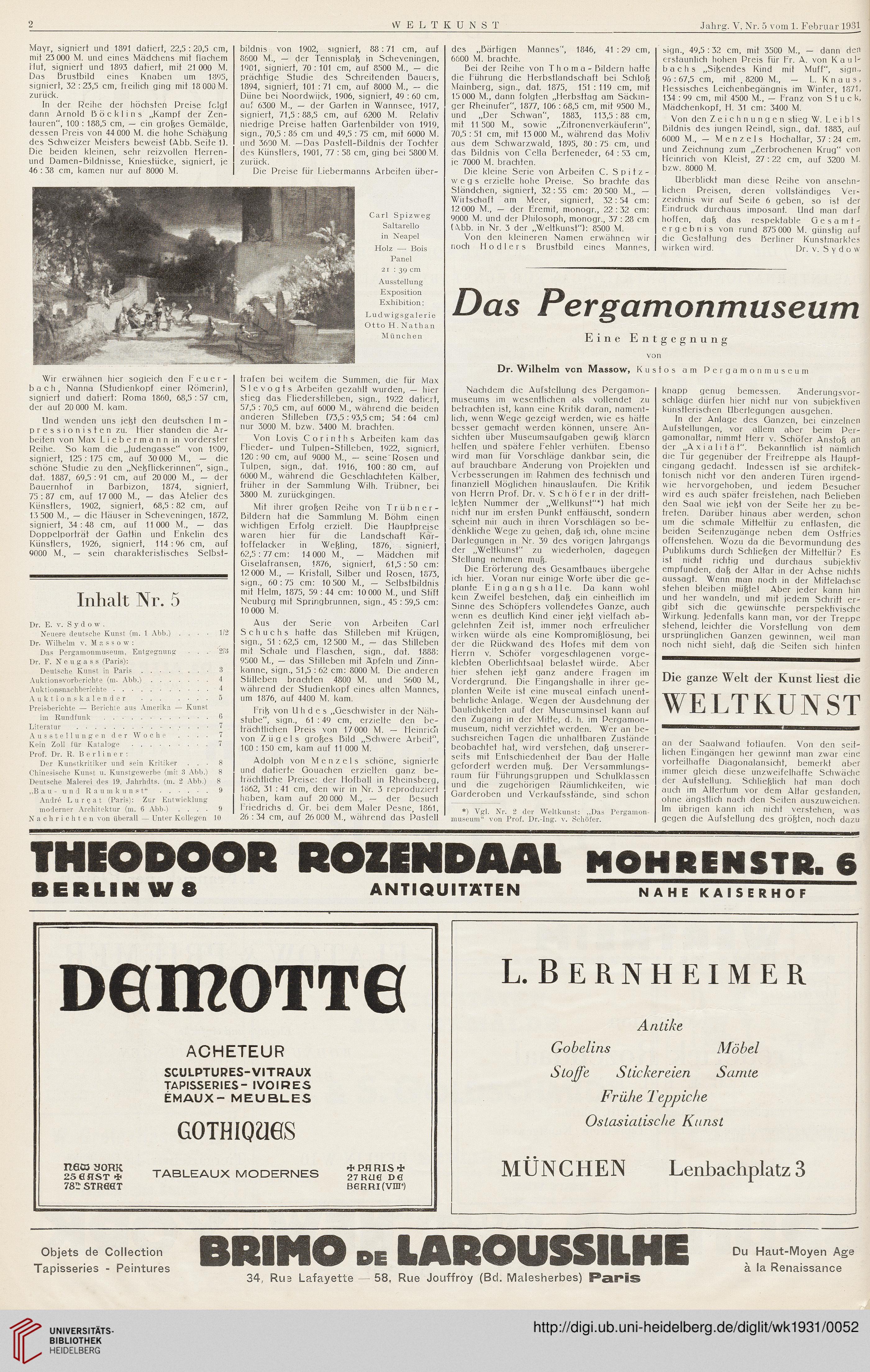2
WELTKUNST
Jahrg. V, Nr. 5 vom 1. Februar 1931
Mayr, signiert und 1891 datiert, 22,5:20,5 cm,
mit 23 000 M. und eines Mädchens mit flachem
Hut, signiert und 1893 datiert, mit 21 000 M.
Das Brustbild eines Knaben um 1895,
signiert, 32 : 23,5 cm, freilich ging mit 18 000 M.
zurück.
In der Reihe der höchsten Preise felgt
dann Arnold Bö c kl ins „Kampf der Zen-
tauren“, ICO : 188,5 cm, — ein großes Gemälde,
dessen Preis von 44 000 M. die hohe Schätzung
des Schweizer Meisters beweist (Abb. Seite 1).
Die beiden kleinen, sehr reizvollen Herren-
und Damen-Bildnisse, Kniestücke, signiert, je
46 : 38 cm, kamen nur auf 8000 M.
bildnis von 1902, signiert, 88 :71 cm, auf
8600 M., — der Tennisplaß in Scheveningen,
1901, signiert, 70: 101 cm, auf 8500 M., — die
prächtige Studie des Schreitenden Bauers,
1894, signiert, 101 : 71 cm, auf 8000 M., — die
Düne bei Noordwijck, 1906, signiert, 49 : 60 cm,
auf 6300 M., — der Garten in Wannsee, 1917,
signiert, 71,5:88,5 cm, auf 6200 M. Relativ
niedrige Preise hatten Gartenbilder von 1919,
sign., 70,5 : 85 cm und 49,5 : 75 cm, mit 6000 M.
und 3600 M. —Das Pasfell-Bildnis der Tochter
des Künstlers, 1901, 77 : 58 cm, ging bei 5800 M.
zurück.
Die Preise für Liebermanns Arbeiten über-
Carl Spizweg
Saltarello
in Neapel
Holz — Bois
Panel
21 : 39 cm
Ausstellung
Exposition
Exhibition:
Ludwigsgalerie
Otto H. Nathan
München
Wir erwähnen hier sogieich den Feuer-
bach, Nanna (Studienkopf einer Römerin),
signiert und datiert: Roma 1860, 68,5 : 57 cm,
der auf 20 000 M. kam.
Und wenden uns jeßt den deutschen Im-
pressionisten zu. Hier standen die Ar-
beiten von Max Liebermann in vorderster
Reihe. So kam die „Judengasse“ von 1909,
signiert, 125:175 cm, auf 30 000 M., — die
schöne Studie zu den „Neßflickerinnen", sign.,
dat. 1887, 69,5:91 cm, auf 20 000 M., - der
Bauernhof in Barbizon, 1874, signiert,
75:87 cm, auf 17 000 M., — das Atelier des
Künstlers, 1902, signiert, 68,5 :82 cm, auf
13 500 M., — die Häuser in Scheveningen, 1872,
signiert, 34:48 cm, auf 11 000 M., — das
Doppelporträt der Gattin und Enkelin des
Künstlers, 1926, signiert, 114:96 cm, auf
9000 M., — sein charakteristisches Selbst-
Inhalt Nr. 5
Dr. E. v. S y d o w .
Neuere deutsche Kunst (m. t Abb.) . . • ■ 1/2
Dr. Wilhelm v. M a s s o w :
Das Pergamonmuseum, Entgegnung ... 2/3
Dr. F. Ne ugass (Paris):
Deutsche Kunst in Paris ..■•••■■ 3
Auktionsvoirberichte (m- Abb.).■ ■ 4
Auktionsnachberichte ........... 4
A u k t i o n s k a 1 e n d e r ■ . . . • - . 5
Preisberichte — Berichte aus Amerika — Kunst
im Rundfunk .. 6
Literatur . ■ • • ■ 7
Ausstellungen der Woche . ■ . . 7
Kein Zoll für Kataloge .......... 7
Prof. Dr. R. Berliner:
Der Kunstkritiker und sein Kritiker ... 8
Chinesische Kunst u. Kunstgewer.be (mit 3 Abb.) 8
Deutsche Malerei des 19. Jahrhdts. (m. 2 Abb.) 8
..Bau - und Raumkunst“ ■ . ■ • ■ • 9
Andre Lur?at (Paris): Zur Entwicklung
moderner Architektur (m. 6 Abb-) .... 9
Nachrichten von überall — Unter Kollegen 10
trafen bei weitem die Summen, die für Max
Slevogts Arbeiten gezahlt wurden, — hier
stieg das Fliederstilleben, sign., 1922 datiert,
57,5 : 70,5 cm, auf 6000 M., während die beiden
anderen Stilleben (73,5 : 93,5 cm; 54 : 64 cm)
nur 3000 M. bzw. 3400 M. brachten.
Von Lovis Corinths Arbeiten kam das
Flieder- und Tulpen-Stilleben, 1922, signiert,
120:90 cm, auf 9000 M., — seine 'Rosen und
Tulpen, sign., dat. 1916, 100:80 cm, auf
6000 M., während die Geschlachteten Kälber,
früher in der Sammlung Wilh. Trübner, bei
3800 M. zurückgingen.
Mit ihrer großen Reihe von Trübner-
Bildern hat die Sammlung M. Böhm einen
wichtigen Erfolg erzielt. Die Hauptpreise
waren hier für die Landschaft Kar-
toffelacker in Webling, 1876, signiert,
62,5:77 cm: 14 000 M., — Mädchen mit
Giselafransen, 1876, signiert, 61,5 :50 cm:
12 000 M., — Kristall, Silber und Rosen, 1873,
sign., 60:75 cm: 10 500 M., — Selbstbildnis
mit Helm, 1875, 59:44 cm: 10 000 M., und Stift
Neuburg mit Springbrunnen, sign., 45 : 59,5 cm:
10 000 M.
Aus der Serie von Arbeiten Carl
Schuchs hatte das Stiileben mit Krügen,
sign., 51 : 62,5 cm, 12 500 M., — das Stilleben
mit Schale und Flaschen, sign., dat. 1888:
9500 M., — das Stilleben mit Äpfeln und Zinn-
kanne, sign., 51,5 : 62 cm: 8000 M. Die anderen
Stilleben brachten 4800 M. und 5600 M.,
während der Sfudienkopf eines alten Mannes,
um 1876, auf 4400 M. kam.
Friß von Uhdes „Geschwister in der Näh-
stube“, sign., 61 :49 cm, erzielte den be-
trächtlichen Preis von 17 000 M. — Heinrich
von Zügels großes Bild „Schwere Arbeit'”',
100 : 150 cm, kam auf 11 000 M.
Adolph von Menzels schöne, signierte
und datierte Gouachen erzielten ganz be-
trächtliche Preise: der Hofball in Rheinsberg,
1862, 31 : 41 cm, den wir in Nr. 3 reproduziert
haben, kam auf 20 000 M., — der Besuch
Friedrichs d. Gr. bei dem Maler Pesne, 1861,
26 : 34 cm, auf 26 000 M., während das Pastell
des „Bärtigen Mannes“, 1846, 41 :29 cm,
6600 M. brachte.
Bei der Reihe von T h o m a - Bildern hatte
die Führung die Herbstlandschaft bei Schlot,
Mainberg, sign., dat. 1875, 151 : 119 cm, mit
15 000 M., dann folgten „Herbsttag am Säckin-
ger Rheinufer", 1877, 106 : 68,5 cm, mit 9500 M.,
und „Der Schwan“, 1883, 113,5:88 cm,
mit 11 500 M., sowie „Zitronenverkäuferin“,
70,5:51 cm, mit 13 000 M., während das Motiv
aus dem Schwarzwald, 1895, 80 : 75 cm, und
das Bildnis von Cella Berteneder, 64 : 53 cm,
ie 7000 M. brachten.
Die kleine Serie von Arbeiten C. Spitz-
w e g s erzielte hohe Preise. So brachte das
Ständchen, signiert, 32:55 cm: 20 500 M,, —
Wiitschaff am Meer, signiert, 32:54 cm:
12 000 M., — der Eremit, monogr., 22:32 cm:
9000 M. und der Philosoph, monogr., 37 : 28 cm
(Abb. in Nr. 3 der „Weltkunst"): 8500 M.
Von den kleineren Namen erwähnen wir
noch Hodlers Brustbild eines Mannes,
sign., 49,5 :32 cm, mit 3500 M., — dann den
erstaunlich hohen Preis für Fr. A. von Kaul'
b a c h s „Sißendes Kind mit Muff", sign-,
96 : 67,5 cm, mit . 8200 M., — L. Knaus,
Hessisches Leichenbegängnis im Winter, 1871,
134 : 99 cm, mit 4500 M., — Franz von S 1 u c k,
Mädchenkopf, H. 31 cm: 3400 M.
Von den Zeichnungen stieg W. Leibis
Bildnis des jungen Reindl, sign., dat. 1883, auf
6000 M., — Menzels Hochaltar, 37 :24 cm,
und Zeichnung zum „Zerbrochenen Krug“ von
Heinrich von Kleist, 27:22 cm, auf 3200 M.
bzw. 8000 M.
überblickt man diese Reihe von ansehn-
lichen Preisen, deren vollständiges Ver-
zeichnis wir auf Seite 6 geben, so ist der
Eindruck durchaus imposant. Und man darf
hoffen, daß das respektable Gesamt-
ergebnis von rund 875 000 M. günstig auf
die Gestaltung des Berliner Kunstmarkfes
wirken wird. Dr. v. S y d o w
Das Pergamonmuseum
Eine Entgegnung
von
Dr. Wilhelm von Massow, Kustos am Pergamonmuseum
Nachdem die Aufstellung des Pergamon-
museums im wesentlichen als vollendet zu
betrachten ist, kann eine Kritik daran, nament-
lich, wenn Wege gezeigt werden, wie es hätte
besser gemacht werden können, unsere An-
sichten über Museumsaufgaben gewiß klären
helfen und spätere Fehler verhüten. Ebenso
wird man für Vorschläge dankbar sein, die
auf brauchbare Änderung von Projekten und
Verbesserungen im Rahmen des technisch und
finanziell Möglichen hinauslaufen. Die Kritik
von Herrn Prof. Dr. v. S c h ö f e r in der dritt-
letzten Nummer der „Weltkunst"*) hat mich
nicht nur im ersten Punkt enttäuscht, sondern
scheint mir auch in ihren Vorschlägen so be-
denkliche Wege zu gehen, daß ich, ohne meine
Darlegungen in Nr. 39 des vorigen Jahrgangs
der „Weltkunst" zu wiederholen, dagegen
Stellung nehmen muß.
Die Erörterung des Gesamtbaues übergehe
ich hier. Voran nur einige Worte über die ge-
plante Eingangshalle. Da kann wohl
kein Zweifel bestehen, daß ein einheitlich im
Sinne des Schöpfers vollendetes Ganze, auch
wenn es deutlich Kind einer jetzt vielfach ab-
gelehnfen Zeit ist, immer noch erfreulicher
wirken würde als eine Kompromißlösung, bei
der die Rückwand des Hofes mit dem von
Herrn v. Schöfer vorgeschlagenen vorge-
klebten Oberlichtsaal belastet würde. Aber
hier stehen jeßt ganz andere Fragen im
Vordergrund. Die Eingangshalle in ihrer ge-
planten Weife ist eine museal einfach unent-
behrliche Anlage. Wegen der Ausdehnung der
Baulichkeiten auf der Museumsinsel kann auf
den Zugang in der Mitte, d. h. im Pergamon-
museum, nicht verzichtet werden. Wer an be-
suchsreichen Tagen die unhaltbaren Zustände
beobachtet hat, wird verstehen, daß unserer-
seits mit Entschiedenheit der Bau der Halle
gefordert werden muß. Der Versammlungs-
raum für Führungsgruppen und Schulklassen
und die zugehörigen Räumlichkeiten, wie
Garderoben und Verkaufsstände, sind schon
*) Vgl. Nr. 2 der Weltkunst: „Das Pergamon-
museum“ von Prof. Dr.-Ing. v. Schöfer.
knapp genug bemessen. Änderungsvor-
schläge dürfen hier nicht nur von subjektiven
künstlerischen Überlegungen ausgehen.
In der Anlage des Ganzen, bei einzelnen
Aufstellungen, vor allem aber beim Per-
gamonaltar, nimmt Herr v. Schöfer Anstoß an
der „A x i a 1 i t ä t". Bekanntlich ist nämlich
die Tür gegenüber der Freitreppe als Haupt-
eingang gedacht. Indessen ist sie architek-
tonisch nicht vor den anderen Türen irgend-
wie hervorgehoben, und jedem Besucher
wird es auch später freistehen, nach Belieben
den Saal wie jeßt von der Seite her zu be-
treten. Darüber hinaus aber werden, schon
um die schmale Mitteltür zu entlasten, die
beiden Seitenzugänge neben dem Os’tfries
offenstehen. Wozu da die Bevormundung des
Publikums durch Schließen der Mitteltür? Es
ist nicht richtig und durchaus subjektiv
empfunden, daß der Altar in der Achse nichts
aussagt. Wenn man noch in der Mittelachse
stehen bleiben müßte! Aber jeder kann hin
und her wandeln, und mit jedem Schrift er-
gibt sich die gewünschte perspektivische
Wirkung. Jedenfalls kann man, vor der Treppe
stehend, leichter die Vorstellung von dem
ursprünglichen Ganzen gewinnen, weil man
noch nicht sieht, daß die Seiten sich hinten
Die ganze Welt der Kunst liest die
WELTKUNST
an der Saalwand totlaufen. Von den seit-
lichen Eingängen her gewinnt man zwar eine
vorteilhafte Diagonalansicht, bemerkt aber
immer gleich diese unzweifelhafte Schwäche
der Aufstellung. Schließlich hat man doch
auch im Altertum vor dem Altar gestanden,
ohne ängstlich nach den Seiten auszuweichen.
Im übrigen kann ich nicht verstehen, was
gegen die Aufstellung des größten, noch dazu
THEODOOR ROZENDAAL mohrenstr. 6
BERLIN W 8
ANTIQUITÄTEN
NAHE KAISERHOF
DemoTTe
ACHETEUR
SCULPTURES-VITRAUX
TAPISSERIES- IVOIRES
EMAUX-MEUBLES
G0THIQÜ6S
neco bork
25 6HST *
78ÜI STR66T
TABLEAUX MODERNES
* PARIS*
27 RÜG »6
BßRRi(vnr)
L. Bernheimer
Antike
Gobelins Möbel
Stoffe Stickereien Samte
Frühe Teppiche
Ostasiatische Kunst
MÜNCHEN Lenbachplatz 3
BRIMO de LAROUSSILHE
34, Rue Lafayette 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes)
Objets de Collection
Tapisseries - Peintures
Du Haut-Moyen Age
ä la Renaissance
WELTKUNST
Jahrg. V, Nr. 5 vom 1. Februar 1931
Mayr, signiert und 1891 datiert, 22,5:20,5 cm,
mit 23 000 M. und eines Mädchens mit flachem
Hut, signiert und 1893 datiert, mit 21 000 M.
Das Brustbild eines Knaben um 1895,
signiert, 32 : 23,5 cm, freilich ging mit 18 000 M.
zurück.
In der Reihe der höchsten Preise felgt
dann Arnold Bö c kl ins „Kampf der Zen-
tauren“, ICO : 188,5 cm, — ein großes Gemälde,
dessen Preis von 44 000 M. die hohe Schätzung
des Schweizer Meisters beweist (Abb. Seite 1).
Die beiden kleinen, sehr reizvollen Herren-
und Damen-Bildnisse, Kniestücke, signiert, je
46 : 38 cm, kamen nur auf 8000 M.
bildnis von 1902, signiert, 88 :71 cm, auf
8600 M., — der Tennisplaß in Scheveningen,
1901, signiert, 70: 101 cm, auf 8500 M., — die
prächtige Studie des Schreitenden Bauers,
1894, signiert, 101 : 71 cm, auf 8000 M., — die
Düne bei Noordwijck, 1906, signiert, 49 : 60 cm,
auf 6300 M., — der Garten in Wannsee, 1917,
signiert, 71,5:88,5 cm, auf 6200 M. Relativ
niedrige Preise hatten Gartenbilder von 1919,
sign., 70,5 : 85 cm und 49,5 : 75 cm, mit 6000 M.
und 3600 M. —Das Pasfell-Bildnis der Tochter
des Künstlers, 1901, 77 : 58 cm, ging bei 5800 M.
zurück.
Die Preise für Liebermanns Arbeiten über-
Carl Spizweg
Saltarello
in Neapel
Holz — Bois
Panel
21 : 39 cm
Ausstellung
Exposition
Exhibition:
Ludwigsgalerie
Otto H. Nathan
München
Wir erwähnen hier sogieich den Feuer-
bach, Nanna (Studienkopf einer Römerin),
signiert und datiert: Roma 1860, 68,5 : 57 cm,
der auf 20 000 M. kam.
Und wenden uns jeßt den deutschen Im-
pressionisten zu. Hier standen die Ar-
beiten von Max Liebermann in vorderster
Reihe. So kam die „Judengasse“ von 1909,
signiert, 125:175 cm, auf 30 000 M., — die
schöne Studie zu den „Neßflickerinnen", sign.,
dat. 1887, 69,5:91 cm, auf 20 000 M., - der
Bauernhof in Barbizon, 1874, signiert,
75:87 cm, auf 17 000 M., — das Atelier des
Künstlers, 1902, signiert, 68,5 :82 cm, auf
13 500 M., — die Häuser in Scheveningen, 1872,
signiert, 34:48 cm, auf 11 000 M., — das
Doppelporträt der Gattin und Enkelin des
Künstlers, 1926, signiert, 114:96 cm, auf
9000 M., — sein charakteristisches Selbst-
Inhalt Nr. 5
Dr. E. v. S y d o w .
Neuere deutsche Kunst (m. t Abb.) . . • ■ 1/2
Dr. Wilhelm v. M a s s o w :
Das Pergamonmuseum, Entgegnung ... 2/3
Dr. F. Ne ugass (Paris):
Deutsche Kunst in Paris ..■•••■■ 3
Auktionsvoirberichte (m- Abb.).■ ■ 4
Auktionsnachberichte ........... 4
A u k t i o n s k a 1 e n d e r ■ . . . • - . 5
Preisberichte — Berichte aus Amerika — Kunst
im Rundfunk .. 6
Literatur . ■ • • ■ 7
Ausstellungen der Woche . ■ . . 7
Kein Zoll für Kataloge .......... 7
Prof. Dr. R. Berliner:
Der Kunstkritiker und sein Kritiker ... 8
Chinesische Kunst u. Kunstgewer.be (mit 3 Abb.) 8
Deutsche Malerei des 19. Jahrhdts. (m. 2 Abb.) 8
..Bau - und Raumkunst“ ■ . ■ • ■ • 9
Andre Lur?at (Paris): Zur Entwicklung
moderner Architektur (m. 6 Abb-) .... 9
Nachrichten von überall — Unter Kollegen 10
trafen bei weitem die Summen, die für Max
Slevogts Arbeiten gezahlt wurden, — hier
stieg das Fliederstilleben, sign., 1922 datiert,
57,5 : 70,5 cm, auf 6000 M., während die beiden
anderen Stilleben (73,5 : 93,5 cm; 54 : 64 cm)
nur 3000 M. bzw. 3400 M. brachten.
Von Lovis Corinths Arbeiten kam das
Flieder- und Tulpen-Stilleben, 1922, signiert,
120:90 cm, auf 9000 M., — seine 'Rosen und
Tulpen, sign., dat. 1916, 100:80 cm, auf
6000 M., während die Geschlachteten Kälber,
früher in der Sammlung Wilh. Trübner, bei
3800 M. zurückgingen.
Mit ihrer großen Reihe von Trübner-
Bildern hat die Sammlung M. Böhm einen
wichtigen Erfolg erzielt. Die Hauptpreise
waren hier für die Landschaft Kar-
toffelacker in Webling, 1876, signiert,
62,5:77 cm: 14 000 M., — Mädchen mit
Giselafransen, 1876, signiert, 61,5 :50 cm:
12 000 M., — Kristall, Silber und Rosen, 1873,
sign., 60:75 cm: 10 500 M., — Selbstbildnis
mit Helm, 1875, 59:44 cm: 10 000 M., und Stift
Neuburg mit Springbrunnen, sign., 45 : 59,5 cm:
10 000 M.
Aus der Serie von Arbeiten Carl
Schuchs hatte das Stiileben mit Krügen,
sign., 51 : 62,5 cm, 12 500 M., — das Stilleben
mit Schale und Flaschen, sign., dat. 1888:
9500 M., — das Stilleben mit Äpfeln und Zinn-
kanne, sign., 51,5 : 62 cm: 8000 M. Die anderen
Stilleben brachten 4800 M. und 5600 M.,
während der Sfudienkopf eines alten Mannes,
um 1876, auf 4400 M. kam.
Friß von Uhdes „Geschwister in der Näh-
stube“, sign., 61 :49 cm, erzielte den be-
trächtlichen Preis von 17 000 M. — Heinrich
von Zügels großes Bild „Schwere Arbeit'”',
100 : 150 cm, kam auf 11 000 M.
Adolph von Menzels schöne, signierte
und datierte Gouachen erzielten ganz be-
trächtliche Preise: der Hofball in Rheinsberg,
1862, 31 : 41 cm, den wir in Nr. 3 reproduziert
haben, kam auf 20 000 M., — der Besuch
Friedrichs d. Gr. bei dem Maler Pesne, 1861,
26 : 34 cm, auf 26 000 M., während das Pastell
des „Bärtigen Mannes“, 1846, 41 :29 cm,
6600 M. brachte.
Bei der Reihe von T h o m a - Bildern hatte
die Führung die Herbstlandschaft bei Schlot,
Mainberg, sign., dat. 1875, 151 : 119 cm, mit
15 000 M., dann folgten „Herbsttag am Säckin-
ger Rheinufer", 1877, 106 : 68,5 cm, mit 9500 M.,
und „Der Schwan“, 1883, 113,5:88 cm,
mit 11 500 M., sowie „Zitronenverkäuferin“,
70,5:51 cm, mit 13 000 M., während das Motiv
aus dem Schwarzwald, 1895, 80 : 75 cm, und
das Bildnis von Cella Berteneder, 64 : 53 cm,
ie 7000 M. brachten.
Die kleine Serie von Arbeiten C. Spitz-
w e g s erzielte hohe Preise. So brachte das
Ständchen, signiert, 32:55 cm: 20 500 M,, —
Wiitschaff am Meer, signiert, 32:54 cm:
12 000 M., — der Eremit, monogr., 22:32 cm:
9000 M. und der Philosoph, monogr., 37 : 28 cm
(Abb. in Nr. 3 der „Weltkunst"): 8500 M.
Von den kleineren Namen erwähnen wir
noch Hodlers Brustbild eines Mannes,
sign., 49,5 :32 cm, mit 3500 M., — dann den
erstaunlich hohen Preis für Fr. A. von Kaul'
b a c h s „Sißendes Kind mit Muff", sign-,
96 : 67,5 cm, mit . 8200 M., — L. Knaus,
Hessisches Leichenbegängnis im Winter, 1871,
134 : 99 cm, mit 4500 M., — Franz von S 1 u c k,
Mädchenkopf, H. 31 cm: 3400 M.
Von den Zeichnungen stieg W. Leibis
Bildnis des jungen Reindl, sign., dat. 1883, auf
6000 M., — Menzels Hochaltar, 37 :24 cm,
und Zeichnung zum „Zerbrochenen Krug“ von
Heinrich von Kleist, 27:22 cm, auf 3200 M.
bzw. 8000 M.
überblickt man diese Reihe von ansehn-
lichen Preisen, deren vollständiges Ver-
zeichnis wir auf Seite 6 geben, so ist der
Eindruck durchaus imposant. Und man darf
hoffen, daß das respektable Gesamt-
ergebnis von rund 875 000 M. günstig auf
die Gestaltung des Berliner Kunstmarkfes
wirken wird. Dr. v. S y d o w
Das Pergamonmuseum
Eine Entgegnung
von
Dr. Wilhelm von Massow, Kustos am Pergamonmuseum
Nachdem die Aufstellung des Pergamon-
museums im wesentlichen als vollendet zu
betrachten ist, kann eine Kritik daran, nament-
lich, wenn Wege gezeigt werden, wie es hätte
besser gemacht werden können, unsere An-
sichten über Museumsaufgaben gewiß klären
helfen und spätere Fehler verhüten. Ebenso
wird man für Vorschläge dankbar sein, die
auf brauchbare Änderung von Projekten und
Verbesserungen im Rahmen des technisch und
finanziell Möglichen hinauslaufen. Die Kritik
von Herrn Prof. Dr. v. S c h ö f e r in der dritt-
letzten Nummer der „Weltkunst"*) hat mich
nicht nur im ersten Punkt enttäuscht, sondern
scheint mir auch in ihren Vorschlägen so be-
denkliche Wege zu gehen, daß ich, ohne meine
Darlegungen in Nr. 39 des vorigen Jahrgangs
der „Weltkunst" zu wiederholen, dagegen
Stellung nehmen muß.
Die Erörterung des Gesamtbaues übergehe
ich hier. Voran nur einige Worte über die ge-
plante Eingangshalle. Da kann wohl
kein Zweifel bestehen, daß ein einheitlich im
Sinne des Schöpfers vollendetes Ganze, auch
wenn es deutlich Kind einer jetzt vielfach ab-
gelehnfen Zeit ist, immer noch erfreulicher
wirken würde als eine Kompromißlösung, bei
der die Rückwand des Hofes mit dem von
Herrn v. Schöfer vorgeschlagenen vorge-
klebten Oberlichtsaal belastet würde. Aber
hier stehen jeßt ganz andere Fragen im
Vordergrund. Die Eingangshalle in ihrer ge-
planten Weife ist eine museal einfach unent-
behrliche Anlage. Wegen der Ausdehnung der
Baulichkeiten auf der Museumsinsel kann auf
den Zugang in der Mitte, d. h. im Pergamon-
museum, nicht verzichtet werden. Wer an be-
suchsreichen Tagen die unhaltbaren Zustände
beobachtet hat, wird verstehen, daß unserer-
seits mit Entschiedenheit der Bau der Halle
gefordert werden muß. Der Versammlungs-
raum für Führungsgruppen und Schulklassen
und die zugehörigen Räumlichkeiten, wie
Garderoben und Verkaufsstände, sind schon
*) Vgl. Nr. 2 der Weltkunst: „Das Pergamon-
museum“ von Prof. Dr.-Ing. v. Schöfer.
knapp genug bemessen. Änderungsvor-
schläge dürfen hier nicht nur von subjektiven
künstlerischen Überlegungen ausgehen.
In der Anlage des Ganzen, bei einzelnen
Aufstellungen, vor allem aber beim Per-
gamonaltar, nimmt Herr v. Schöfer Anstoß an
der „A x i a 1 i t ä t". Bekanntlich ist nämlich
die Tür gegenüber der Freitreppe als Haupt-
eingang gedacht. Indessen ist sie architek-
tonisch nicht vor den anderen Türen irgend-
wie hervorgehoben, und jedem Besucher
wird es auch später freistehen, nach Belieben
den Saal wie jeßt von der Seite her zu be-
treten. Darüber hinaus aber werden, schon
um die schmale Mitteltür zu entlasten, die
beiden Seitenzugänge neben dem Os’tfries
offenstehen. Wozu da die Bevormundung des
Publikums durch Schließen der Mitteltür? Es
ist nicht richtig und durchaus subjektiv
empfunden, daß der Altar in der Achse nichts
aussagt. Wenn man noch in der Mittelachse
stehen bleiben müßte! Aber jeder kann hin
und her wandeln, und mit jedem Schrift er-
gibt sich die gewünschte perspektivische
Wirkung. Jedenfalls kann man, vor der Treppe
stehend, leichter die Vorstellung von dem
ursprünglichen Ganzen gewinnen, weil man
noch nicht sieht, daß die Seiten sich hinten
Die ganze Welt der Kunst liest die
WELTKUNST
an der Saalwand totlaufen. Von den seit-
lichen Eingängen her gewinnt man zwar eine
vorteilhafte Diagonalansicht, bemerkt aber
immer gleich diese unzweifelhafte Schwäche
der Aufstellung. Schließlich hat man doch
auch im Altertum vor dem Altar gestanden,
ohne ängstlich nach den Seiten auszuweichen.
Im übrigen kann ich nicht verstehen, was
gegen die Aufstellung des größten, noch dazu
THEODOOR ROZENDAAL mohrenstr. 6
BERLIN W 8
ANTIQUITÄTEN
NAHE KAISERHOF
DemoTTe
ACHETEUR
SCULPTURES-VITRAUX
TAPISSERIES- IVOIRES
EMAUX-MEUBLES
G0THIQÜ6S
neco bork
25 6HST *
78ÜI STR66T
TABLEAUX MODERNES
* PARIS*
27 RÜG »6
BßRRi(vnr)
L. Bernheimer
Antike
Gobelins Möbel
Stoffe Stickereien Samte
Frühe Teppiche
Ostasiatische Kunst
MÜNCHEN Lenbachplatz 3
BRIMO de LAROUSSILHE
34, Rue Lafayette 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes)
Objets de Collection
Tapisseries - Peintures
Du Haut-Moyen Age
ä la Renaissance