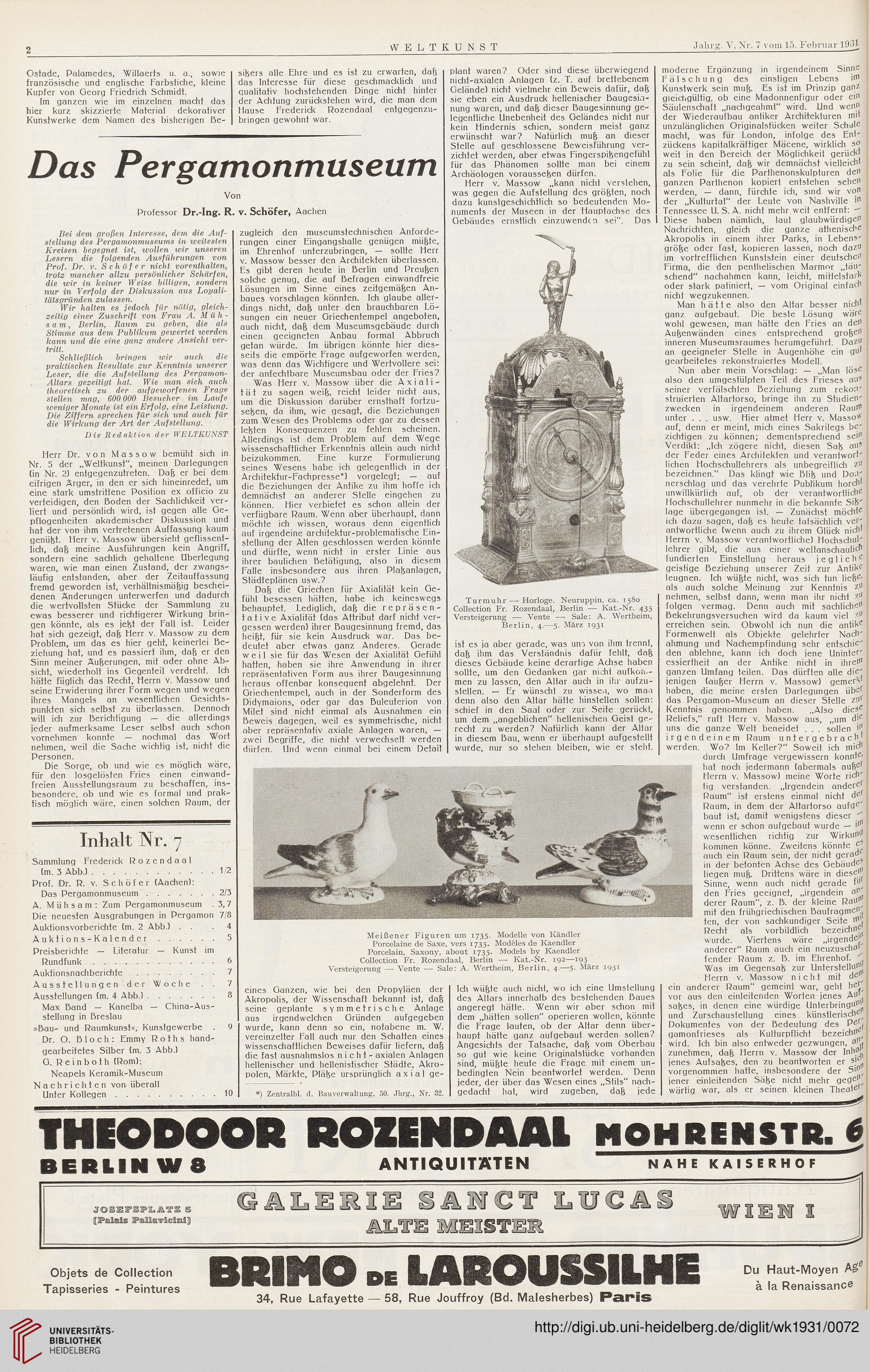2
WELTKUNST
Jahr.g. V, Nr. 7 vom 15. Februar 19-31
Ostade, Palamedes, Willaerts u. a., sowie
französische und englische Farbstiche, kleine
Kupfer von Georg Friedrich Schmidt.
Im ganzen wie im einzelnen macht das
hier kurz skizzierte Material dekorativer
Kunstwerke dem Namen des bisherigen Be-
Das Pergamonmuseum
Von
Mo-
Professor Dr.-Ing. R. v. Schöfer, Aachen
9
10
Der
des
von
ein
abgelehnt.
Sonderform
Buleuterion
Ausnahmen
für Axialität kein Ge-
habe ich keineswegs
daß die repräsen-
Attribuf darf nicht ver-
6
7
7
8
2/3
3,7
7/8
4
5
Be¬
den
Ab-
Ich
und
sißers alle Ehre und es ist zu erwarten, daß
das Interesse für diese geschmacklich und
qualitativ hochstehenden Dinge nicht hinter
der Achtung zurückstehen wird, die man dem
Hause Frederick Rozendaal entgegenzu-
bringen gewohnt war.
eines Ganzen, wie bei den Propyläen der
Akropolis, der Wissenschaft bekannt ist, daß
seine geplante symmetrische Anlage
aus irgendwelchen Gründen aufgegeben
wurde, kann denn so ein, notabene m. W.
vereinzelter Fall auch nur den Schatten eines
wissenschaftlichen Beweises dafür liefern, daß
die fast ausnahmslos nicht- axialen Anlagen
hellenischer und hellenistischer Städte, Akro-
polen, Märkte, Pläße ursprünglich axial ge-
ist es ja aber gerade, was uns von ihm trenn!,
daß ihm das Verständnis dafür fehlt, daß
dieses Gebäude keine derartige Achse haben
sollte, um den Gedanken gar nicht aufkom-
men zu lassen, den Altar auch in ihr aufzu-
stellen. — Er wünscht zu wissen, wo man
denn also den Altar hätte hinstellen sollen:
schief in den Saal oder zur Seife gerückt,
um dem „angeblichen“ hellenischen Geist ge-
recht zu werden? Natürlich kann der Altar
in diesem Bau, wenn er überhaupt aufgestellt
wurde, nur so stehen bleiben, wie er steht.
Meißener Figuren um 1735. Modelle von Kandier
Porcelaine de Saxe, vers 1735. Modeles de Kaendler
Porcelain, Saxony, about 1735. Models by Kaendler
Collection Fr. Rozendaal, Berlin — Kat.-Nr. 192—193
Versteigerung — Vente — Sale: A. Wertheim, Berlin, 4.—-5. März 1931
Turmuhr — Horloge. Neuruppin, ca. 1580
Collection Fr. Rozendaal, Berlin — Kat.-Nr. 435
Versteigerung — Vente — Sale: A. Wertheim,
Berlin, 4.—5. März 1931
Bei dem großen Interesse, dem die Auf-
stellung des Pergamonmuseums in weitesten
Kreisen begegnet ist, wollen wir unseren
Lesern die folgenden Ausführungen von
Prof. Dr. v. Schöfer nicht vorenthalten,
trotz mancher allzu persönlicher Schärfen,
die wir in keiner Weise billigen, sondern
nur in Verfolg der Diskussion aus Loyali-
tätsgründen zulassen.
Wir halten es jedoch für nötig, gleich-
zeitig einer Zuschrift von Frau A. Müh-
sam, Berlin, Raum zu geben, die als
Stimme aus dem Publikum gewertet werden
kann und die eine ganz andere Ansicht ver-
tritt.
Schließlich bringen wir auch die
praktischen Resultate zur Kenntnis unserer
Leser, die die Aufstellung des Pergamon-
Altars gezeitigt hat. Wie man sich auch
theoretisch zu der aufgeworfenen Frage
stellen mag, 600 000 Besucher im Laufe
weniger Monate ist ein Erfolg, eine Leistung.
Die Ziffern sprechen für sich und auch für
die Wirkung der Art der Aufstellung.
Die Redaktion der WELTKUNST
ihres Mangels an wesentlichen
punkten sich selbst zu überlassen,
will ich zur Berichtigung — die allerdings
jeder aufmerksame Leser selbst auch schon
vornehmen konnte — nochmal das Wort
nehmen, weil die Sache wichtig ist, nicht die
Personen.
Die Sorge, ob und wie es möglich wäre,
für den losgelösten Fries einen einwand-
freien Ausstellungsraum zu beschaffen, ins-
besondere, ob und wie es formal und prak-
tisch möglich wäre, einen solchen Raum, der
Ich wüßte auch nicht, wo ich eine Umstellung
des Altars innerhalb des bestehenden Baues
angeregt hätte. Wenn wir aber schon mit
dem „hätten sollen“ operieren wollen, könnte
die Frage laufen, ob der Altar denn über-
haupt hätte ganz aufgebaut werden sollen?
Angesichts der Tatsache, daß vom Oberbau
so gut wie keine Originalstücke vorhanden
sind, müßte heute die Frage mit einem un-
bedingten Nein beantwortet werden. Denn
jeder, der über das Wesen eines „Stils“ nach-
gedacht hat, wird zugeben, daß jede
Herr Dr. von Massow bemüht sich in
Nr. 5 der „Welfkunst“, meinen Darlegungen
(in Nr. 2) entgegenzutreten. Daß er bei dem
eifrigen Ärger, in den er sich hineinredet, um
eine stark umstrittene Position ex officio zu
verteidigen, den Boden der Sachlichkeit ver-
liert und persönlich wird, ist gegen alle Ge-
pflogenheiten akademischer Diskussion und
hat der von ihm vertretenen Auffassung kaum
genüßt. Herr v. Massow übersieht geflissent-
lich, daß meine Ausführungen kein Angriff,
sondern eine sachlich gehaltene Überlegung
waren, wie man einen Zustand, der zwangs-
läufig entstanden, aber der Zeitauffassung
fremd geworden ist, verhältnismäßig beschei-
denen Änderungen unterwerfen und dadurch
die wertvollsten Stücke der Sammlung zu
ewas besserer und richtigerer Wirkung brin-
gen könnte, als es jeßt der Fall ist. Leider
hat sich gezeigt, daß Herr v. Massow zu dem
Problem, um das es hier geht, keinerlei
Ziehung hat, und es passiert ihm, daß er
Sinn meiner Äußerungen, mit oder ohne
sicht, wiederholt ins Gegenteil verdreht,
hätte füglich das Recht, Herrn v. Massow
seine Erwiderung ihrer Form wegen und wegen
Gesichts-
Dennoch
zugleich den museumstechnischen Anforde-
rungen einer Eingangshalle genügen müßte,
im Ehrenhof unterzubringen, — sollte Herr
v. Massow besser den Architekten überlassen.
Es gibt deren heute in Berlin und Preußen
solche genug, die auf Befragen einwandfreie
Lösungen im Sinne eines zeitgemäßen An-
baues Vorschlägen könnten. Ich glaube aller-
dings nicht, daß unter den brauchbaren Lö-
sungen ein neuer Griechentempel angeboten,
auch nicht, daß dem Museumsgebäude durch
einen geeigneten Anbau formal Abbruch
getan würde. Im übrigen könnte hier dies-
seits die empörte Frage aufgeworfen werden,
was denn das Wichtigere und Wertvollere sei:
der anfechtbare Museumsbau oder der Fries?
Was Herr v. Massow über die Axiali-
tät zu sagen weiß, reicht leider nicht aus,
um die Diskussion darüber ernsthaft fortzu-
seßen, da ihm, wie gesagt, die Beziehungen
zum Wesen des Problems oder gar zu dessen
leßten Konsequenzen zu fehlen scheinen.
Allerdings ist dem Problem auf dem Wege
wissenschaftlicher Erkenntnis allein auch nicht
beizukommen. Eine kurze Formulierung
seines Wesens habe ich gelegentlich in der
Architektur-Fachpresse*) vorgelegt; — auf
die Beziehungen der Antike zu ihm hoffe ich
demnächst an anderer Stelle eingehen zu
können. Hier verbietet es schon allein der
verfügbare Raum. Wenn aber überhaupt, dann
möchte ich wissen, woraus denn eigentlich
auf irgendeine architektur-problematische Ein-
stellung der Alten geschlossen werden könnte
und dürfte, wenn nicht in erster Linie aus
ihrer baulichen Betätigung, also in diesem
Falle insbesondere aus ihren Plaßanlagen,
Städteplänen usw.?
Daß die Griechen
fühl besessen hätten,
behauptet. Lediglich,
tative Axialität (das
gessen werden) ihrer Baugesinnung fremd, das
heißt, für sie kein Ausdruck war. Das be-
deutet aber etwas ganz Anderes. Gerade
weil sie für das Wesen der Axialität Gefühl
hatten, haben sie ihre Anwendung in ihrer
repräsentativen Form aus ihrer Baugesinnung
heraus offenbar konsequent
Griechentempel, auch in der
Didymaions, oder gar das
Milet sind nicht einmal als
Beweis dagegen, weil es symmetrische, nicht
aber repräsentativ axiale Anlagen waren, —
zwei Begriffe, die nicht verwechselt werden
dürfen. Und wenn einmal bei einem Detail
*) Zentralbl. d. Bauverwaltung, 50. Jhrg., Nr. 32.
plant waren? Oder sind diese überwiegend
nicht-axialen Anlagen (z. T. auf brettebenem
Gelände) nicht vielmehr ein Beweis dafür, daß
sie eben ein Ausdruck hellenischer Baugesin-
nung waren, und daß dieser Baugesinnung ge-
legentliche Unebenheit des Geländes nicht nur
kein Hindernis schien, sondern meist ganz
erwünscht war? Natürlich muß an dieser
Stelle auf geschlossene Beweisführung ver-
zichtet werden, aber etwas Fingerspißengefühl
für das Phänomen sollte man bei einem
Archäologen vorausseßen dürfen.
Herr v. Massow „kann nicht verslehen,
was gegen die Aufstellung des größten, noch
dazu kunstgeschichtlich so bedeutenden
numents der Museen in der Hauptachse
Gebäudes ernstlich einzuwenden sei".
moderne Ergänzung in irgendeinem Sinne
Fälschung des einstigen Lebens in1
Kunstwerk sein muß. Es ist im Prinzip ganz
gleichgültig, ob eine Madonnenfigur oder ein
Säulenschaft „nachgeahmi“ wird. Und wenn
der Wiederaufbau antiker Architekturen mi'
unzulänglichen Originalstücken weiter Schule
macht, was für London, infolge des Ent'
zückens kapitalkräftiger Mäcene, wirklich so
weit in den Bereich der Möglichkeit gerückt
zu sein scheint, daß wir demnächst vielleicht
als Folie für die Parthenonskulpiuren den
ganzen Parthenon kopiert entstehen sehen
werden, — dann, fürchte ich, sind wir von
der „Kulturtat“ der Leute von Nashville in
Tennessee U. S. A. nicht mehr weit entfernt: -'
Diese haben nämlich, lauf glaubwürdigen
Nachrichten, gleich die ganze athenische
Akropolis in einem ihrer Parks, in Lebens'
große oder fast, kopieren lassen, noch dazu
im vortrefflichen Kunststein einer deutschen
Firma, die den penthelischen Marmor ,,täu'
sehend“ nachahmen kann, leicht, mittelstark
oder stark patiniert, — vom Original einfach
nicht wegzukennen.
Man hätte also den Altar besser nicht
ganz aufgebaut. Die beste Lösung wäre
wohl gewesen, man hätie den Fries an den
Außenwänden eines entsprechend großen
inneren Museumsraumes herumgeführt. Dazu
an geeigneter Stelle in Augenhöhe ein gut
gearbeitetes rekonstruiertes Modell.
Nun aber mein Vorschlag: — „Man lös^
also den umgestülpten Teil des Frieses au5
seiner verfälschten Beziehung zum rekon'
struierten Altartorso, bringe ihn zu Studien'
zwecken in irgendeinem anderen Rauh’
unter . . . usw. Hier atmet Herr v. Masso'"1'
auf, denn er meint, mich eines Sakrilegs be'
zichfigen zu können; dementsprechend seih
Verdikt: „Ich zögere nicht, diesen Saß au?
der Feder eines Architekten und verantwort'
liehen Hochschullehrers als unbegreiflich Z”
bezeichnen.“ Das klingt wie Bliß und Do:>'
nerschlag und das verehrte Publikum horcht
unwillkürlich auf, ob der verantwortliche
Hochschullehrer nunmehr in die bekannte Siß*
läge übergegangen ist. — Zunächst möchte
ich dazu sagen, daß es heute tatsächlich vef'
anlwortliche (wenn auch zu ihrem Glück nicht
Herrn v. Massow verantwortliche) Hochschul'
lehrer gibt, die aus einer weltanschaulich
fundierten Einstellung heraus jegliche
geistige Beziehung unserer Zeit zur Antike
leugnen. Ich wüßte nicht, was sich tun ließe»
als auch solche Meinung zur Kenntnis z”
nehmen, selbst dann, wenn man ihr nicht z”
folgen vermag. Denn auch mit sachliche”
Bekehrungsversuchen wird da kaum viel z”
erreichen sein. Obwohl ich nun die antik”
Formenwelt als Objekte gelehrter Nach'
ahmung und Nachempfindung sehr entschi”'
den ablehne, kann ich doch jene Uninter'
essiertheii an der Anfike nicht in ihre!”
ganzen Umfang teilen. Das dürften alle die'
jenigen (außer Herrn v. Massow) gemerkt
haben, die meine ersten Darlegungen übe”
das Pergamon-Museum an dieser Stelle z”r
Kenntnis genommen haben. „Also dies”
Reliefs,“ ruft Herr v. Massow aus, „um dje
uns die ganze Welt beneidet . . . sollen
irgendeinem Raum untergebrach’
werden.
untergebrach*
Wo? Im Keller?“ Soweit ich mich
durch Umfrage vergewissern konnte»
hat noch jedermann (abermals auße”
Herrn v. Massow) meine Worte rieh'
tig verstanden. „Irgendein andere”
Raum“ ist erstens einmal nicht de”
Räum, in dem der Altartorso aufge?
baut ist, damit wenigstens dieser
wenn er schon aufgebaut wurde —
wesentlichen richtig zur Wirkung
kommen könne. Zweitens könnte
auch ein Raum sein, der nicht gerad6
in der betonten Achse des Gebäude’
liegen muß. Drittens wäre in diese”
Sinne, wenn auch nicht gerade f”
den Fries geeignet, „irgendein a”
derer Raum“, z. B. der kleine Raü”
mit den frühgriechischen Baufragme”|
ten, der von sachkundiger Seite i””1.
Recht als vorbildlich bezeichn^
wurde. Viertens wäre „irgende'
anderer“ Raum auch ein neuzuscha’
fender Raum z. B. im Ehrenhof. z
Was im Gegensaß zur Unterstellt””
Herrn v. Massow nicht mit d»e”
ein anderer Raum“ gemeint war, geht he”
vor aus den einleitenden Worten jenes Am.
saßes, in denen eine würdige Unterbringu”-
und Zurschaustellung eines künstlerisch”,
Dokumentes von der Bedeutung des Pe”(
gamonfrieses als Kulturpflichi bezeichn6,
wird. Ich bin also entweder gezwungen, a”.
zunehmen, daß Herrn v. Massow der Inh&;i
jenes Aufsaßes, den zu beantworten er 5>”
vorgenommen hatte, insbesondere der Si”,
jener einleitenden Säße nicht mehr gege”,
wärtig war, als er seinen kleinen Theat””
Inhalt Nr. 7
Sammlung Frederick Rozendaal
(m. 3 Abb.).
Prof. Dr. R. v. Schöfer (Aachen):
Das Pergamonmuseum.
A. Mühsam: Zum Pergamonmuseum .
Die neuesten Ausgrabungen in Pergamon
Auktionsvoriberichte (m. 2 Abb.) . .
A uk t i o n s - K a 1 e n d e r.
Preisberichte — Literatur — Kunst im
Rundfunk . ... . -
Auktionsnachberichte .
Ausstellungen der Woche . .
Ausstellungen (m. 4 Abb.).
Max Band — Kanelba — China-Aus-
stellung in Breslau
»Bau- und Raumkunst«, Kunstgewerbe .
Dr. O. Bloch: Emmy Roths hand-
gearbeitetes Silber (m. 3 Abb.)
G. R e i n b o t h (Rom):
Neapels Keramik-Museum
Nachrichten von» überall
Unter Kollegen.
ANTIQUITÄTEN
NAHE KAISERHOF
Will I
^Palais FaUa^icinil
GALERIE SANCT LUCAS
ALTE MEISTER
Objets de Collection
Tapisseries - Peintures
BRIMO « LAROUSSILHE
34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes) Papis
Du Haut-Moyen
ä la Renaissance
WELTKUNST
Jahr.g. V, Nr. 7 vom 15. Februar 19-31
Ostade, Palamedes, Willaerts u. a., sowie
französische und englische Farbstiche, kleine
Kupfer von Georg Friedrich Schmidt.
Im ganzen wie im einzelnen macht das
hier kurz skizzierte Material dekorativer
Kunstwerke dem Namen des bisherigen Be-
Das Pergamonmuseum
Von
Mo-
Professor Dr.-Ing. R. v. Schöfer, Aachen
9
10
Der
des
von
ein
abgelehnt.
Sonderform
Buleuterion
Ausnahmen
für Axialität kein Ge-
habe ich keineswegs
daß die repräsen-
Attribuf darf nicht ver-
6
7
7
8
2/3
3,7
7/8
4
5
Be¬
den
Ab-
Ich
und
sißers alle Ehre und es ist zu erwarten, daß
das Interesse für diese geschmacklich und
qualitativ hochstehenden Dinge nicht hinter
der Achtung zurückstehen wird, die man dem
Hause Frederick Rozendaal entgegenzu-
bringen gewohnt war.
eines Ganzen, wie bei den Propyläen der
Akropolis, der Wissenschaft bekannt ist, daß
seine geplante symmetrische Anlage
aus irgendwelchen Gründen aufgegeben
wurde, kann denn so ein, notabene m. W.
vereinzelter Fall auch nur den Schatten eines
wissenschaftlichen Beweises dafür liefern, daß
die fast ausnahmslos nicht- axialen Anlagen
hellenischer und hellenistischer Städte, Akro-
polen, Märkte, Pläße ursprünglich axial ge-
ist es ja aber gerade, was uns von ihm trenn!,
daß ihm das Verständnis dafür fehlt, daß
dieses Gebäude keine derartige Achse haben
sollte, um den Gedanken gar nicht aufkom-
men zu lassen, den Altar auch in ihr aufzu-
stellen. — Er wünscht zu wissen, wo man
denn also den Altar hätte hinstellen sollen:
schief in den Saal oder zur Seife gerückt,
um dem „angeblichen“ hellenischen Geist ge-
recht zu werden? Natürlich kann der Altar
in diesem Bau, wenn er überhaupt aufgestellt
wurde, nur so stehen bleiben, wie er steht.
Meißener Figuren um 1735. Modelle von Kandier
Porcelaine de Saxe, vers 1735. Modeles de Kaendler
Porcelain, Saxony, about 1735. Models by Kaendler
Collection Fr. Rozendaal, Berlin — Kat.-Nr. 192—193
Versteigerung — Vente — Sale: A. Wertheim, Berlin, 4.—-5. März 1931
Turmuhr — Horloge. Neuruppin, ca. 1580
Collection Fr. Rozendaal, Berlin — Kat.-Nr. 435
Versteigerung — Vente — Sale: A. Wertheim,
Berlin, 4.—5. März 1931
Bei dem großen Interesse, dem die Auf-
stellung des Pergamonmuseums in weitesten
Kreisen begegnet ist, wollen wir unseren
Lesern die folgenden Ausführungen von
Prof. Dr. v. Schöfer nicht vorenthalten,
trotz mancher allzu persönlicher Schärfen,
die wir in keiner Weise billigen, sondern
nur in Verfolg der Diskussion aus Loyali-
tätsgründen zulassen.
Wir halten es jedoch für nötig, gleich-
zeitig einer Zuschrift von Frau A. Müh-
sam, Berlin, Raum zu geben, die als
Stimme aus dem Publikum gewertet werden
kann und die eine ganz andere Ansicht ver-
tritt.
Schließlich bringen wir auch die
praktischen Resultate zur Kenntnis unserer
Leser, die die Aufstellung des Pergamon-
Altars gezeitigt hat. Wie man sich auch
theoretisch zu der aufgeworfenen Frage
stellen mag, 600 000 Besucher im Laufe
weniger Monate ist ein Erfolg, eine Leistung.
Die Ziffern sprechen für sich und auch für
die Wirkung der Art der Aufstellung.
Die Redaktion der WELTKUNST
ihres Mangels an wesentlichen
punkten sich selbst zu überlassen,
will ich zur Berichtigung — die allerdings
jeder aufmerksame Leser selbst auch schon
vornehmen konnte — nochmal das Wort
nehmen, weil die Sache wichtig ist, nicht die
Personen.
Die Sorge, ob und wie es möglich wäre,
für den losgelösten Fries einen einwand-
freien Ausstellungsraum zu beschaffen, ins-
besondere, ob und wie es formal und prak-
tisch möglich wäre, einen solchen Raum, der
Ich wüßte auch nicht, wo ich eine Umstellung
des Altars innerhalb des bestehenden Baues
angeregt hätte. Wenn wir aber schon mit
dem „hätten sollen“ operieren wollen, könnte
die Frage laufen, ob der Altar denn über-
haupt hätte ganz aufgebaut werden sollen?
Angesichts der Tatsache, daß vom Oberbau
so gut wie keine Originalstücke vorhanden
sind, müßte heute die Frage mit einem un-
bedingten Nein beantwortet werden. Denn
jeder, der über das Wesen eines „Stils“ nach-
gedacht hat, wird zugeben, daß jede
Herr Dr. von Massow bemüht sich in
Nr. 5 der „Welfkunst“, meinen Darlegungen
(in Nr. 2) entgegenzutreten. Daß er bei dem
eifrigen Ärger, in den er sich hineinredet, um
eine stark umstrittene Position ex officio zu
verteidigen, den Boden der Sachlichkeit ver-
liert und persönlich wird, ist gegen alle Ge-
pflogenheiten akademischer Diskussion und
hat der von ihm vertretenen Auffassung kaum
genüßt. Herr v. Massow übersieht geflissent-
lich, daß meine Ausführungen kein Angriff,
sondern eine sachlich gehaltene Überlegung
waren, wie man einen Zustand, der zwangs-
läufig entstanden, aber der Zeitauffassung
fremd geworden ist, verhältnismäßig beschei-
denen Änderungen unterwerfen und dadurch
die wertvollsten Stücke der Sammlung zu
ewas besserer und richtigerer Wirkung brin-
gen könnte, als es jeßt der Fall ist. Leider
hat sich gezeigt, daß Herr v. Massow zu dem
Problem, um das es hier geht, keinerlei
Ziehung hat, und es passiert ihm, daß er
Sinn meiner Äußerungen, mit oder ohne
sicht, wiederholt ins Gegenteil verdreht,
hätte füglich das Recht, Herrn v. Massow
seine Erwiderung ihrer Form wegen und wegen
Gesichts-
Dennoch
zugleich den museumstechnischen Anforde-
rungen einer Eingangshalle genügen müßte,
im Ehrenhof unterzubringen, — sollte Herr
v. Massow besser den Architekten überlassen.
Es gibt deren heute in Berlin und Preußen
solche genug, die auf Befragen einwandfreie
Lösungen im Sinne eines zeitgemäßen An-
baues Vorschlägen könnten. Ich glaube aller-
dings nicht, daß unter den brauchbaren Lö-
sungen ein neuer Griechentempel angeboten,
auch nicht, daß dem Museumsgebäude durch
einen geeigneten Anbau formal Abbruch
getan würde. Im übrigen könnte hier dies-
seits die empörte Frage aufgeworfen werden,
was denn das Wichtigere und Wertvollere sei:
der anfechtbare Museumsbau oder der Fries?
Was Herr v. Massow über die Axiali-
tät zu sagen weiß, reicht leider nicht aus,
um die Diskussion darüber ernsthaft fortzu-
seßen, da ihm, wie gesagt, die Beziehungen
zum Wesen des Problems oder gar zu dessen
leßten Konsequenzen zu fehlen scheinen.
Allerdings ist dem Problem auf dem Wege
wissenschaftlicher Erkenntnis allein auch nicht
beizukommen. Eine kurze Formulierung
seines Wesens habe ich gelegentlich in der
Architektur-Fachpresse*) vorgelegt; — auf
die Beziehungen der Antike zu ihm hoffe ich
demnächst an anderer Stelle eingehen zu
können. Hier verbietet es schon allein der
verfügbare Raum. Wenn aber überhaupt, dann
möchte ich wissen, woraus denn eigentlich
auf irgendeine architektur-problematische Ein-
stellung der Alten geschlossen werden könnte
und dürfte, wenn nicht in erster Linie aus
ihrer baulichen Betätigung, also in diesem
Falle insbesondere aus ihren Plaßanlagen,
Städteplänen usw.?
Daß die Griechen
fühl besessen hätten,
behauptet. Lediglich,
tative Axialität (das
gessen werden) ihrer Baugesinnung fremd, das
heißt, für sie kein Ausdruck war. Das be-
deutet aber etwas ganz Anderes. Gerade
weil sie für das Wesen der Axialität Gefühl
hatten, haben sie ihre Anwendung in ihrer
repräsentativen Form aus ihrer Baugesinnung
heraus offenbar konsequent
Griechentempel, auch in der
Didymaions, oder gar das
Milet sind nicht einmal als
Beweis dagegen, weil es symmetrische, nicht
aber repräsentativ axiale Anlagen waren, —
zwei Begriffe, die nicht verwechselt werden
dürfen. Und wenn einmal bei einem Detail
*) Zentralbl. d. Bauverwaltung, 50. Jhrg., Nr. 32.
plant waren? Oder sind diese überwiegend
nicht-axialen Anlagen (z. T. auf brettebenem
Gelände) nicht vielmehr ein Beweis dafür, daß
sie eben ein Ausdruck hellenischer Baugesin-
nung waren, und daß dieser Baugesinnung ge-
legentliche Unebenheit des Geländes nicht nur
kein Hindernis schien, sondern meist ganz
erwünscht war? Natürlich muß an dieser
Stelle auf geschlossene Beweisführung ver-
zichtet werden, aber etwas Fingerspißengefühl
für das Phänomen sollte man bei einem
Archäologen vorausseßen dürfen.
Herr v. Massow „kann nicht verslehen,
was gegen die Aufstellung des größten, noch
dazu kunstgeschichtlich so bedeutenden
numents der Museen in der Hauptachse
Gebäudes ernstlich einzuwenden sei".
moderne Ergänzung in irgendeinem Sinne
Fälschung des einstigen Lebens in1
Kunstwerk sein muß. Es ist im Prinzip ganz
gleichgültig, ob eine Madonnenfigur oder ein
Säulenschaft „nachgeahmi“ wird. Und wenn
der Wiederaufbau antiker Architekturen mi'
unzulänglichen Originalstücken weiter Schule
macht, was für London, infolge des Ent'
zückens kapitalkräftiger Mäcene, wirklich so
weit in den Bereich der Möglichkeit gerückt
zu sein scheint, daß wir demnächst vielleicht
als Folie für die Parthenonskulpiuren den
ganzen Parthenon kopiert entstehen sehen
werden, — dann, fürchte ich, sind wir von
der „Kulturtat“ der Leute von Nashville in
Tennessee U. S. A. nicht mehr weit entfernt: -'
Diese haben nämlich, lauf glaubwürdigen
Nachrichten, gleich die ganze athenische
Akropolis in einem ihrer Parks, in Lebens'
große oder fast, kopieren lassen, noch dazu
im vortrefflichen Kunststein einer deutschen
Firma, die den penthelischen Marmor ,,täu'
sehend“ nachahmen kann, leicht, mittelstark
oder stark patiniert, — vom Original einfach
nicht wegzukennen.
Man hätte also den Altar besser nicht
ganz aufgebaut. Die beste Lösung wäre
wohl gewesen, man hätie den Fries an den
Außenwänden eines entsprechend großen
inneren Museumsraumes herumgeführt. Dazu
an geeigneter Stelle in Augenhöhe ein gut
gearbeitetes rekonstruiertes Modell.
Nun aber mein Vorschlag: — „Man lös^
also den umgestülpten Teil des Frieses au5
seiner verfälschten Beziehung zum rekon'
struierten Altartorso, bringe ihn zu Studien'
zwecken in irgendeinem anderen Rauh’
unter . . . usw. Hier atmet Herr v. Masso'"1'
auf, denn er meint, mich eines Sakrilegs be'
zichfigen zu können; dementsprechend seih
Verdikt: „Ich zögere nicht, diesen Saß au?
der Feder eines Architekten und verantwort'
liehen Hochschullehrers als unbegreiflich Z”
bezeichnen.“ Das klingt wie Bliß und Do:>'
nerschlag und das verehrte Publikum horcht
unwillkürlich auf, ob der verantwortliche
Hochschullehrer nunmehr in die bekannte Siß*
läge übergegangen ist. — Zunächst möchte
ich dazu sagen, daß es heute tatsächlich vef'
anlwortliche (wenn auch zu ihrem Glück nicht
Herrn v. Massow verantwortliche) Hochschul'
lehrer gibt, die aus einer weltanschaulich
fundierten Einstellung heraus jegliche
geistige Beziehung unserer Zeit zur Antike
leugnen. Ich wüßte nicht, was sich tun ließe»
als auch solche Meinung zur Kenntnis z”
nehmen, selbst dann, wenn man ihr nicht z”
folgen vermag. Denn auch mit sachliche”
Bekehrungsversuchen wird da kaum viel z”
erreichen sein. Obwohl ich nun die antik”
Formenwelt als Objekte gelehrter Nach'
ahmung und Nachempfindung sehr entschi”'
den ablehne, kann ich doch jene Uninter'
essiertheii an der Anfike nicht in ihre!”
ganzen Umfang teilen. Das dürften alle die'
jenigen (außer Herrn v. Massow) gemerkt
haben, die meine ersten Darlegungen übe”
das Pergamon-Museum an dieser Stelle z”r
Kenntnis genommen haben. „Also dies”
Reliefs,“ ruft Herr v. Massow aus, „um dje
uns die ganze Welt beneidet . . . sollen
irgendeinem Raum untergebrach’
werden.
untergebrach*
Wo? Im Keller?“ Soweit ich mich
durch Umfrage vergewissern konnte»
hat noch jedermann (abermals auße”
Herrn v. Massow) meine Worte rieh'
tig verstanden. „Irgendein andere”
Raum“ ist erstens einmal nicht de”
Räum, in dem der Altartorso aufge?
baut ist, damit wenigstens dieser
wenn er schon aufgebaut wurde —
wesentlichen richtig zur Wirkung
kommen könne. Zweitens könnte
auch ein Raum sein, der nicht gerad6
in der betonten Achse des Gebäude’
liegen muß. Drittens wäre in diese”
Sinne, wenn auch nicht gerade f”
den Fries geeignet, „irgendein a”
derer Raum“, z. B. der kleine Raü”
mit den frühgriechischen Baufragme”|
ten, der von sachkundiger Seite i””1.
Recht als vorbildlich bezeichn^
wurde. Viertens wäre „irgende'
anderer“ Raum auch ein neuzuscha’
fender Raum z. B. im Ehrenhof. z
Was im Gegensaß zur Unterstellt””
Herrn v. Massow nicht mit d»e”
ein anderer Raum“ gemeint war, geht he”
vor aus den einleitenden Worten jenes Am.
saßes, in denen eine würdige Unterbringu”-
und Zurschaustellung eines künstlerisch”,
Dokumentes von der Bedeutung des Pe”(
gamonfrieses als Kulturpflichi bezeichn6,
wird. Ich bin also entweder gezwungen, a”.
zunehmen, daß Herrn v. Massow der Inh&;i
jenes Aufsaßes, den zu beantworten er 5>”
vorgenommen hatte, insbesondere der Si”,
jener einleitenden Säße nicht mehr gege”,
wärtig war, als er seinen kleinen Theat””
Inhalt Nr. 7
Sammlung Frederick Rozendaal
(m. 3 Abb.).
Prof. Dr. R. v. Schöfer (Aachen):
Das Pergamonmuseum.
A. Mühsam: Zum Pergamonmuseum .
Die neuesten Ausgrabungen in Pergamon
Auktionsvoriberichte (m. 2 Abb.) . .
A uk t i o n s - K a 1 e n d e r.
Preisberichte — Literatur — Kunst im
Rundfunk . ... . -
Auktionsnachberichte .
Ausstellungen der Woche . .
Ausstellungen (m. 4 Abb.).
Max Band — Kanelba — China-Aus-
stellung in Breslau
»Bau- und Raumkunst«, Kunstgewerbe .
Dr. O. Bloch: Emmy Roths hand-
gearbeitetes Silber (m. 3 Abb.)
G. R e i n b o t h (Rom):
Neapels Keramik-Museum
Nachrichten von» überall
Unter Kollegen.
ANTIQUITÄTEN
NAHE KAISERHOF
Will I
^Palais FaUa^icinil
GALERIE SANCT LUCAS
ALTE MEISTER
Objets de Collection
Tapisseries - Peintures
BRIMO « LAROUSSILHE
34, Rue Lafayette — 58, Rue Jouffroy (Bd. Malesherbes) Papis
Du Haut-Moyen
ä la Renaissance