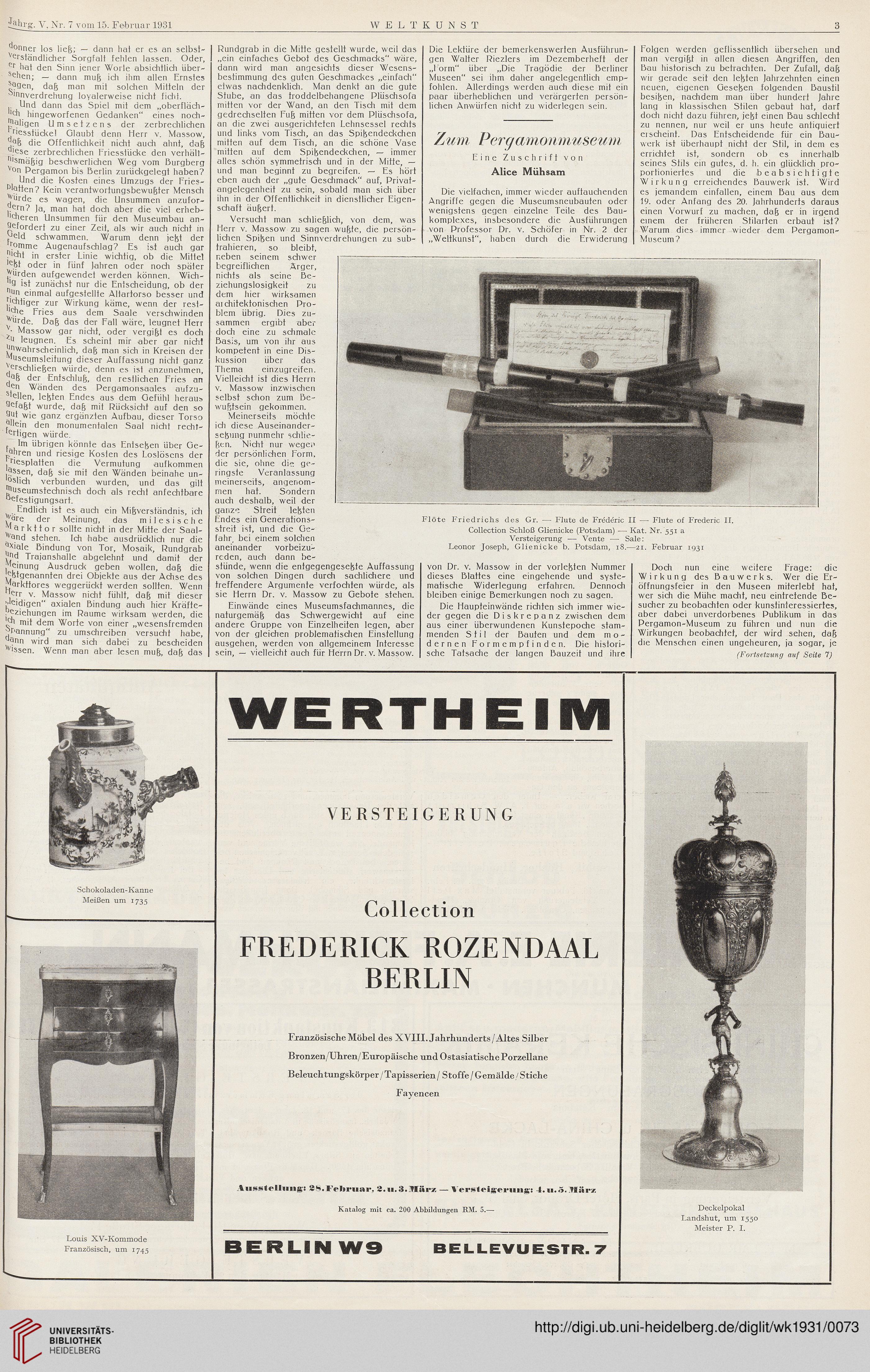Jjhrg. V, Nr. 7 vom 15. Februar 1931
W E L T K U N S T
3
Bonner los liefe; — dann hai er es an selbst-
verständlicher Sorgfalt fehlen lassen. Oder,
'r hat den Sinn jener Worte absichtlich über-
Sehen; — dann muß ich ihm allen Ernstes
sagen, daß man mit solchen Mitteln der
'Sinnverdrehung loyalerweise nicht ficht.
Und dann das Spiel mit dem „oberfläch-
llch hingeworfenen Gedanken“ eines noch-
maligen Umsetzens der zerbrechlichen
* riesstücke! Glaubt denn Herr v. Massow,
die Öffentlichkeit nicht auch ahnt, daß
ajese zerbrechlichen Friessiücke den verhält-
••■smäßig beschwerlichen Weg vom Burgberg
v°n Pergamon bis Berlin zurückgelegt haben?
Und die Kosten eines Umzugs der Fries-
gatten? Kein verantwortungsbewußter Mensch
'yürde es wagen, die Unsummen anzufor-
aern? Ja, man hat doch aber die viel erheb-
’cheren Unsummen für den Museumbau an-
9eforderf zu einer Zeit, als wir auch nicht in
Ueld schwammen. Warum denn jeßt der
’/omme Augenaufschlag? Es ist auch gar
nicht in erster Linie wichtig, ob die Mittel
"Ft oder in fünf Jahren oder noch später
Würden aufgewendei werden können. Wich-
”g ist zunächst nur die Entscheidung, ob der
fjun einmal aufgesfellte Altartorso besser und
pehtiger zur Wirkung käme, wenn der resi-
’Uie Fries aus dem Saale verschwinden
"ürde. Daß das der Fall wäre, leugnet Herr
• Massow gar nicht, oder vergißt es doch
-U leugnen. Es scheint mir aber gar nicht
•^Wahrscheinlich, daß man sich in Kreisen der
/'Eseumsleifung dieser Auffassung nicht ganz
erschließen würde, denn es ist enzunehmen,
•jaß der Entschluß, den restlichen Fries an
den Wänden des Pergamonsaales aufzu-
S‘ellen, leßten Endes aus dem Gefühl heraus
Gefaßt wurde, daß mit Rücksicht auf den so
9ut wie ganz ergänzten Aufbau, dieser Torso
m'ein den monumentalen Saal nicht recht-
artigen würde.
Im übrigen könnte das Entseßen über Ge-
fahren und riesige Kosten des Loslösens der
. r>esplatten die Vermutung aufkommen
assen, daß sie mit den Wänden beinahe un-
°slich verbunden wurden, und das gilt
JJ’useumsfechnisch doch als recht anfechtbare
öefestigungsart.
Endlich ist es auch ein Mißverständnis, ich
''are der Meinung, das m i 1 e s i s c h e
p* a r k 11 o r sollte nicht in der Mitte der Saal-
vand stehen. Ich habe ausdrücklich nur die
pkiale Bindung von Tor, Mosaik, Rundgrab
Jnd Trajanshalle abgelehnt und damit der
.Meinung Ausdruck geben wollen, daß die
!®ßtgenannten drei Objekte aus der Achse des
^Jarkttores weggerückt werden sollten. Wenn
perr v. Massow nicht fühlt, daß mit dieser
leidigen“ axialen Bindung auch hier Kräfte-
. ^Ziehungen im Raume wirksam werden, die
5"1 mit dem Worte von einer „wesensfremden
^bannung“ zu umschreiben versucht habe,
dann wird man sich dabei zu bescheiden
'V|ssen. Wenn man aber lesen muß, daß das
Rundgrab in die Mitte gestellt wurde, weil das
„ein einfaches Gebot des Geschmacks“ wäre,
dann wird man angesichts dieser Wesens-
bestimmung des guten Geschmackes „einfach“
etwas nachdenklich. Man denkt an die gute
Stube, an das froddelbehangene Plüschsofa
mitten vor der Wand, an den Tisch mit dem
gedrechselten Fuß mitten vor dem Plüschsofa,
an die zwei ausgerichtefen Lehnsessel rechts
und links vom Tisch, an das Spißendeckchen
mitten auf dem Tisch, an die schöne Vase
mitten auf dem Spißendeckchen, — immer
alles schön symmetrisch und in der Mitte, —
und man beginnt zu begreifen. — Es hört
eben auch der „gute Geschmack“ auf, Privat-
angelegenheit zu sein, sobald man sich über
ihn in der Öffentlichkeit in dienstlicher Eigen-
schaft äußert.
Versucht man schließlich, von dem, was
Herr v. Massow zu sagen wußte, die persön-
lichen Spißen und Sinnverdrehungen zu sub-
trahieren, so bleibt,
neben seinem schwer
begreiflichen Ärger,
nichts als seine Be-
ziehungslosigkeit zu
dem hier wirksamen
architektonischen Pro-
blem übrig. Dies zu¬
sammen ergibt aber
doch eine zu schmale
Basis, um von ihr aus
kompetent in eine Dis¬
kussion über das
Thema einzugreifen.
Vielleicht ist dies Herrn
v. Massow inzwischen
selbst schon zum Be-
wußtsein gekommen.
Meinerseits möchte
ich diese Auseinander-
seßung nunmehr schlie-
ßen. Nicht nur wegen
der persönlichen Form,
die sie, ohne die ge¬
ringste Veranlassung
meinerseits, angenom-
men hat. Sondern
auch deshalb, weil der
ganze Streit leßten
Endes ein Generations¬
streit ist, und die Ge¬
fahr, bei einem solchen
aneinander vorbeizu¬
reden, auch dann be¬
stünde, wenn die entgegengeseßfe Auffassung
von solchen Dingen durch sachlichere und
treffendere Argumente verfochten würde, als
sie Herrn Dr. v. Massow zu Gebote stehen.
Einwände eines Museumsfachmannes, die
naturgemäß das Schwergewicht auf eine
andere Gruppe von Einzelheiten legen, aber
von der gleichen problematischen Einstellung
ausgehen, werden von allgemeinem Interesse
sein, — vielleicht auch für Herrn Dr. v. Massow.
Die Lektüre der bemerkenswerten Ausführun-
gen Walter Riezlers im Dezemberheft der
„Form“ über „Die Tragödie der Berliner
Museen“ sei ihm daher angelegentlich emp-
fohlen. Allerdings werden auch diese mit ein
paar überheblichen und verärgerten persön-
lichen Anwürfen nicht zu widerlegen sein.
Zum Pergamonmuseum
Eine Zuschrift von
Alice Mühsam
Die vielfachen, immer wieder aufiauchenden
Angriffe gegen die Museumsneubauten oder
wenigstens gegen einzelne Teile des Bau-
komplexes, insbesondere die Ausführungen
von Professor Dr. v. Schöfer in Nr. 2 der
„Weltkunst“, haben durch die Erwiderung
von Dr. v. Massow in der vorleßten Nummer
dieses Blattes eine eingehende und syste-
matische Widerlegung erfahren. Dennoch
bleiben einige Bemerkungen noch zu sagen.
Die Haupteinwände richten sich immer wie-
der gegen die Diskrepanz zwischen dem
aus einer überwundenen Kunstepoche stam-
menden Stil der Bauten und dem mo-
dernen Formempfinden. Die histori-
sche Tatsache der langen Bauzeit und ihre
Folgen werden geflissentlich übersehen und
man vergißt in allen diesen Angriffen, den
Bau historisch zu betrachten. Der Zufall, daß
wir gerade seit den leßten Jahrzehnten einen
neuen, eigenen Geseßen folgenden Baustil
besißen, nachdem man über hundert Jahre
lang in klassischen Stilen gebaut hat, darf
doch nicht dazu führen, jeßt einen Bau schlecht
zu nennen, nur weil er uns heute antiquiert
erscheint. Das Entscheidende für ein Bau-
werk ist überhaupt nicht der Stil, in dem es
errichtet ist, sondern ob es innerhalb
seines Stils ein gutes, d. h. ein glücklich pro-
portioniertes und die beabsichtigte
Wirkung erreichendes Bauwerk ist. Wird
es jemandem einfallen, einem Bau aus dem
19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts daraus
einen Vorwurf zu machen, daß er in irgend
einem der früheren Stilarten erbaut ist?
Warum dies immer wieder dem Pergamon-
Museum?
Doch nun eine weitere Frage: die
Wirkung des Bauwerks. Wer die Er-
öffnungsfeier in den Museen miterlebt hat,
wer sich die Mühe macht, neu eintreiende Be-
sucher zu beobachten oder kunstinteressiertes,
aber dabei unverdorbenes Publikum in das
Pergamon-Museum zu führen und nun die
Wirkungen beobachtet, der wird sehen, daß
die Menschen einen ungeheuren, ja sogar, je
(Fortsetzung auf Seite 7)
Flöte Friedrichs des Gr. — Flute de Frederic II — Flute of Frederic II.
Collection Schloß Glienicke (Potsdam) — Kat. Nr. 551 a
Versteigerung — Vente —• Sale:
Leonor Joseph, Glienicke b. Potsdam, 18.—21. Februar 1931
Collection
FREDERICK ROZENDAAL
BERLIN
Französische Möbel des XVIII. Jahrhunderts/Altes Silber
Bronzen/Uhren/Europäische und Ostasiatische Porzellane
Beleuchtungskörper /Tapisserien / Stoffe / Gemälde/ Stiche
Fayencen
Ausstellung: 38.Februar, 2.u.3.TIärz
Katalog mit ca. 200 Abbildungen RM. 5.—
Schokoladen-lxanne
Meißen um 1735
Louis XV-Kommode
Französisch, um 1745
Deckelpokal
Landshut, um 1550
Meister P. I.
W E L T K U N S T
3
Bonner los liefe; — dann hai er es an selbst-
verständlicher Sorgfalt fehlen lassen. Oder,
'r hat den Sinn jener Worte absichtlich über-
Sehen; — dann muß ich ihm allen Ernstes
sagen, daß man mit solchen Mitteln der
'Sinnverdrehung loyalerweise nicht ficht.
Und dann das Spiel mit dem „oberfläch-
llch hingeworfenen Gedanken“ eines noch-
maligen Umsetzens der zerbrechlichen
* riesstücke! Glaubt denn Herr v. Massow,
die Öffentlichkeit nicht auch ahnt, daß
ajese zerbrechlichen Friessiücke den verhält-
••■smäßig beschwerlichen Weg vom Burgberg
v°n Pergamon bis Berlin zurückgelegt haben?
Und die Kosten eines Umzugs der Fries-
gatten? Kein verantwortungsbewußter Mensch
'yürde es wagen, die Unsummen anzufor-
aern? Ja, man hat doch aber die viel erheb-
’cheren Unsummen für den Museumbau an-
9eforderf zu einer Zeit, als wir auch nicht in
Ueld schwammen. Warum denn jeßt der
’/omme Augenaufschlag? Es ist auch gar
nicht in erster Linie wichtig, ob die Mittel
"Ft oder in fünf Jahren oder noch später
Würden aufgewendei werden können. Wich-
”g ist zunächst nur die Entscheidung, ob der
fjun einmal aufgesfellte Altartorso besser und
pehtiger zur Wirkung käme, wenn der resi-
’Uie Fries aus dem Saale verschwinden
"ürde. Daß das der Fall wäre, leugnet Herr
• Massow gar nicht, oder vergißt es doch
-U leugnen. Es scheint mir aber gar nicht
•^Wahrscheinlich, daß man sich in Kreisen der
/'Eseumsleifung dieser Auffassung nicht ganz
erschließen würde, denn es ist enzunehmen,
•jaß der Entschluß, den restlichen Fries an
den Wänden des Pergamonsaales aufzu-
S‘ellen, leßten Endes aus dem Gefühl heraus
Gefaßt wurde, daß mit Rücksicht auf den so
9ut wie ganz ergänzten Aufbau, dieser Torso
m'ein den monumentalen Saal nicht recht-
artigen würde.
Im übrigen könnte das Entseßen über Ge-
fahren und riesige Kosten des Loslösens der
. r>esplatten die Vermutung aufkommen
assen, daß sie mit den Wänden beinahe un-
°slich verbunden wurden, und das gilt
JJ’useumsfechnisch doch als recht anfechtbare
öefestigungsart.
Endlich ist es auch ein Mißverständnis, ich
''are der Meinung, das m i 1 e s i s c h e
p* a r k 11 o r sollte nicht in der Mitte der Saal-
vand stehen. Ich habe ausdrücklich nur die
pkiale Bindung von Tor, Mosaik, Rundgrab
Jnd Trajanshalle abgelehnt und damit der
.Meinung Ausdruck geben wollen, daß die
!®ßtgenannten drei Objekte aus der Achse des
^Jarkttores weggerückt werden sollten. Wenn
perr v. Massow nicht fühlt, daß mit dieser
leidigen“ axialen Bindung auch hier Kräfte-
. ^Ziehungen im Raume wirksam werden, die
5"1 mit dem Worte von einer „wesensfremden
^bannung“ zu umschreiben versucht habe,
dann wird man sich dabei zu bescheiden
'V|ssen. Wenn man aber lesen muß, daß das
Rundgrab in die Mitte gestellt wurde, weil das
„ein einfaches Gebot des Geschmacks“ wäre,
dann wird man angesichts dieser Wesens-
bestimmung des guten Geschmackes „einfach“
etwas nachdenklich. Man denkt an die gute
Stube, an das froddelbehangene Plüschsofa
mitten vor der Wand, an den Tisch mit dem
gedrechselten Fuß mitten vor dem Plüschsofa,
an die zwei ausgerichtefen Lehnsessel rechts
und links vom Tisch, an das Spißendeckchen
mitten auf dem Tisch, an die schöne Vase
mitten auf dem Spißendeckchen, — immer
alles schön symmetrisch und in der Mitte, —
und man beginnt zu begreifen. — Es hört
eben auch der „gute Geschmack“ auf, Privat-
angelegenheit zu sein, sobald man sich über
ihn in der Öffentlichkeit in dienstlicher Eigen-
schaft äußert.
Versucht man schließlich, von dem, was
Herr v. Massow zu sagen wußte, die persön-
lichen Spißen und Sinnverdrehungen zu sub-
trahieren, so bleibt,
neben seinem schwer
begreiflichen Ärger,
nichts als seine Be-
ziehungslosigkeit zu
dem hier wirksamen
architektonischen Pro-
blem übrig. Dies zu¬
sammen ergibt aber
doch eine zu schmale
Basis, um von ihr aus
kompetent in eine Dis¬
kussion über das
Thema einzugreifen.
Vielleicht ist dies Herrn
v. Massow inzwischen
selbst schon zum Be-
wußtsein gekommen.
Meinerseits möchte
ich diese Auseinander-
seßung nunmehr schlie-
ßen. Nicht nur wegen
der persönlichen Form,
die sie, ohne die ge¬
ringste Veranlassung
meinerseits, angenom-
men hat. Sondern
auch deshalb, weil der
ganze Streit leßten
Endes ein Generations¬
streit ist, und die Ge¬
fahr, bei einem solchen
aneinander vorbeizu¬
reden, auch dann be¬
stünde, wenn die entgegengeseßfe Auffassung
von solchen Dingen durch sachlichere und
treffendere Argumente verfochten würde, als
sie Herrn Dr. v. Massow zu Gebote stehen.
Einwände eines Museumsfachmannes, die
naturgemäß das Schwergewicht auf eine
andere Gruppe von Einzelheiten legen, aber
von der gleichen problematischen Einstellung
ausgehen, werden von allgemeinem Interesse
sein, — vielleicht auch für Herrn Dr. v. Massow.
Die Lektüre der bemerkenswerten Ausführun-
gen Walter Riezlers im Dezemberheft der
„Form“ über „Die Tragödie der Berliner
Museen“ sei ihm daher angelegentlich emp-
fohlen. Allerdings werden auch diese mit ein
paar überheblichen und verärgerten persön-
lichen Anwürfen nicht zu widerlegen sein.
Zum Pergamonmuseum
Eine Zuschrift von
Alice Mühsam
Die vielfachen, immer wieder aufiauchenden
Angriffe gegen die Museumsneubauten oder
wenigstens gegen einzelne Teile des Bau-
komplexes, insbesondere die Ausführungen
von Professor Dr. v. Schöfer in Nr. 2 der
„Weltkunst“, haben durch die Erwiderung
von Dr. v. Massow in der vorleßten Nummer
dieses Blattes eine eingehende und syste-
matische Widerlegung erfahren. Dennoch
bleiben einige Bemerkungen noch zu sagen.
Die Haupteinwände richten sich immer wie-
der gegen die Diskrepanz zwischen dem
aus einer überwundenen Kunstepoche stam-
menden Stil der Bauten und dem mo-
dernen Formempfinden. Die histori-
sche Tatsache der langen Bauzeit und ihre
Folgen werden geflissentlich übersehen und
man vergißt in allen diesen Angriffen, den
Bau historisch zu betrachten. Der Zufall, daß
wir gerade seit den leßten Jahrzehnten einen
neuen, eigenen Geseßen folgenden Baustil
besißen, nachdem man über hundert Jahre
lang in klassischen Stilen gebaut hat, darf
doch nicht dazu führen, jeßt einen Bau schlecht
zu nennen, nur weil er uns heute antiquiert
erscheint. Das Entscheidende für ein Bau-
werk ist überhaupt nicht der Stil, in dem es
errichtet ist, sondern ob es innerhalb
seines Stils ein gutes, d. h. ein glücklich pro-
portioniertes und die beabsichtigte
Wirkung erreichendes Bauwerk ist. Wird
es jemandem einfallen, einem Bau aus dem
19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts daraus
einen Vorwurf zu machen, daß er in irgend
einem der früheren Stilarten erbaut ist?
Warum dies immer wieder dem Pergamon-
Museum?
Doch nun eine weitere Frage: die
Wirkung des Bauwerks. Wer die Er-
öffnungsfeier in den Museen miterlebt hat,
wer sich die Mühe macht, neu eintreiende Be-
sucher zu beobachten oder kunstinteressiertes,
aber dabei unverdorbenes Publikum in das
Pergamon-Museum zu führen und nun die
Wirkungen beobachtet, der wird sehen, daß
die Menschen einen ungeheuren, ja sogar, je
(Fortsetzung auf Seite 7)
Flöte Friedrichs des Gr. — Flute de Frederic II — Flute of Frederic II.
Collection Schloß Glienicke (Potsdam) — Kat. Nr. 551 a
Versteigerung — Vente —• Sale:
Leonor Joseph, Glienicke b. Potsdam, 18.—21. Februar 1931
Collection
FREDERICK ROZENDAAL
BERLIN
Französische Möbel des XVIII. Jahrhunderts/Altes Silber
Bronzen/Uhren/Europäische und Ostasiatische Porzellane
Beleuchtungskörper /Tapisserien / Stoffe / Gemälde/ Stiche
Fayencen
Ausstellung: 38.Februar, 2.u.3.TIärz
Katalog mit ca. 200 Abbildungen RM. 5.—
Schokoladen-lxanne
Meißen um 1735
Louis XV-Kommode
Französisch, um 1745
Deckelpokal
Landshut, um 1550
Meister P. I.