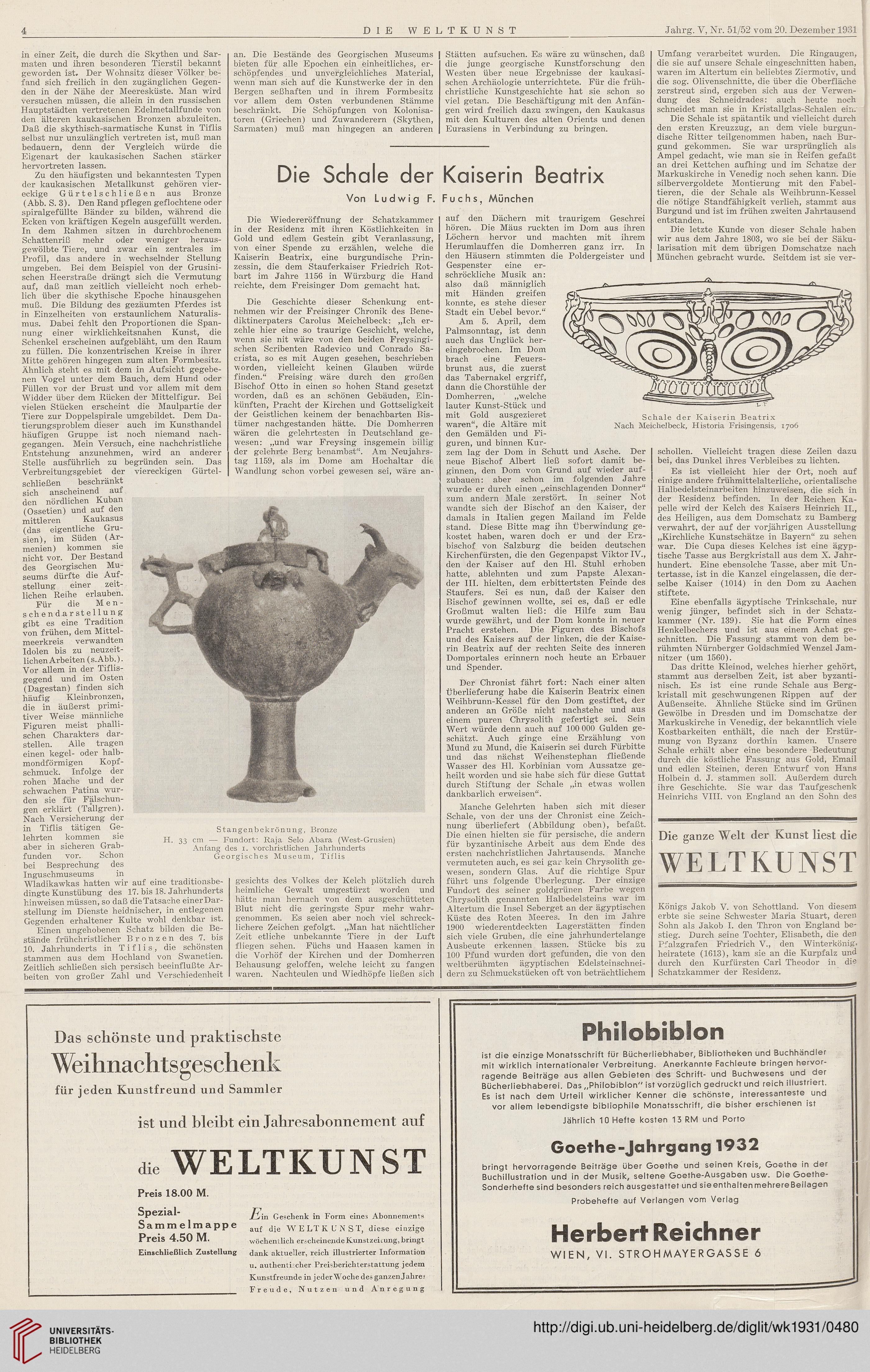4
DIE WELTKUNST
Jahrg, V, Nr. 51/52 vom 20. Dezember 1931
in einer Zeit, die durch die Skythen und Sar-
maten und ihren besonderen Tierstil bekannt
geworden ist. Der Wohnsitz dieser Völker be-
fand sich freilich in den zugänglichen Gegen-
den in der Nähe der Meeresküste. Man wird
versuchen müssen, die allein in den russischen
Hauptstädten vertretenen Edelmetallfunde von
den älteren kaukasischen Bronzen abzuleiten.
Daß die skythisch-sarmatische Kunst in Tiflis
selbst nur unzulänglich vertreten ist, muß man
bedauern, denn der Vergleich würde die
Eigenart der kaukasischen Sachen stärker
hervortreten lassen.
Zu den häufigsten und bekanntesten Typen
der kaukasischen Metallkunst gehören vier-
eckige Gürtelschließen aus Bronze
(Abb. S. 3). Den Band pflegen geflochtene oder
spiralgefüllte Bänder zu bilden, während die
Ecken von kräftigen Kegeln ausgefüllt werden.
In dem Bahmen sitzen in durchbrochenem
Schattenriß mehr oder weniger heraus-
gewölbte Tiere, und zwar ein zentrales im
Profil, das andere in wechselnder Stellung
umgeben. Bei dem Beispiel von der Grusini-
schen Heerstraße drängt sich die Vermutung
auf, daß man zeitlich vielleicht noch erheb-
lich über die skythische Epoche hinausgehen
muß. Die Bildung des gezäumten Pferdes ist
in Einzelheiten von erstaunlichem Naturalis-
mus. Dabei fehlt den Proportionen die Span-
nung einer wirklichkeitsnahen Kunst, die
Schenkel erscheinen aufgebläht, um den Baum
zu füllen. Die konzentrischen Kreise in ihrer
Mitte gehören hingegen zum alten Formbesitz.
Ähnlich steht es mit dem in Aufsicht gegebe-
nen Vogel unter dem Bauch, dem Hund oder
Füllen vor der Brust und vor allem mit dem
Widder über dem Bücken der Mittelfigur. Bei
vielen Stücken erscheint die Maulpartie der
Tiere zur Doppelspirale umgebildet. Dem Da-
tierungsproblem dieser auch im Kunsthandel
häufigen Gruppe ist noch niemand nach-
gegangen. Mein Versuch, eine nachchristliche
Entstehung anzunehmen, wird an anderer
Stelle ausführlich zu begründen sein. Das
Verbreitungsgebiet der viereckigen Gürtel-
schließen beschränkt
sich anscheinend auf
den nördlichen Kuban
(Ossetien) und auf den
mittleren Kaukasus
(das eigentliche Gru-
sien), im Süden (Ar¬
menien) kommen sie
nicht vor. Der Bestand
des Georgischen Mu-
seums dürfte die Auf¬
stellung einer zeit-
lichen Beihe erlauben.
Für die Men-
schendarstellung
gibt es eine Tradition
von frühen, dem Mittel¬
meerkreis verwandten
Idolen bis zu neuzeit¬
lichen Arbeiten (s. Abb.).
Vor allem in der Tiflis-
gegend und im Osten
(Dagestan) finden sich
häufig Kleinbronzen,
die in äußerst primi¬
tiver Weise männliche
Figuren meist phalli¬
schen Charakters dar-
stellen. Alle tragen
einen kegel- oder halb¬
mondförmigen Kopf-
schmuck. Infolge der
rohen Mache und der
schwachen Patina wur-
den sie für Fälschun¬
gen erklärt (Tallgren).
Nach Versicherung der
in Tiflis tätigen Ge-
lehrten kommen sie
aber in sicheren Grab¬
funden vor. Schon
bei Besprechung des
Inguschmuseums in
Wladikawkas hatten wir auf eine traditionsbe-
dingte Kunstübung des 17. bis 18. Jahrhunderts
hinweisen müssen, so daß die Tatsache einerDar-
stellung im Dienste heidnischer, in entlegenen
Gegenden erhaltener Kulte wohl denkbar ist.
Einen ungehobenen Schatz bilden die Be-
stände frühchristlicher Bronzen des 7. bis
10. Jahrhunderts in Tiflis, die schönsten
stammen aus dem Hochland von Swanetien.
Zeitlich schließen sich persisch beeinflußte Ar-
beiten von großer Zahl und Verschiedenheit
an. Die Bestände des Georgischen Museums
bieten für alle Epochen ein einheitliches, er-
schöpfendes und unvergleichliches Material,
wenn man sich auf die Kunstwerke der in den
Bergen seßhaften und in ihrem Formbesitz
vor allem dem Osten verbundenen Stämme
beschränkt. Die Schöpfungen von Kolonisa-
toren (Griechen) und Zuwanderern (Skythen,
Sarrnaten) muß man hingegen an anderen
Von Ludwig F.
Die Wiedereröffnung der Schatzkammer
in der Besidenz mit ihren Köstlichkeiten in
Gold und edlem Gestein gibt Veranlassung,
von einer Spende zu erzählen, welche die
Kaiserin Beatrix, eine burgundische Prin-
zessin, die dem Stauferkaiser Friedrich Bot-
bart im Jahre 1156 in Würzburg die Hand
reichte, dem Freisinger Dom gemacht hat.
Die Geschichte dieser Schenkung ent-
nehmen wir der Freisinger Chronik des Bene-
diktinerpaters Carolus Meichelbeck: „Ich er-
zehle hier eine so traurige Geschieht, welche,
wenn sie nit wäre von den beiden Freysingi-
sehen Scribenten Badevico und Conrado Sa-
crista, so es mit Augen gesehen, beschrieben
worden, vielleicht keinen Glauben würde
finden.“ Freising wäre durch den großen
Bischof Otto in einen so hohen Stand gesetzt
worden, daß es an schönen Gebäuden, Ein-
künften, Pracht der Kirchen und Gottseligkeit
der Geistlichen keinem der benachbarten Bis-
tümer nachgestanden hätte. Die Domherren
wären die gelehrtesten in Deutschland ge-
wesen: „und war Freysing insgemein billig
der gelehrte Berg benambst“. Am Neujahrs-
tag 1159, als im Dome am Hochaltar die
Wandlung schon vorbei gewesen sei, wäre an-
gesichts des Volkes der Kelch plötzlich durch
heimliche Gewalt umgestürzt worden und
hätte man hernach von dem ausgeschütteten
Blut nicht die geringste Spur mehr wahr-
genommen. Es seien aber noch viel schreck-
lichere Zeichen gefolgt. „Man hat nächtlicher
Zeit etliche unbekannte Tiere in der Luft
fliegen sehen. Füchs und Haasen kamen in
die Vorhöf der Kirchen und der Domherren
Behausung geloffen, welche leicht zu fangen
waren. Nachteulen und Wiedhöpfe ließen sich
Stätten aufsuchen. Es wäre zu wünschen, daß
die junge georgische Kunstforschung den
Westen über neue Ergebnisse der kaukasi-
schen Archäologie unterrichtete. Für die früh-
christliche Kunstgeschichte hat sie schon so
viel getan. Die Beschäftigung mit den Anfän-
gen wird freilich dazu zwingen, den Kaukasus
mit den Kulturen des alten Orients und denen
Eurasiens in Verbindung zu bringen.
Fuchs, München
auf den Dächern mit traurigem Geschrei
hören. Die Mäus ruckten im Dom aus ihren
Löchern hervor und machten mit ihrem
Herumlauffen die Domherren ganz irr. In
den Häusern stimmten die Poldergeister und
Gespenster eine er-
schröckliche Musik an:
also daß männiglich
mit Händen greifen
konnte, es stehe dieser
Stadt ein Uebel bevor.“
Am 5. April, dem
Palmsonntag, ist denn
auch das Unglück her¬
eingebrochen. Im Dom
brach eine Feuers¬
brunst aus, die zuerst
das Tabernakel ergriff,
dann die Chorstühle der-
Domherren, „welche
lauter Kunst-Stück und
mit Gold ausgezieret
waren“, die Altäre mit
den Gemälden und Fi¬
guren, und binnen Kur¬
zem lag der Dom in Schutt und Asche. Der
neue Bischof Albert ließ sofort damit be-
ginnen, den Dom von Grund auf wieder auf-
zubauen: aber schon im folgenden Jahre
wurde er durch einen „einschlagenden Donner“
zum andern Male zerstört. In seiner Not
wandte sich der Bischof an den Kaiser, der
damals in Italien gegen Mailand im Felde
stand. Diese Bitte mag ihn Überwindung ge-
kostet haben, waren doch er und der Erz-
bischof von Salzburg die beiden deutschen
Kirchenfürsten, die den Gegenpapst Viktor IV.,
den der Kaiser auf den Hl. Stuhl erhoben
hatte, ablehnten und zum Papste Alexan-
der III. hielten, dem erbittertsten Feinde des
Staufers. Sei es nun, daß der Kaiser den
Bischof gewinnen wollte, sei es, daß er edle
Großmut walten ließ: die Hilfe zum Bau
wurde gewährt, und der Dom konnte in neuer
Pracht erstehen. Die Figuren des Bischofs
und des Kaisers auf der linken, die der Kaise-
rin Beatrix auf der rechten Seite des inneren
Domportales erinnern noch heute an Erbauer
und Spender.
Der Chronist fährt fort: Nach einer alten
Überlieferung habe die Kaiserin Beatrix einen
Weihbrunn-Kessel für den Dom gestiftet, der
anderen an Größe nicht nachstehe und aus
einem puren Chrysolith gefertigt sei. Sein
Wert würde denn auch auf 100 000 Gulden ge-
schätzt. Auch ginge eine Erzählung von
Mund zu Mund, die Kaiserin sei durch Fürbitte
und das nächst Weihenstephan fließende
Wasser des Hl. Korbinian vom Aussatze ge-
heilt worden und sie habe sich für diese Guttat
durch Stiftung der Schale „in etwas wollen
dankbar lieh erweisen“.
Manche Gelehrten haben sich mit dieser
Schale, von der uns der Chronist eine Zeich-
nung überliefert (Abbildung oben), befaßt.
Die einen hielten sie für persische, die andern
für byzantinische Arbeit aus dem Ende des
ersten nachchristlichen Jahrtausends. Manche
vermuteten auch, es sei gar kein Chrysolith ge-
wesen, sondern Glas. Auf die richtige Spur
führt uns folgende Überlegung. Der einzige
Fundort des seiner goldgrünen Farbe wegen
Chrysolith genannten Halbedelsteins war im
Altertum die Insel Seberget an der ägyptischen
Küste des Boten Meeres. In den im Jahre
1900 wiederentdeckten Lagerstätten finden
sich viele Gruben, die eine jahrhundertelange
Ausbeute erkennen lassen. Stücke bis zu
100 Pfund wurden dort gefunden, die von den
weltberühmten ägyptischen Edelsteinschnei-
dern zu Schmuckstücken oft von beträchtlichem
Umfang verarbeitet wurden. Die Bingaugen,
die sie auf unsere Schale eingeschnitten haben,
waren im Altertum ein beliebtes Ziermotiv, und
die sog. Olivenschnitte, die über die Oberfläche
zerstreut sind, ergeben sich aus der Verwen-
dung des Schneidrades: auch heute noch
schneidet man sie in Kristallglas-Schalen ein.
Die Schale ist spätantik und vielleicht durch
den ersten Kreuzzug, an dem viele burgun-
dische Bitter teilgenommen haben, nach Bur-
gund gekommen. Sie war ursprünglich als
Ampel gedacht, wie man sie in Seifen gefaßt
an drei Kettchen aufhing und im Schatze der
Markuskirche in Venedig noch sehen kann. Die
silbervergoldete Montierung mit den Fabel-
tieren, die der Schale als Weihbrunn-Kessel
die nötige Standfähigkeit verlieh, stammt aus
Burgund und ist im frühen zweiten Jahrtausend
entstanden.
Die letzte Kunde von dieser Schale haben
wir aus dem Jahre 1803, wo sie bei der Säku-
larisation mit dem übrigen Domschatze nach
München gebracht wurde. Seitdem ist sie ver-
schollen. Vielleicht tragen diese Zeilen dazu
bei, das Dunkel ihres Verbleibes zu lichten.
Es ist vielleicht hier der Ort, noch auf
einige andere frühmittelalterliche, orientalische
Halbedelsteinarbeiten hinzuweisen, die sich in
der Besidenz befinden. In der Seichen Ka-
pelle wird der Kelch des Kaisers Heinrich II.,
des Heiligen, aus dem Domschatz zu Bamberg
verwahrt, der auf der vorjährigen Ausstellung
„Kirchliche Kunstschätze in Bayern“ zu sehen
war. Die Cupa dieses Kelches ist eine ägyp-
tische Tasse aus Bergkristall aus dem X. Jahr-
hundert. Eine ebensolche Tasse, aber mit Un-
tertasse, ist in die Kanzel eingelassen, die der-
selbe Kaiser (1014) in den Dom zu Aachen
stiftete.
Eine ebenfalls ägyptische Trinkschale, nur
wenig jünger, befindet sich in der Schatz-
kammer (Nr. 139). Sie hat die Form eines
Henkelbechers und ist aus einem Achat ge-
schnitten. Die Fassung stammt von dem be-
rühmten Nürnberger Goldschmied Wenzel Jam-
nitzer (um 1560).
Das dritte Kleinod, welches hierher gehört,
stammt aus derselben Zeit, ist aber byzanti-
nisch. Es ist eine runde Schale aus Berg-
kristall mit geschwungenen Bippen auf der
Außenseite. Ähnliche Stücke sind im Grünen
Gewölbe in Dresden und im Domschatze der
Markuskirche in Venedig, der bekanntlich viele
Kostbarkeiten enthält, die nach der Erstür-
mung von Byzanz dorthin kamen. Unsere
Schale erhält aber eine besondere Bedeutung
durch die köstliche Fassung aus Gold, Email
und edlen Steinen, deren Entwurf von Hans
Holbein d. J. stammen solh Außerdem durch
ihre Geschichte. Sie war das Taufgeschenk
Heinrichs VIII. von England an den Sohn des
Die ganze Welt der Kunst liest die
WELTKUNST
Königs Jakob V. von Schottland. Von diesem
erbte sie seine Schwester Maria Stuart, deren
Sohn als Jakob I. den Thron von England be-
stieg. Durch seine Tochter, Elisabeth, die den
Pfalzgrafen Friedrich V., den Winterkönig,
heiratete (1613), kam sie an die Kurpfalz und
durch den Kurfürsten Carl Theodor in die
Schatzkammer der Besidenz.
Stangenbekrönung, Bronze
H. 33 cm — Fundort: Raja Selo Abara (West-Grusien)
Anfang des i. vorchristlichen Jahrhunderts
Georgisches Museum, Tiflis
Die Schale der Kaiserin Beatrix
Schale der Kaiserin Beatrix
Nach Meichelbeck, Historia Frisingensis, 1706
Das schönste und praktischste
Weihnachtsgeschenk
für jeden Kunstfreund und Sammler
ist und bleiht ein Jahresabonnement auf
die WELTKUNST
Preis 18.00 M.
Spezial-
Sammelmappe
Preis 4.50 M.
Einschließlich Zustellung
jtSin Geschenk in Form eines Abonnements
auf die WELT KUNST, diese einzige
wöchentlich erscheinendeKunstzeicung,bringt
dank aktueller, reich illustrierter Information
u. authentischer Preisberichterstattung jedem
Kunstfreunde in jederWoche des ganzenjahres
Freude, Nutzen und Anregung
Philobiblon
ist die einzige Monatsschrift für Bücherliebhaber, Bibliotheken und Buchhändler
mit wirklich internationaler Verbreitung. Anerkannte Fachleute bringen hervor-
ragende Beiträge aus allen Gebieten des Schrift- und Buchwesens und der
Bücherliebhaberei. Das „Philobiblon" ist vorzüglich gedruckt und reich illustriert.
Es ist nach dem Urteil wirklicher Kenner die schönste, interessanteste und
vor allem lebendigste bibliophile Monatsschrift, die bisher erschienen ist
Jährlich 10 Hefte kosten 15 RM und Porto
Goethe-Jahrgang 1932
bringt hervorragende Beiträge über Goethe und seinen Kreis, Goethe in der
Buchillustration und in der Musik, seltene Goethe-Ausgaben usw. Die Goethe-
Sonderhefte sind besonders reich ausgestattet und sieenthaltenmehrereBeilagen
Probehefte auf Verlangen vom Verlag
Herbert Reichner
WIEN, VI. STROHMAYERGASSE 6
DIE WELTKUNST
Jahrg, V, Nr. 51/52 vom 20. Dezember 1931
in einer Zeit, die durch die Skythen und Sar-
maten und ihren besonderen Tierstil bekannt
geworden ist. Der Wohnsitz dieser Völker be-
fand sich freilich in den zugänglichen Gegen-
den in der Nähe der Meeresküste. Man wird
versuchen müssen, die allein in den russischen
Hauptstädten vertretenen Edelmetallfunde von
den älteren kaukasischen Bronzen abzuleiten.
Daß die skythisch-sarmatische Kunst in Tiflis
selbst nur unzulänglich vertreten ist, muß man
bedauern, denn der Vergleich würde die
Eigenart der kaukasischen Sachen stärker
hervortreten lassen.
Zu den häufigsten und bekanntesten Typen
der kaukasischen Metallkunst gehören vier-
eckige Gürtelschließen aus Bronze
(Abb. S. 3). Den Band pflegen geflochtene oder
spiralgefüllte Bänder zu bilden, während die
Ecken von kräftigen Kegeln ausgefüllt werden.
In dem Bahmen sitzen in durchbrochenem
Schattenriß mehr oder weniger heraus-
gewölbte Tiere, und zwar ein zentrales im
Profil, das andere in wechselnder Stellung
umgeben. Bei dem Beispiel von der Grusini-
schen Heerstraße drängt sich die Vermutung
auf, daß man zeitlich vielleicht noch erheb-
lich über die skythische Epoche hinausgehen
muß. Die Bildung des gezäumten Pferdes ist
in Einzelheiten von erstaunlichem Naturalis-
mus. Dabei fehlt den Proportionen die Span-
nung einer wirklichkeitsnahen Kunst, die
Schenkel erscheinen aufgebläht, um den Baum
zu füllen. Die konzentrischen Kreise in ihrer
Mitte gehören hingegen zum alten Formbesitz.
Ähnlich steht es mit dem in Aufsicht gegebe-
nen Vogel unter dem Bauch, dem Hund oder
Füllen vor der Brust und vor allem mit dem
Widder über dem Bücken der Mittelfigur. Bei
vielen Stücken erscheint die Maulpartie der
Tiere zur Doppelspirale umgebildet. Dem Da-
tierungsproblem dieser auch im Kunsthandel
häufigen Gruppe ist noch niemand nach-
gegangen. Mein Versuch, eine nachchristliche
Entstehung anzunehmen, wird an anderer
Stelle ausführlich zu begründen sein. Das
Verbreitungsgebiet der viereckigen Gürtel-
schließen beschränkt
sich anscheinend auf
den nördlichen Kuban
(Ossetien) und auf den
mittleren Kaukasus
(das eigentliche Gru-
sien), im Süden (Ar¬
menien) kommen sie
nicht vor. Der Bestand
des Georgischen Mu-
seums dürfte die Auf¬
stellung einer zeit-
lichen Beihe erlauben.
Für die Men-
schendarstellung
gibt es eine Tradition
von frühen, dem Mittel¬
meerkreis verwandten
Idolen bis zu neuzeit¬
lichen Arbeiten (s. Abb.).
Vor allem in der Tiflis-
gegend und im Osten
(Dagestan) finden sich
häufig Kleinbronzen,
die in äußerst primi¬
tiver Weise männliche
Figuren meist phalli¬
schen Charakters dar-
stellen. Alle tragen
einen kegel- oder halb¬
mondförmigen Kopf-
schmuck. Infolge der
rohen Mache und der
schwachen Patina wur-
den sie für Fälschun¬
gen erklärt (Tallgren).
Nach Versicherung der
in Tiflis tätigen Ge-
lehrten kommen sie
aber in sicheren Grab¬
funden vor. Schon
bei Besprechung des
Inguschmuseums in
Wladikawkas hatten wir auf eine traditionsbe-
dingte Kunstübung des 17. bis 18. Jahrhunderts
hinweisen müssen, so daß die Tatsache einerDar-
stellung im Dienste heidnischer, in entlegenen
Gegenden erhaltener Kulte wohl denkbar ist.
Einen ungehobenen Schatz bilden die Be-
stände frühchristlicher Bronzen des 7. bis
10. Jahrhunderts in Tiflis, die schönsten
stammen aus dem Hochland von Swanetien.
Zeitlich schließen sich persisch beeinflußte Ar-
beiten von großer Zahl und Verschiedenheit
an. Die Bestände des Georgischen Museums
bieten für alle Epochen ein einheitliches, er-
schöpfendes und unvergleichliches Material,
wenn man sich auf die Kunstwerke der in den
Bergen seßhaften und in ihrem Formbesitz
vor allem dem Osten verbundenen Stämme
beschränkt. Die Schöpfungen von Kolonisa-
toren (Griechen) und Zuwanderern (Skythen,
Sarrnaten) muß man hingegen an anderen
Von Ludwig F.
Die Wiedereröffnung der Schatzkammer
in der Besidenz mit ihren Köstlichkeiten in
Gold und edlem Gestein gibt Veranlassung,
von einer Spende zu erzählen, welche die
Kaiserin Beatrix, eine burgundische Prin-
zessin, die dem Stauferkaiser Friedrich Bot-
bart im Jahre 1156 in Würzburg die Hand
reichte, dem Freisinger Dom gemacht hat.
Die Geschichte dieser Schenkung ent-
nehmen wir der Freisinger Chronik des Bene-
diktinerpaters Carolus Meichelbeck: „Ich er-
zehle hier eine so traurige Geschieht, welche,
wenn sie nit wäre von den beiden Freysingi-
sehen Scribenten Badevico und Conrado Sa-
crista, so es mit Augen gesehen, beschrieben
worden, vielleicht keinen Glauben würde
finden.“ Freising wäre durch den großen
Bischof Otto in einen so hohen Stand gesetzt
worden, daß es an schönen Gebäuden, Ein-
künften, Pracht der Kirchen und Gottseligkeit
der Geistlichen keinem der benachbarten Bis-
tümer nachgestanden hätte. Die Domherren
wären die gelehrtesten in Deutschland ge-
wesen: „und war Freysing insgemein billig
der gelehrte Berg benambst“. Am Neujahrs-
tag 1159, als im Dome am Hochaltar die
Wandlung schon vorbei gewesen sei, wäre an-
gesichts des Volkes der Kelch plötzlich durch
heimliche Gewalt umgestürzt worden und
hätte man hernach von dem ausgeschütteten
Blut nicht die geringste Spur mehr wahr-
genommen. Es seien aber noch viel schreck-
lichere Zeichen gefolgt. „Man hat nächtlicher
Zeit etliche unbekannte Tiere in der Luft
fliegen sehen. Füchs und Haasen kamen in
die Vorhöf der Kirchen und der Domherren
Behausung geloffen, welche leicht zu fangen
waren. Nachteulen und Wiedhöpfe ließen sich
Stätten aufsuchen. Es wäre zu wünschen, daß
die junge georgische Kunstforschung den
Westen über neue Ergebnisse der kaukasi-
schen Archäologie unterrichtete. Für die früh-
christliche Kunstgeschichte hat sie schon so
viel getan. Die Beschäftigung mit den Anfän-
gen wird freilich dazu zwingen, den Kaukasus
mit den Kulturen des alten Orients und denen
Eurasiens in Verbindung zu bringen.
Fuchs, München
auf den Dächern mit traurigem Geschrei
hören. Die Mäus ruckten im Dom aus ihren
Löchern hervor und machten mit ihrem
Herumlauffen die Domherren ganz irr. In
den Häusern stimmten die Poldergeister und
Gespenster eine er-
schröckliche Musik an:
also daß männiglich
mit Händen greifen
konnte, es stehe dieser
Stadt ein Uebel bevor.“
Am 5. April, dem
Palmsonntag, ist denn
auch das Unglück her¬
eingebrochen. Im Dom
brach eine Feuers¬
brunst aus, die zuerst
das Tabernakel ergriff,
dann die Chorstühle der-
Domherren, „welche
lauter Kunst-Stück und
mit Gold ausgezieret
waren“, die Altäre mit
den Gemälden und Fi¬
guren, und binnen Kur¬
zem lag der Dom in Schutt und Asche. Der
neue Bischof Albert ließ sofort damit be-
ginnen, den Dom von Grund auf wieder auf-
zubauen: aber schon im folgenden Jahre
wurde er durch einen „einschlagenden Donner“
zum andern Male zerstört. In seiner Not
wandte sich der Bischof an den Kaiser, der
damals in Italien gegen Mailand im Felde
stand. Diese Bitte mag ihn Überwindung ge-
kostet haben, waren doch er und der Erz-
bischof von Salzburg die beiden deutschen
Kirchenfürsten, die den Gegenpapst Viktor IV.,
den der Kaiser auf den Hl. Stuhl erhoben
hatte, ablehnten und zum Papste Alexan-
der III. hielten, dem erbittertsten Feinde des
Staufers. Sei es nun, daß der Kaiser den
Bischof gewinnen wollte, sei es, daß er edle
Großmut walten ließ: die Hilfe zum Bau
wurde gewährt, und der Dom konnte in neuer
Pracht erstehen. Die Figuren des Bischofs
und des Kaisers auf der linken, die der Kaise-
rin Beatrix auf der rechten Seite des inneren
Domportales erinnern noch heute an Erbauer
und Spender.
Der Chronist fährt fort: Nach einer alten
Überlieferung habe die Kaiserin Beatrix einen
Weihbrunn-Kessel für den Dom gestiftet, der
anderen an Größe nicht nachstehe und aus
einem puren Chrysolith gefertigt sei. Sein
Wert würde denn auch auf 100 000 Gulden ge-
schätzt. Auch ginge eine Erzählung von
Mund zu Mund, die Kaiserin sei durch Fürbitte
und das nächst Weihenstephan fließende
Wasser des Hl. Korbinian vom Aussatze ge-
heilt worden und sie habe sich für diese Guttat
durch Stiftung der Schale „in etwas wollen
dankbar lieh erweisen“.
Manche Gelehrten haben sich mit dieser
Schale, von der uns der Chronist eine Zeich-
nung überliefert (Abbildung oben), befaßt.
Die einen hielten sie für persische, die andern
für byzantinische Arbeit aus dem Ende des
ersten nachchristlichen Jahrtausends. Manche
vermuteten auch, es sei gar kein Chrysolith ge-
wesen, sondern Glas. Auf die richtige Spur
führt uns folgende Überlegung. Der einzige
Fundort des seiner goldgrünen Farbe wegen
Chrysolith genannten Halbedelsteins war im
Altertum die Insel Seberget an der ägyptischen
Küste des Boten Meeres. In den im Jahre
1900 wiederentdeckten Lagerstätten finden
sich viele Gruben, die eine jahrhundertelange
Ausbeute erkennen lassen. Stücke bis zu
100 Pfund wurden dort gefunden, die von den
weltberühmten ägyptischen Edelsteinschnei-
dern zu Schmuckstücken oft von beträchtlichem
Umfang verarbeitet wurden. Die Bingaugen,
die sie auf unsere Schale eingeschnitten haben,
waren im Altertum ein beliebtes Ziermotiv, und
die sog. Olivenschnitte, die über die Oberfläche
zerstreut sind, ergeben sich aus der Verwen-
dung des Schneidrades: auch heute noch
schneidet man sie in Kristallglas-Schalen ein.
Die Schale ist spätantik und vielleicht durch
den ersten Kreuzzug, an dem viele burgun-
dische Bitter teilgenommen haben, nach Bur-
gund gekommen. Sie war ursprünglich als
Ampel gedacht, wie man sie in Seifen gefaßt
an drei Kettchen aufhing und im Schatze der
Markuskirche in Venedig noch sehen kann. Die
silbervergoldete Montierung mit den Fabel-
tieren, die der Schale als Weihbrunn-Kessel
die nötige Standfähigkeit verlieh, stammt aus
Burgund und ist im frühen zweiten Jahrtausend
entstanden.
Die letzte Kunde von dieser Schale haben
wir aus dem Jahre 1803, wo sie bei der Säku-
larisation mit dem übrigen Domschatze nach
München gebracht wurde. Seitdem ist sie ver-
schollen. Vielleicht tragen diese Zeilen dazu
bei, das Dunkel ihres Verbleibes zu lichten.
Es ist vielleicht hier der Ort, noch auf
einige andere frühmittelalterliche, orientalische
Halbedelsteinarbeiten hinzuweisen, die sich in
der Besidenz befinden. In der Seichen Ka-
pelle wird der Kelch des Kaisers Heinrich II.,
des Heiligen, aus dem Domschatz zu Bamberg
verwahrt, der auf der vorjährigen Ausstellung
„Kirchliche Kunstschätze in Bayern“ zu sehen
war. Die Cupa dieses Kelches ist eine ägyp-
tische Tasse aus Bergkristall aus dem X. Jahr-
hundert. Eine ebensolche Tasse, aber mit Un-
tertasse, ist in die Kanzel eingelassen, die der-
selbe Kaiser (1014) in den Dom zu Aachen
stiftete.
Eine ebenfalls ägyptische Trinkschale, nur
wenig jünger, befindet sich in der Schatz-
kammer (Nr. 139). Sie hat die Form eines
Henkelbechers und ist aus einem Achat ge-
schnitten. Die Fassung stammt von dem be-
rühmten Nürnberger Goldschmied Wenzel Jam-
nitzer (um 1560).
Das dritte Kleinod, welches hierher gehört,
stammt aus derselben Zeit, ist aber byzanti-
nisch. Es ist eine runde Schale aus Berg-
kristall mit geschwungenen Bippen auf der
Außenseite. Ähnliche Stücke sind im Grünen
Gewölbe in Dresden und im Domschatze der
Markuskirche in Venedig, der bekanntlich viele
Kostbarkeiten enthält, die nach der Erstür-
mung von Byzanz dorthin kamen. Unsere
Schale erhält aber eine besondere Bedeutung
durch die köstliche Fassung aus Gold, Email
und edlen Steinen, deren Entwurf von Hans
Holbein d. J. stammen solh Außerdem durch
ihre Geschichte. Sie war das Taufgeschenk
Heinrichs VIII. von England an den Sohn des
Die ganze Welt der Kunst liest die
WELTKUNST
Königs Jakob V. von Schottland. Von diesem
erbte sie seine Schwester Maria Stuart, deren
Sohn als Jakob I. den Thron von England be-
stieg. Durch seine Tochter, Elisabeth, die den
Pfalzgrafen Friedrich V., den Winterkönig,
heiratete (1613), kam sie an die Kurpfalz und
durch den Kurfürsten Carl Theodor in die
Schatzkammer der Besidenz.
Stangenbekrönung, Bronze
H. 33 cm — Fundort: Raja Selo Abara (West-Grusien)
Anfang des i. vorchristlichen Jahrhunderts
Georgisches Museum, Tiflis
Die Schale der Kaiserin Beatrix
Schale der Kaiserin Beatrix
Nach Meichelbeck, Historia Frisingensis, 1706
Das schönste und praktischste
Weihnachtsgeschenk
für jeden Kunstfreund und Sammler
ist und bleiht ein Jahresabonnement auf
die WELTKUNST
Preis 18.00 M.
Spezial-
Sammelmappe
Preis 4.50 M.
Einschließlich Zustellung
jtSin Geschenk in Form eines Abonnements
auf die WELT KUNST, diese einzige
wöchentlich erscheinendeKunstzeicung,bringt
dank aktueller, reich illustrierter Information
u. authentischer Preisberichterstattung jedem
Kunstfreunde in jederWoche des ganzenjahres
Freude, Nutzen und Anregung
Philobiblon
ist die einzige Monatsschrift für Bücherliebhaber, Bibliotheken und Buchhändler
mit wirklich internationaler Verbreitung. Anerkannte Fachleute bringen hervor-
ragende Beiträge aus allen Gebieten des Schrift- und Buchwesens und der
Bücherliebhaberei. Das „Philobiblon" ist vorzüglich gedruckt und reich illustriert.
Es ist nach dem Urteil wirklicher Kenner die schönste, interessanteste und
vor allem lebendigste bibliophile Monatsschrift, die bisher erschienen ist
Jährlich 10 Hefte kosten 15 RM und Porto
Goethe-Jahrgang 1932
bringt hervorragende Beiträge über Goethe und seinen Kreis, Goethe in der
Buchillustration und in der Musik, seltene Goethe-Ausgaben usw. Die Goethe-
Sonderhefte sind besonders reich ausgestattet und sieenthaltenmehrereBeilagen
Probehefte auf Verlangen vom Verlag
Herbert Reichner
WIEN, VI. STROHMAYERGASSE 6