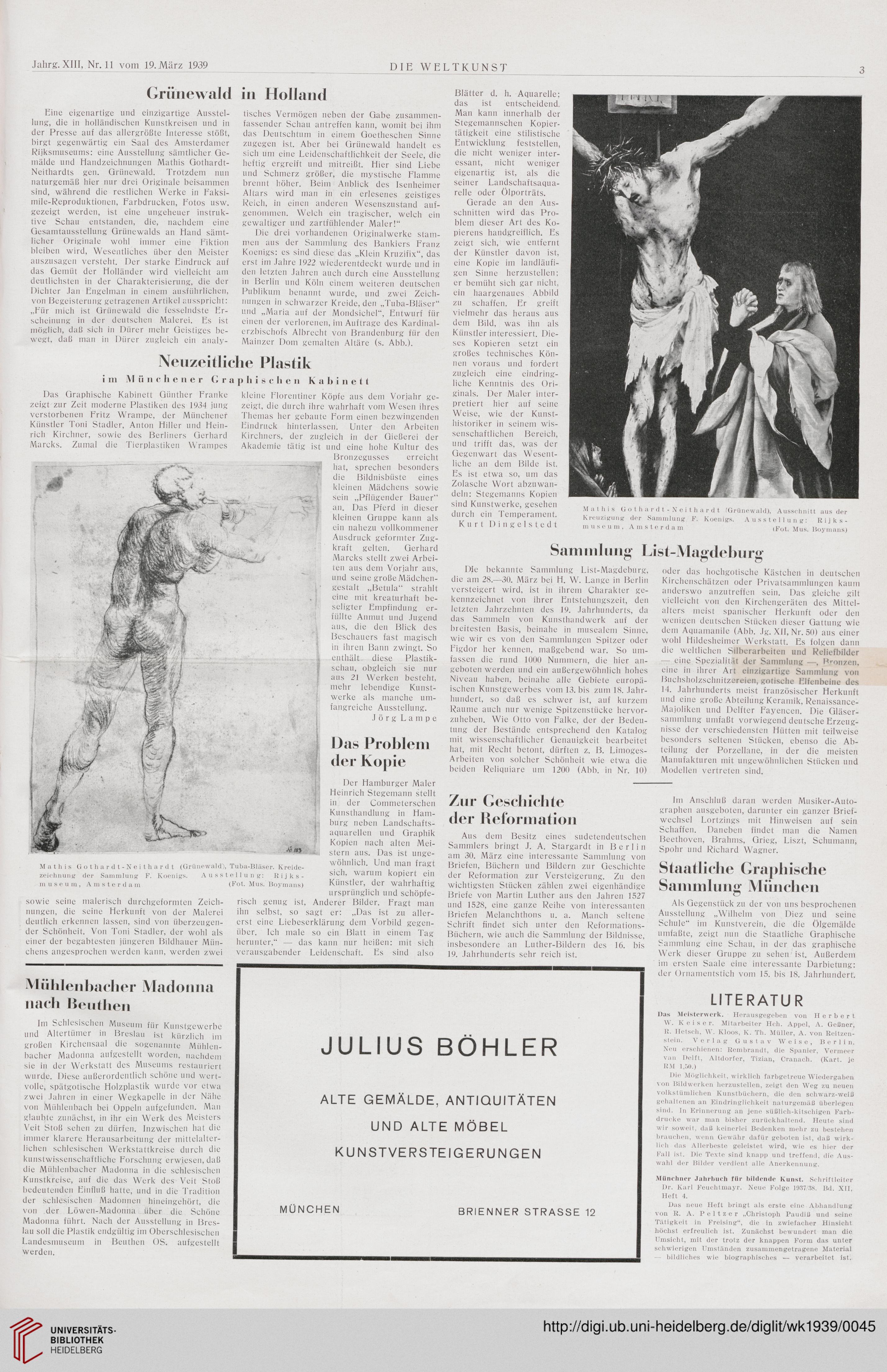Jahrg. XIII, Nr. 11 vom 19. März 1939
DIE WELTKUNST
3
Grünewald
Eine eigenartige und einzigartige Ausstel-
lung, die in holländischen Kunstkreisen und in
der Presse auf das allergrößte Interesse stößt,
birgt gegenwärtig ein Saal des Amsterdamer
Rijksmuseums: eine Ausstellung sämtlicher Ge-
mälde und Handzeichnungen Mathis Gothardt-
Neithardts gen. Grünewald. Trotzdem nun
naturgemäß hier nur drei Originale beisammen
sind, während die restlichen Werke in Faksi-
mile-Reproduktionen, Farbdrucken, Fotos usw.
gezeigt werden, ist eine ungeheuer instruk-
tive Schau entstanden, die, nachdem eine
Gesamtausstellung Grünewalds an Hand sämt-
licher Originale wohl immer eine Fiktion
bleiben wird, Wesentliches über den Meister
auszusagen versteht. Der starke Eindruck auf
das Gemüt der Holländer wird vielleicht am
deutlichsten in der Charakterisierung, die der
Dichter .Ian Engelman in einem ausführlichen,
von Begeisterung getragenen Artikel ausspricht:
„Für mich ist Grünewald die fesselndste Er-
scheinung in der deutschen Malerei. Es ist
möglich, daß sich in Dürer mehr Geistiges be-
wegt, daß man in Dürer zugleich ein analy-
in Holland
tisches Vermögen neben der Gabe zusammen-
fassender Schau antreffen kann, womit bei ihm
das Deutschtum in einem Goetheschen Sinne
zugegen ist. Aber bei Grünewald handelt es
sich um eine Leidenschaftlichkeit der Seele, die
heftig ergreift und mitreißt. Hier sind Liebe
und Schmerz größer, die mystische Flamme
brennt höher. Beim Anblick des Isenheimer
Altars wird man in ein erlesenes geistiges
Reich, in einen anderen Wesenszustand auf-
genommen. Welch ein tragischer, welch ein
gewaltiger und zartfühlender Maler!“
Die drei vorhandenen Originalwerke stam-
men aus der Sammlung des Bankiers Franz
Koenigs: es sind diese das „Klein Kruzifix“, das
erst im Jahre 1922 wiederentdeckt wurde und in
den letzten Jahren auch durch eine Ausstellung
in Berlin und Köln einem weiteren deutschen
Publikum benannt wurde, und zwei Zeich-
nungen in schwarzer Kreide, den „Tuba-Bläser“
und „Maria auf der Mondsichel“, Entwurf für
einen der verlorenen, im Auftrage des Kardinal-
erzbischofs Albrecht von Brandenburg für den
Mainzer Dom gemalten Altäre (s. Abb.).
Neuzeitliche Plastik
i in M ü n c li e n e r G r a p h i s c h e n Kabinett
Das Graphische Kabinett Günther Franke
zeigt zur Zeit moderne Plastiken des 1934 jung
kleine Florentiner Köpfe aus dem Vorjahr ge-
zeigt, die durch ihre wahrhaft vom Wesen ihres
verstorbenen Fritz Wrampe, der Münchener
Themas her gebaute Form einen bezwingenden
Künstler Toni Stadler, Anton Hiller und Hein-
rich Kirchner, sowie des Berliners Gerhard
Mareks. Zumal die Tierplastiken Wrampes
Eindruck hinterlassen. Unter den Arbeiten
Kirchners, der zugleich in der Gießerei der
Akademie tätig ist und eine hohe Kultur des
Mathis Gothardt-Neithardt (Grünewald), Tuba-Bläser. Kreide-
zeichnung der Sammlung F. Koenigs. Ausstellung: Rijks-
museum, Amsterdam (Fot. Mus. Boymans)
Bronzegusses erreicht
hat, sprechen besonders
die Bildnisbüste eines
kleinen Mädchens sowie
sein „Pflügender Bauer“
an. Das Pferd in dieser
kleinen Gruppe kann als
ein nahezu vollkommener
Ausdruck geformter Zug-
kraft gelten. Gerhard
Mareks stellt zwei Arbei-
ten aus dem Vorjahr aus,
und seine große Mädchen-
gestalt „Betula“ strahlt
eine mit kreaturhaft be-
seligter Empfindung er-
füllte Anmut und Jugend
aus, die den Blick des
Beschauers fast magisch
in ihren Bann zwingt. So
enthält diese Plastik-
schau, obgleich sie nur
aus 21 Werken besteht,
mehr lebendige Kunst-
werke als manche um-
fangreiche Ausstellung.
Jörg Lampe
Das Problem
der Kopie
Der Hamburger Maler
Heinrich Stegemann stellt
in der Commeterschen
Kunsthandlung in Ham-
burg neben Landschafts-
aquarellen und Graphik
Kopien nach alten Mei-
stern aus. Das ist unge-
wöhnlich. Und man fragt
sich, warum kopiert ein
Künstler, der wahrhaftig
ursprünglich und schöpfe-
sowie seine malerisch durchgeformten Zeich-
nungen, die seine Herkunft von der Malerei
deutlich erkennen lassen, sind von überzeugen-
der Schönheit. Von Toni Stadler, der wohl als
einer der begabtesten jüngeren Bildhauer Mün-
chens angesprochen werden kann, werden zwei
risch genug ist, Anderer Bilder. Fragt man
ihn selbst, so sagt er: „Das ist zu aller-
erst eine Liebeserklärung dem Vorbild gegen-
über. Ich male so ein Blatt in einem Tag
herunter,“ — das kann nur heißen: mit sich
verausgabender Leidenschaft. Es sind also
Blätter d. h. Aquarelle;
das ist entscheidend.
Man kann innerhalb der
Stegemannschen Kopier-
tätigkeit eine stilistische
Entwicklung feststellen,
die nicht weniger inter-
essant, nicht weniger
eigenartig ist, als die
seiner Landschaftsaqua-
relle oder Ölporträts.
Gerade an den Aus-
schnitten wird das Pro-
blem dieser Art des Ko-
pierens handgreiflich. Es
zeigt sich, wie entfernt
der Künstler davon ist,
eine Kopie im landläufi-
gen Sinne herzustellen;
er bemüht sich gar nicht,
ein haargenaues Abbild
zu schaffen. Er greift
vielmehr das heraus aus
dem Bild, was ihn als
Künstler interessiert. Die-
ses Kopieren setzt ein
großes technisches Kön-
nen voraus und fordert
zugleich eine eindring-
liche Kenntnis des Ori-
ginals. Der Maler inter-
pretiert hier auf seine
Weise, wie der Kunst-
historiker in seinem wis-
senschaftlichen Bereich,
und trifft das, was der
Gegenwart das Wesent-
liche an dem Bilde ist.
Es ist etwa so, um das
Zolasche Wort abzuwan-
deln: Stegemanns Kopien
sind Kunstwerke, gesehen
durch ein Temperament.
Kurt Dingelstedt
Mathis Gothardt-Neithardt /Grünewald), Ausschnitt aus der
Kreuzigung der Sammlung F. Koenigs. Ausstellung: Rijks-
museum, Amsterdam (Fot Mus. Boymans)
List-Magdeburg
Sammlung
Die bekannte Sammlung List-Magdeburg,
die am 28.—30. März bei H. W. Lange in Berlin
versteigert wird, ist in ihrem Charakter ge-
kennzeichnet von ihrer Entstehungszeit, den
letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, da
das Sammeln von Kunsthandwerk auf der
breitesten Basis, beinahe in musealem Sinne,
wie wir es von den Sammlungen Spitzer oder
Figdor her kennen, maßgebend war. So um-
fassen die rund 1000 Nummern, die hier an-
geboten werden und ein außergewöhnlich hohes
Niveau haben, beinahe alle Gebiete europä-
ischen Kunstgewerbes vom 13. bis zum 18. Jahr-
hundert, so daß es schwer ist, auf kurzem
Raume auch nur wenige Spitzenstücke hervor-
zuheben. Wie Otto von Falke, der der Bedeu-
tung der Bestände entsprechend den Katalog
mit wissenschaftlicher Genauigkeit bearbeitet
hat, mit Recht betont, dürften z. B. Limoges-
Arbeiten von solcher Schönheit wie etwa die
beiden Reliquiare um 1200 (Abb. in Nr. 10)
oder das hochgotische Kästchen in deutschen
Kirchenschätzen oder Privatsammlungen kaum
anderswo anzutreffen sein. Das gleiche gilt
vielleicht von den Kirchengeräten des Mittel-
alters meist spanischer Herkunft oder den
wenigen deutschen Stücken dieser Gattung wie
dem Aquamanile (Abb. Jg. XII, Nr. 50) aus einer
wohl Hildesheimer Werkstatt. Es folgen dann
die weltlichen Silberarbeiten und Reliefbilder
eine Spezialität der Sammlung —, Bronzen,
eine in ihrer Art einzigartige Sammlung von
Buchsholzschnitzereien, gotische Elfenbeine des
14. Jahrhunderts meist französischer Herkunft
und eine große Abteilung Keramik, Renaissance-
Majoliken und Delfter Fayencen. Die Gläser-
sammlung umfaßt vorwiegend deutsche Erzeug-
nisse der verschiedensten Hütten mit teilweise
besonders seltenen Stücken, ebenso die Ab-
teilung der Porzellane, in der die meisten
Manufakturen mit ungewöhnlichen Stücken und
Modellen vertreten sind.
Zur Geschichte
der Reformation
Aus dem Besitz eines sudetendeutschen
Sammlers bringt J. A. Stargardt in Berlin
am 30. März eine interessante Sammlung von
Briefen, Büchern und Bildern zur Geschichte
der Reformation zur Versteigerung. Zu den
wichtigsten Stücken zählen zwei eigenhändige
Briefe von Martin Luther aus den Jahren 1527
und 1528, eine ganze Reihe von interessanten
Briefen Melanchthons u. a. Manch seltene
Schrift findet sich unter den Reformations-
Büchern, wie auch die Sammlung der Bildnisse,
insbesondere an Luther-Bildern des 16. bis
19. Jahrhunderts sehr reich ist.
Im Anschluß daran werden Musiker-Auto-
graphen ausgeboten, darunter ein ganzer Brief-
wechsel Lortzings mit Hinweisen auf sein
Schaffen. Daneben findet man die Namen
Beethoven, Brahms, Grieg, Liszt, Schumann,
Spohr und Richard Wagner.
Staatliche Graphische
Sammlung München
Als Gegenstück zu der von uns besprochenen
Ausstellung „Wilhelm von Diez und seine
Schule“ im Kunstverein, die die Ölgemälde
umfaßte, zeigt nun die Staatliche Graphische
Sammlung eine Schau, in der das graphische
Werk dieser Gruppe zu sehen ist. Außerdem
Mühlenbacher Madonna
nach Beuilien
Im Schlesischen Museum für Kunstgewerbe
und Altertümer in Breslau ist kürzlich im
großen Kirchensaal die sogenannte Mühlen-
bacher Madonna aufgestellt worden, nachdem
sie in der Werkstatt des Museums restauriert
wurde. Diese außerordentlich schöne und wert-
volle, spätgotische Holzplastik wurde vor etwa
zwei Jahren in einer Wegkapelle in der Nähe
von Mühlenbach bei Oppeln aufgefunden. Man
glaubte zunächst, in ihr ein Werk des Meisters
Veit Stoß sehen zu dürfen. Inzwischen hat die
immer klarere Herausarbeitung der mittelalter-
lichen schlesischen Werkstattkreise durch die
kunstwissenschaftliche Forschung erwiesen, daß
die Mühlenbacher Madonna in die schlesischen
Kunstkreise, auf die das Werk des Veit Stoß
bedeutenden Einfluß hatte, und in die Tradition
der schlesischen Madonnen hineingehört, die
von der Löwen-Madonna über die Schöne
Madonna führt. Nach der Ausstellung in Bres-
lau soll die Plastik endgültig im Oberschlesischen
Landesmuseum in Beuthen OS. aufgestellt
werden.
ALTE GEMÄLDE, ANTIQUITÄTEN
UND ALTE MÖBEL
KUNSTVERSTEIGERUNGEN
MÜNCHEN BRIENNER STRASSE 12
im ersten Saale eine interessante Darbietung:
der Ornamentstich vom 15. bis 18. Jahrhundert.
LITERATUR
Das Meisterwerk. Herausgegeben von Herbert
W. K e i s e r. Mitarbeiter Heb. Appel, A. Geßner,
R. Hetsch, W. Kloos, K. Th. Müller, A. von Reitzen-
stein. Verlag Gustav Weise, Berlin.
Neu erschienen: Rembrandt, die Spanier, Vermeer
van Delft, Altdorfer, Tizian, Cranach. (Kart, je
RM 1,50.)
Die Möglichkeit, wirklich farbgetreue Wiedergaben
von Bildwerken herzustellen, zeigt den Weg zu neuen
volkstümlichen Kunstbüchern, die den schwarz-weiß
gehaltenen an Eindringlichkeit naturgemäß überlegen
sind. In Erinnerung an jene süßlich-kitschigen Farb-
drucke war man bisher zurückhaltend. Heute sind
wir soweit, daß keinerlei Bedenken mehr zu bestehen
brauchen, wenn Gewähr dafür geboten ist, daß wirk-
lich das Allerbeste geleistet wird, wie es hier der
Fall ist. Die Texte sind knapp und treffend, die Aus-
wahl der Bilder verdient alle Anerkennung.
Münchner Jahrbuch für bildende Kunst. Schriftleiter
Dr. Karl Feuchtmayr. Neue Folge 1937/38. Bd. XII,
Heft 4.
Das neue Heft bringt als erste eine Abhandlung
von R. A. Peltzer „Christoph Paudiß und seine
Tätigkeit in Freising“, die in zwiefacher Hinsicht
höchst erfreulich ist. Zunächst bewundert man die
Umsicht, mit der trotz der knappen Form das unter
schwierigen Umständen zusammen getragene Material
- bildliches wie biographisches — verarbeitet ist.
DIE WELTKUNST
3
Grünewald
Eine eigenartige und einzigartige Ausstel-
lung, die in holländischen Kunstkreisen und in
der Presse auf das allergrößte Interesse stößt,
birgt gegenwärtig ein Saal des Amsterdamer
Rijksmuseums: eine Ausstellung sämtlicher Ge-
mälde und Handzeichnungen Mathis Gothardt-
Neithardts gen. Grünewald. Trotzdem nun
naturgemäß hier nur drei Originale beisammen
sind, während die restlichen Werke in Faksi-
mile-Reproduktionen, Farbdrucken, Fotos usw.
gezeigt werden, ist eine ungeheuer instruk-
tive Schau entstanden, die, nachdem eine
Gesamtausstellung Grünewalds an Hand sämt-
licher Originale wohl immer eine Fiktion
bleiben wird, Wesentliches über den Meister
auszusagen versteht. Der starke Eindruck auf
das Gemüt der Holländer wird vielleicht am
deutlichsten in der Charakterisierung, die der
Dichter .Ian Engelman in einem ausführlichen,
von Begeisterung getragenen Artikel ausspricht:
„Für mich ist Grünewald die fesselndste Er-
scheinung in der deutschen Malerei. Es ist
möglich, daß sich in Dürer mehr Geistiges be-
wegt, daß man in Dürer zugleich ein analy-
in Holland
tisches Vermögen neben der Gabe zusammen-
fassender Schau antreffen kann, womit bei ihm
das Deutschtum in einem Goetheschen Sinne
zugegen ist. Aber bei Grünewald handelt es
sich um eine Leidenschaftlichkeit der Seele, die
heftig ergreift und mitreißt. Hier sind Liebe
und Schmerz größer, die mystische Flamme
brennt höher. Beim Anblick des Isenheimer
Altars wird man in ein erlesenes geistiges
Reich, in einen anderen Wesenszustand auf-
genommen. Welch ein tragischer, welch ein
gewaltiger und zartfühlender Maler!“
Die drei vorhandenen Originalwerke stam-
men aus der Sammlung des Bankiers Franz
Koenigs: es sind diese das „Klein Kruzifix“, das
erst im Jahre 1922 wiederentdeckt wurde und in
den letzten Jahren auch durch eine Ausstellung
in Berlin und Köln einem weiteren deutschen
Publikum benannt wurde, und zwei Zeich-
nungen in schwarzer Kreide, den „Tuba-Bläser“
und „Maria auf der Mondsichel“, Entwurf für
einen der verlorenen, im Auftrage des Kardinal-
erzbischofs Albrecht von Brandenburg für den
Mainzer Dom gemalten Altäre (s. Abb.).
Neuzeitliche Plastik
i in M ü n c li e n e r G r a p h i s c h e n Kabinett
Das Graphische Kabinett Günther Franke
zeigt zur Zeit moderne Plastiken des 1934 jung
kleine Florentiner Köpfe aus dem Vorjahr ge-
zeigt, die durch ihre wahrhaft vom Wesen ihres
verstorbenen Fritz Wrampe, der Münchener
Themas her gebaute Form einen bezwingenden
Künstler Toni Stadler, Anton Hiller und Hein-
rich Kirchner, sowie des Berliners Gerhard
Mareks. Zumal die Tierplastiken Wrampes
Eindruck hinterlassen. Unter den Arbeiten
Kirchners, der zugleich in der Gießerei der
Akademie tätig ist und eine hohe Kultur des
Mathis Gothardt-Neithardt (Grünewald), Tuba-Bläser. Kreide-
zeichnung der Sammlung F. Koenigs. Ausstellung: Rijks-
museum, Amsterdam (Fot. Mus. Boymans)
Bronzegusses erreicht
hat, sprechen besonders
die Bildnisbüste eines
kleinen Mädchens sowie
sein „Pflügender Bauer“
an. Das Pferd in dieser
kleinen Gruppe kann als
ein nahezu vollkommener
Ausdruck geformter Zug-
kraft gelten. Gerhard
Mareks stellt zwei Arbei-
ten aus dem Vorjahr aus,
und seine große Mädchen-
gestalt „Betula“ strahlt
eine mit kreaturhaft be-
seligter Empfindung er-
füllte Anmut und Jugend
aus, die den Blick des
Beschauers fast magisch
in ihren Bann zwingt. So
enthält diese Plastik-
schau, obgleich sie nur
aus 21 Werken besteht,
mehr lebendige Kunst-
werke als manche um-
fangreiche Ausstellung.
Jörg Lampe
Das Problem
der Kopie
Der Hamburger Maler
Heinrich Stegemann stellt
in der Commeterschen
Kunsthandlung in Ham-
burg neben Landschafts-
aquarellen und Graphik
Kopien nach alten Mei-
stern aus. Das ist unge-
wöhnlich. Und man fragt
sich, warum kopiert ein
Künstler, der wahrhaftig
ursprünglich und schöpfe-
sowie seine malerisch durchgeformten Zeich-
nungen, die seine Herkunft von der Malerei
deutlich erkennen lassen, sind von überzeugen-
der Schönheit. Von Toni Stadler, der wohl als
einer der begabtesten jüngeren Bildhauer Mün-
chens angesprochen werden kann, werden zwei
risch genug ist, Anderer Bilder. Fragt man
ihn selbst, so sagt er: „Das ist zu aller-
erst eine Liebeserklärung dem Vorbild gegen-
über. Ich male so ein Blatt in einem Tag
herunter,“ — das kann nur heißen: mit sich
verausgabender Leidenschaft. Es sind also
Blätter d. h. Aquarelle;
das ist entscheidend.
Man kann innerhalb der
Stegemannschen Kopier-
tätigkeit eine stilistische
Entwicklung feststellen,
die nicht weniger inter-
essant, nicht weniger
eigenartig ist, als die
seiner Landschaftsaqua-
relle oder Ölporträts.
Gerade an den Aus-
schnitten wird das Pro-
blem dieser Art des Ko-
pierens handgreiflich. Es
zeigt sich, wie entfernt
der Künstler davon ist,
eine Kopie im landläufi-
gen Sinne herzustellen;
er bemüht sich gar nicht,
ein haargenaues Abbild
zu schaffen. Er greift
vielmehr das heraus aus
dem Bild, was ihn als
Künstler interessiert. Die-
ses Kopieren setzt ein
großes technisches Kön-
nen voraus und fordert
zugleich eine eindring-
liche Kenntnis des Ori-
ginals. Der Maler inter-
pretiert hier auf seine
Weise, wie der Kunst-
historiker in seinem wis-
senschaftlichen Bereich,
und trifft das, was der
Gegenwart das Wesent-
liche an dem Bilde ist.
Es ist etwa so, um das
Zolasche Wort abzuwan-
deln: Stegemanns Kopien
sind Kunstwerke, gesehen
durch ein Temperament.
Kurt Dingelstedt
Mathis Gothardt-Neithardt /Grünewald), Ausschnitt aus der
Kreuzigung der Sammlung F. Koenigs. Ausstellung: Rijks-
museum, Amsterdam (Fot Mus. Boymans)
List-Magdeburg
Sammlung
Die bekannte Sammlung List-Magdeburg,
die am 28.—30. März bei H. W. Lange in Berlin
versteigert wird, ist in ihrem Charakter ge-
kennzeichnet von ihrer Entstehungszeit, den
letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, da
das Sammeln von Kunsthandwerk auf der
breitesten Basis, beinahe in musealem Sinne,
wie wir es von den Sammlungen Spitzer oder
Figdor her kennen, maßgebend war. So um-
fassen die rund 1000 Nummern, die hier an-
geboten werden und ein außergewöhnlich hohes
Niveau haben, beinahe alle Gebiete europä-
ischen Kunstgewerbes vom 13. bis zum 18. Jahr-
hundert, so daß es schwer ist, auf kurzem
Raume auch nur wenige Spitzenstücke hervor-
zuheben. Wie Otto von Falke, der der Bedeu-
tung der Bestände entsprechend den Katalog
mit wissenschaftlicher Genauigkeit bearbeitet
hat, mit Recht betont, dürften z. B. Limoges-
Arbeiten von solcher Schönheit wie etwa die
beiden Reliquiare um 1200 (Abb. in Nr. 10)
oder das hochgotische Kästchen in deutschen
Kirchenschätzen oder Privatsammlungen kaum
anderswo anzutreffen sein. Das gleiche gilt
vielleicht von den Kirchengeräten des Mittel-
alters meist spanischer Herkunft oder den
wenigen deutschen Stücken dieser Gattung wie
dem Aquamanile (Abb. Jg. XII, Nr. 50) aus einer
wohl Hildesheimer Werkstatt. Es folgen dann
die weltlichen Silberarbeiten und Reliefbilder
eine Spezialität der Sammlung —, Bronzen,
eine in ihrer Art einzigartige Sammlung von
Buchsholzschnitzereien, gotische Elfenbeine des
14. Jahrhunderts meist französischer Herkunft
und eine große Abteilung Keramik, Renaissance-
Majoliken und Delfter Fayencen. Die Gläser-
sammlung umfaßt vorwiegend deutsche Erzeug-
nisse der verschiedensten Hütten mit teilweise
besonders seltenen Stücken, ebenso die Ab-
teilung der Porzellane, in der die meisten
Manufakturen mit ungewöhnlichen Stücken und
Modellen vertreten sind.
Zur Geschichte
der Reformation
Aus dem Besitz eines sudetendeutschen
Sammlers bringt J. A. Stargardt in Berlin
am 30. März eine interessante Sammlung von
Briefen, Büchern und Bildern zur Geschichte
der Reformation zur Versteigerung. Zu den
wichtigsten Stücken zählen zwei eigenhändige
Briefe von Martin Luther aus den Jahren 1527
und 1528, eine ganze Reihe von interessanten
Briefen Melanchthons u. a. Manch seltene
Schrift findet sich unter den Reformations-
Büchern, wie auch die Sammlung der Bildnisse,
insbesondere an Luther-Bildern des 16. bis
19. Jahrhunderts sehr reich ist.
Im Anschluß daran werden Musiker-Auto-
graphen ausgeboten, darunter ein ganzer Brief-
wechsel Lortzings mit Hinweisen auf sein
Schaffen. Daneben findet man die Namen
Beethoven, Brahms, Grieg, Liszt, Schumann,
Spohr und Richard Wagner.
Staatliche Graphische
Sammlung München
Als Gegenstück zu der von uns besprochenen
Ausstellung „Wilhelm von Diez und seine
Schule“ im Kunstverein, die die Ölgemälde
umfaßte, zeigt nun die Staatliche Graphische
Sammlung eine Schau, in der das graphische
Werk dieser Gruppe zu sehen ist. Außerdem
Mühlenbacher Madonna
nach Beuilien
Im Schlesischen Museum für Kunstgewerbe
und Altertümer in Breslau ist kürzlich im
großen Kirchensaal die sogenannte Mühlen-
bacher Madonna aufgestellt worden, nachdem
sie in der Werkstatt des Museums restauriert
wurde. Diese außerordentlich schöne und wert-
volle, spätgotische Holzplastik wurde vor etwa
zwei Jahren in einer Wegkapelle in der Nähe
von Mühlenbach bei Oppeln aufgefunden. Man
glaubte zunächst, in ihr ein Werk des Meisters
Veit Stoß sehen zu dürfen. Inzwischen hat die
immer klarere Herausarbeitung der mittelalter-
lichen schlesischen Werkstattkreise durch die
kunstwissenschaftliche Forschung erwiesen, daß
die Mühlenbacher Madonna in die schlesischen
Kunstkreise, auf die das Werk des Veit Stoß
bedeutenden Einfluß hatte, und in die Tradition
der schlesischen Madonnen hineingehört, die
von der Löwen-Madonna über die Schöne
Madonna führt. Nach der Ausstellung in Bres-
lau soll die Plastik endgültig im Oberschlesischen
Landesmuseum in Beuthen OS. aufgestellt
werden.
ALTE GEMÄLDE, ANTIQUITÄTEN
UND ALTE MÖBEL
KUNSTVERSTEIGERUNGEN
MÜNCHEN BRIENNER STRASSE 12
im ersten Saale eine interessante Darbietung:
der Ornamentstich vom 15. bis 18. Jahrhundert.
LITERATUR
Das Meisterwerk. Herausgegeben von Herbert
W. K e i s e r. Mitarbeiter Heb. Appel, A. Geßner,
R. Hetsch, W. Kloos, K. Th. Müller, A. von Reitzen-
stein. Verlag Gustav Weise, Berlin.
Neu erschienen: Rembrandt, die Spanier, Vermeer
van Delft, Altdorfer, Tizian, Cranach. (Kart, je
RM 1,50.)
Die Möglichkeit, wirklich farbgetreue Wiedergaben
von Bildwerken herzustellen, zeigt den Weg zu neuen
volkstümlichen Kunstbüchern, die den schwarz-weiß
gehaltenen an Eindringlichkeit naturgemäß überlegen
sind. In Erinnerung an jene süßlich-kitschigen Farb-
drucke war man bisher zurückhaltend. Heute sind
wir soweit, daß keinerlei Bedenken mehr zu bestehen
brauchen, wenn Gewähr dafür geboten ist, daß wirk-
lich das Allerbeste geleistet wird, wie es hier der
Fall ist. Die Texte sind knapp und treffend, die Aus-
wahl der Bilder verdient alle Anerkennung.
Münchner Jahrbuch für bildende Kunst. Schriftleiter
Dr. Karl Feuchtmayr. Neue Folge 1937/38. Bd. XII,
Heft 4.
Das neue Heft bringt als erste eine Abhandlung
von R. A. Peltzer „Christoph Paudiß und seine
Tätigkeit in Freising“, die in zwiefacher Hinsicht
höchst erfreulich ist. Zunächst bewundert man die
Umsicht, mit der trotz der knappen Form das unter
schwierigen Umständen zusammen getragene Material
- bildliches wie biographisches — verarbeitet ist.