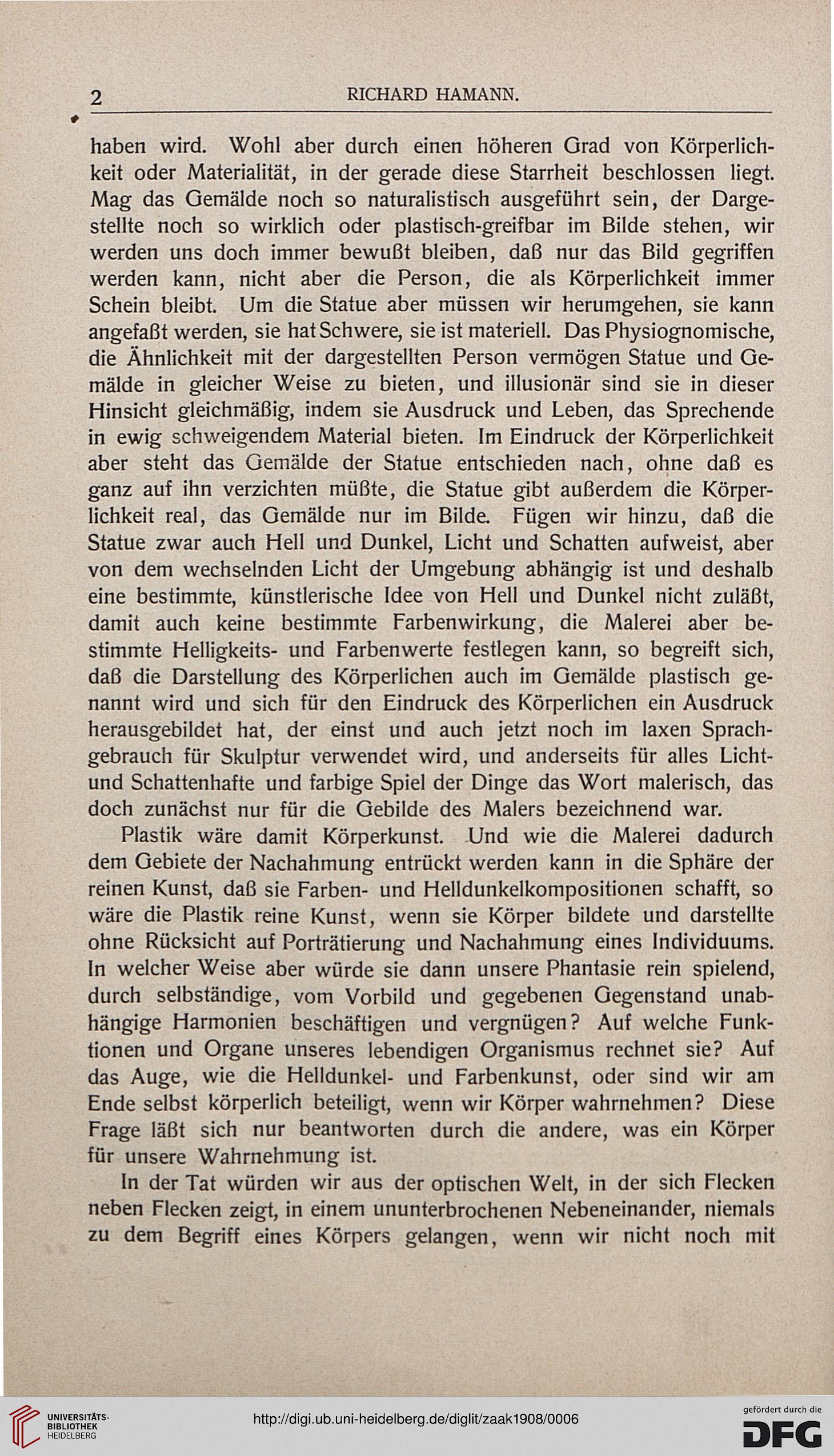RICHARD HAMANN.
haben wird. Wohl aber durch einen höheren Grad von Körperlich-
keit oder Materialität, in der gerade diese Starrheit beschlossen liegt.
Mag das Gemälde noch so naturalistisch ausgeführt sein, der Darge-
stellte noch so wirklich oder plastisch-greifbar im Bilde stehen, wir
werden uns doch immer bewußt bleiben, daß nur das Bild gegriffen
werden kann, nicht aber die Person, die als Körperlichkeit immer
Schein bleibt. Um die Statue aber müssen wir herumgehen, sie kann
angefaßt werden, sie hat Schwere, sie ist materiell. Das Physiognomische,
die Ähnlichkeit mit der dargestellten Person vermögen Statue und Ge-
mälde in gleicher Weise zu bieten, und illusionär sind sie in dieser
Hinsicht gleichmäßig, indem sie Ausdruck und Leben, das Sprechende
in ewig schweigendem Material bieten. Im Eindruck der Körperlichkeit
aber steht das Gemälde der Statue entschieden nach, ohne daß es
ganz auf ihn verzichten müßte, die Statue gibt außerdem die Körper-
lichkeit real, das Gemälde nur im Bilde. Fügen wir hinzu, daß die
Statue zwar auch Hell und Dunkel, Licht und Schatten aufweist, aber
von dem wechselnden Licht der Umgebung abhängig ist und deshalb
eine bestimmte, künstlerische Idee von Hell und Dunkel nicht zuläßt,
damit auch keine bestimmte Farbenwirkung, die Malerei aber be-
stimmte Helligkeits- und Farbenwerte festlegen kann, so begreift sich,
daß die Darstellung des Körperlichen auch im Gemälde plastisch ge-
nannt wird und sich für den Eindruck des Körperlichen ein Ausdruck
herausgebildet hat, der einst und auch jetzt noch im laxen Sprach-
gebrauch für Skulptur verwendet wird, und anderseits für alles Licht-
und Schattenhafte und farbige Spiel der Dinge das Wort malerisch, das
doch zunächst nur für die Gebilde des Malers bezeichnend war.
Plastik wäre damit Körperkunst. Und wie die Malerei dadurch
dem Gebiete der Nachahmung entrückt werden kann in die Sphäre der
reinen Kunst, daß sie Farben- und Helldunkelkompositionen schafft, so
wäre die Plastik reine Kunst, wenn sie Körper bildete und darstellte
ohne Rücksicht auf Porträtierung und Nachahmung eines Individuums.
In welcher Weise aber würde sie dann unsere Phantasie rein spielend,
durch selbständige, vom Vorbild und gegebenen Gegenstand unab-
hängige Harmonien beschäftigen und vergnügen? Auf welche Funk-
tionen und Organe unseres lebendigen Organismus rechnet sie? Auf
das Auge, wie die Helldunkel- und Farbenkunst, oder sind wir am
Ende selbst körperlich beteiligt, wenn wir Körper wahrnehmen? Diese
Frage läßt sich nur beantworten durch die andere, was ein Körper
für unsere Wahrnehmung ist.
In der Tat würden wir aus der optischen Welt, in der sich Flecken
neben Flecken zeigt, in einem ununterbrochenen Nebeneinander, niemals
zu dem Begriff eines Körpers gelangen, wenn wir nicht noch mit
haben wird. Wohl aber durch einen höheren Grad von Körperlich-
keit oder Materialität, in der gerade diese Starrheit beschlossen liegt.
Mag das Gemälde noch so naturalistisch ausgeführt sein, der Darge-
stellte noch so wirklich oder plastisch-greifbar im Bilde stehen, wir
werden uns doch immer bewußt bleiben, daß nur das Bild gegriffen
werden kann, nicht aber die Person, die als Körperlichkeit immer
Schein bleibt. Um die Statue aber müssen wir herumgehen, sie kann
angefaßt werden, sie hat Schwere, sie ist materiell. Das Physiognomische,
die Ähnlichkeit mit der dargestellten Person vermögen Statue und Ge-
mälde in gleicher Weise zu bieten, und illusionär sind sie in dieser
Hinsicht gleichmäßig, indem sie Ausdruck und Leben, das Sprechende
in ewig schweigendem Material bieten. Im Eindruck der Körperlichkeit
aber steht das Gemälde der Statue entschieden nach, ohne daß es
ganz auf ihn verzichten müßte, die Statue gibt außerdem die Körper-
lichkeit real, das Gemälde nur im Bilde. Fügen wir hinzu, daß die
Statue zwar auch Hell und Dunkel, Licht und Schatten aufweist, aber
von dem wechselnden Licht der Umgebung abhängig ist und deshalb
eine bestimmte, künstlerische Idee von Hell und Dunkel nicht zuläßt,
damit auch keine bestimmte Farbenwirkung, die Malerei aber be-
stimmte Helligkeits- und Farbenwerte festlegen kann, so begreift sich,
daß die Darstellung des Körperlichen auch im Gemälde plastisch ge-
nannt wird und sich für den Eindruck des Körperlichen ein Ausdruck
herausgebildet hat, der einst und auch jetzt noch im laxen Sprach-
gebrauch für Skulptur verwendet wird, und anderseits für alles Licht-
und Schattenhafte und farbige Spiel der Dinge das Wort malerisch, das
doch zunächst nur für die Gebilde des Malers bezeichnend war.
Plastik wäre damit Körperkunst. Und wie die Malerei dadurch
dem Gebiete der Nachahmung entrückt werden kann in die Sphäre der
reinen Kunst, daß sie Farben- und Helldunkelkompositionen schafft, so
wäre die Plastik reine Kunst, wenn sie Körper bildete und darstellte
ohne Rücksicht auf Porträtierung und Nachahmung eines Individuums.
In welcher Weise aber würde sie dann unsere Phantasie rein spielend,
durch selbständige, vom Vorbild und gegebenen Gegenstand unab-
hängige Harmonien beschäftigen und vergnügen? Auf welche Funk-
tionen und Organe unseres lebendigen Organismus rechnet sie? Auf
das Auge, wie die Helldunkel- und Farbenkunst, oder sind wir am
Ende selbst körperlich beteiligt, wenn wir Körper wahrnehmen? Diese
Frage läßt sich nur beantworten durch die andere, was ein Körper
für unsere Wahrnehmung ist.
In der Tat würden wir aus der optischen Welt, in der sich Flecken
neben Flecken zeigt, in einem ununterbrochenen Nebeneinander, niemals
zu dem Begriff eines Körpers gelangen, wenn wir nicht noch mit