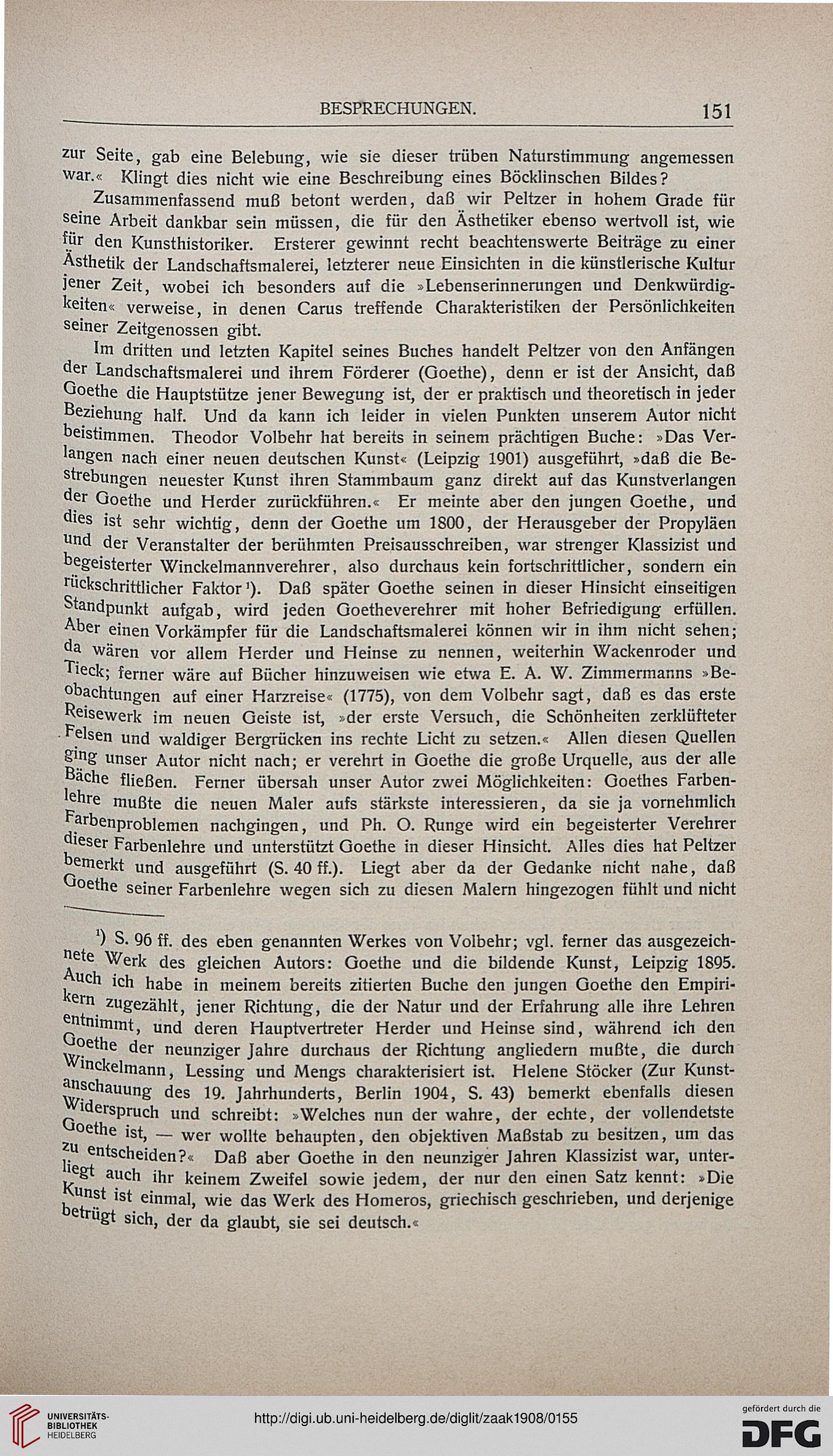BESPRECHUNGEN.
151
zur Seite, gab eine Belebung, wie sie dieser trüben Naturstimmung angemessen
war.« Klingt dies nicht wie eine Beschreibung eines Böcklinschen Bildes?
Zusammenfassend muß betont werden, daß wir Peltzer in hohem Grade für
seine Arbeit dankbar sein müssen, die für den Ästhetiker ebenso wertvoll ist, wie
für den Kunsthistoriker. Ersterer gewinnt recht beachtenswerte Beiträge zu einer
Ästhetik der Landschaftsmalerei, letzterer neue Einsichten in die künstlerische Kultur
jener Zeit, wobei ich besonders auf die »Lebenserinnerungen und Denkwürdig-
keiten« verweise, in denen Carus treffende Charakteristiken der Persönlichkeiten
seiner Zeitgenossen gibt.
Im dritten und letzten Kapitel seines Buches handelt Peltzer von den Anfängen
der Landschaftsmalerei und ihrem Förderer (Goethe), denn er ist der Ansicht, daß
Goethe die Hauptstütze jener Bewegung ist, der er praktisch und theoretisch in jeder
Beziehung half. Und da kann ich leider in vielen Punkten unserem Autor nicht
beistimmen. Theodor Volbehr hat bereits in seinem prächtigen Buche: »Das Ver-
engen nach einer neuen deutschen Kunst« (Leipzig 1901) ausgeführt, »daß die Be-
strebungen neuester Kunst ihren Stammbaum ganz direkt auf das Kunstverlangen
fr Goethe und Herder zurückführen.« Er meinte aber den jungen Goethe, und
0les ist sehr wichtig, denn der Goethe um 1800, der Herausgeber der Propyläen
und der Veranstalter der berühmten Preisausschreiben, war strenger Klassizist und
begeisterter Winckelmannverehrer, also durchaus kein fortschrittlicher, sondern ein
rückschrittlicher Faktor1). Daß später Goethe seinen in dieser Hinsicht einseitigen
Standpunkt aufgab, wird jeden Goetheverehrer mit hoher Befriedigung erfüllen.
Aber einen Vorkämpfer für die Landschaftsmalerei können wir in ihm nicht sehen;
da
wären vor allem Herder und Heinse zu nennen, weiterhin Wackenroder und
ileck; ferner wäre auf Bücher hinzuweisen wie etwa E. A. W. Zimmermanns »Be-
achtungen auf einer Harzreise« (1775), von dem Volbehr sagt, daß es das erste
fteisewerk im neuen Geiste ist, »der erste Versuch, die Schönheiten zerklüfteter
•"eisen und waldiger Bergrücken ins rechte Licht zu setzen.« Allen diesen Quellen
|'ng unser Autor nicht nach; er verehrt in Goethe die große Urquelle, aus der alle
ache fließen. Ferner übersah unser Autor zwei Möglichkeiten: Goethes Farben-
j^ure mußte die neuen Maler aufs stärkste interessieren, da sie ja vornehmlich
arbenproblemen nachgingen, und Ph. O. Runge wird ein begeisterter Verehrer
'eser Farbenlehre und unterstützt Goethe in dieser Hinsicht. Alles dies hat Peltzer
gemerkt und ausgeführt (S. 40 ff.). Liegt aber da der Gedanke nicht nahe, daß
Qoeth
e seiner Farbenlehre wegen sich zu diesen Malern hingezogen fühlt und nicht
) S. 96 ff. des eben genannten Werkes von Volbehr; vgl. ferner das ausgezeich-
te Werk des gleichen Autors: Goethe und die bildende Kunst, Leipzig 1895.
eh ich habe in meinem bereits zitierten Buche den jungen Goethe den Empiri-
en zugezählt, jener Richtung, die der Natur und der Erfahrung alle ihre Lehren
nimmt, und deren Hauptvertreter Herder und Heinse sind, während ich den
oethe der neunziger Jahre durchaus der Richtung angliedern mußte, die durch
nickelmann, Lessing und Mengs charakterisiert ist. Helene Stöcker (Zur Kunst-
^schauung des 19. Jahrhunderts, Berlin 1904, S. 43) bemerkt ebenfalls diesen
iderspruch und schreibt: »Welches nun der wahre, der echte, der vollendetste
oethe ist, — wer wollte behaupten, den objektiven Maßstab zu besitzen, um das
entscheiden?« Daß aber Goethe in den neunziger Jahren Klassizist war, unter-
gt auch ihr keinem Zweifel sowie jedem, der nur den einen Satz kennt: »Die
"'""'" ist einmal, wie das Werk des Homeros, griechisch geschrieben, und derjenige
beti
:rugt sich, der da glaubt, sie sei deutsch.«
151
zur Seite, gab eine Belebung, wie sie dieser trüben Naturstimmung angemessen
war.« Klingt dies nicht wie eine Beschreibung eines Böcklinschen Bildes?
Zusammenfassend muß betont werden, daß wir Peltzer in hohem Grade für
seine Arbeit dankbar sein müssen, die für den Ästhetiker ebenso wertvoll ist, wie
für den Kunsthistoriker. Ersterer gewinnt recht beachtenswerte Beiträge zu einer
Ästhetik der Landschaftsmalerei, letzterer neue Einsichten in die künstlerische Kultur
jener Zeit, wobei ich besonders auf die »Lebenserinnerungen und Denkwürdig-
keiten« verweise, in denen Carus treffende Charakteristiken der Persönlichkeiten
seiner Zeitgenossen gibt.
Im dritten und letzten Kapitel seines Buches handelt Peltzer von den Anfängen
der Landschaftsmalerei und ihrem Förderer (Goethe), denn er ist der Ansicht, daß
Goethe die Hauptstütze jener Bewegung ist, der er praktisch und theoretisch in jeder
Beziehung half. Und da kann ich leider in vielen Punkten unserem Autor nicht
beistimmen. Theodor Volbehr hat bereits in seinem prächtigen Buche: »Das Ver-
engen nach einer neuen deutschen Kunst« (Leipzig 1901) ausgeführt, »daß die Be-
strebungen neuester Kunst ihren Stammbaum ganz direkt auf das Kunstverlangen
fr Goethe und Herder zurückführen.« Er meinte aber den jungen Goethe, und
0les ist sehr wichtig, denn der Goethe um 1800, der Herausgeber der Propyläen
und der Veranstalter der berühmten Preisausschreiben, war strenger Klassizist und
begeisterter Winckelmannverehrer, also durchaus kein fortschrittlicher, sondern ein
rückschrittlicher Faktor1). Daß später Goethe seinen in dieser Hinsicht einseitigen
Standpunkt aufgab, wird jeden Goetheverehrer mit hoher Befriedigung erfüllen.
Aber einen Vorkämpfer für die Landschaftsmalerei können wir in ihm nicht sehen;
da
wären vor allem Herder und Heinse zu nennen, weiterhin Wackenroder und
ileck; ferner wäre auf Bücher hinzuweisen wie etwa E. A. W. Zimmermanns »Be-
achtungen auf einer Harzreise« (1775), von dem Volbehr sagt, daß es das erste
fteisewerk im neuen Geiste ist, »der erste Versuch, die Schönheiten zerklüfteter
•"eisen und waldiger Bergrücken ins rechte Licht zu setzen.« Allen diesen Quellen
|'ng unser Autor nicht nach; er verehrt in Goethe die große Urquelle, aus der alle
ache fließen. Ferner übersah unser Autor zwei Möglichkeiten: Goethes Farben-
j^ure mußte die neuen Maler aufs stärkste interessieren, da sie ja vornehmlich
arbenproblemen nachgingen, und Ph. O. Runge wird ein begeisterter Verehrer
'eser Farbenlehre und unterstützt Goethe in dieser Hinsicht. Alles dies hat Peltzer
gemerkt und ausgeführt (S. 40 ff.). Liegt aber da der Gedanke nicht nahe, daß
Qoeth
e seiner Farbenlehre wegen sich zu diesen Malern hingezogen fühlt und nicht
) S. 96 ff. des eben genannten Werkes von Volbehr; vgl. ferner das ausgezeich-
te Werk des gleichen Autors: Goethe und die bildende Kunst, Leipzig 1895.
eh ich habe in meinem bereits zitierten Buche den jungen Goethe den Empiri-
en zugezählt, jener Richtung, die der Natur und der Erfahrung alle ihre Lehren
nimmt, und deren Hauptvertreter Herder und Heinse sind, während ich den
oethe der neunziger Jahre durchaus der Richtung angliedern mußte, die durch
nickelmann, Lessing und Mengs charakterisiert ist. Helene Stöcker (Zur Kunst-
^schauung des 19. Jahrhunderts, Berlin 1904, S. 43) bemerkt ebenfalls diesen
iderspruch und schreibt: »Welches nun der wahre, der echte, der vollendetste
oethe ist, — wer wollte behaupten, den objektiven Maßstab zu besitzen, um das
entscheiden?« Daß aber Goethe in den neunziger Jahren Klassizist war, unter-
gt auch ihr keinem Zweifel sowie jedem, der nur den einen Satz kennt: »Die
"'""'" ist einmal, wie das Werk des Homeros, griechisch geschrieben, und derjenige
beti
:rugt sich, der da glaubt, sie sei deutsch.«